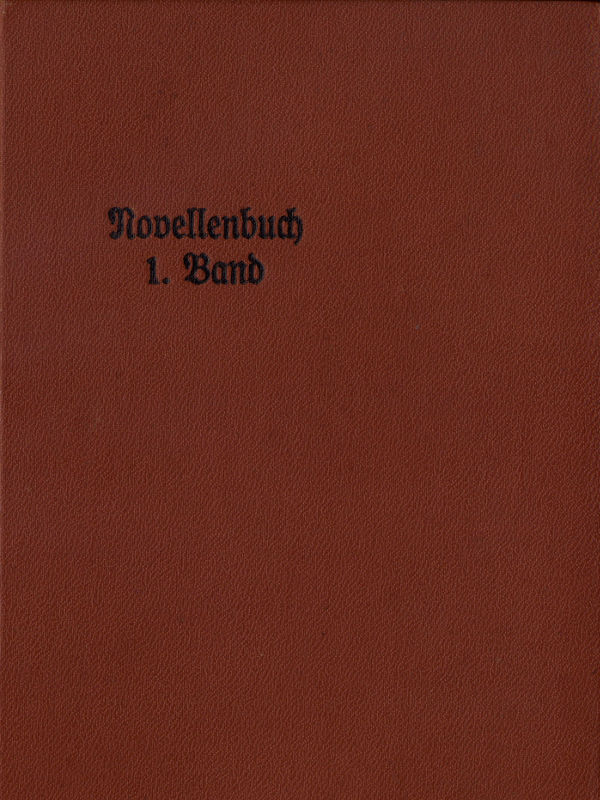
The Project Gutenberg EBook of Novellenbuch 1. Band, by
Conrad Ferdinand Meyer, Ernst von Wildenbruch, Friedrich Spielhagen & Detlev von Liliencron
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
Title: Novellenbuch 1. Band
Author: Conrad Ferdinand Meyer
Ernst von Wildenbruch
Friedrich Spielhagen
Detlev von Liliencron
Release Date: November 18, 2018 [EBook #58306]
Language: German
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLENBUCH 1. BAND ***
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter oder kursiver Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
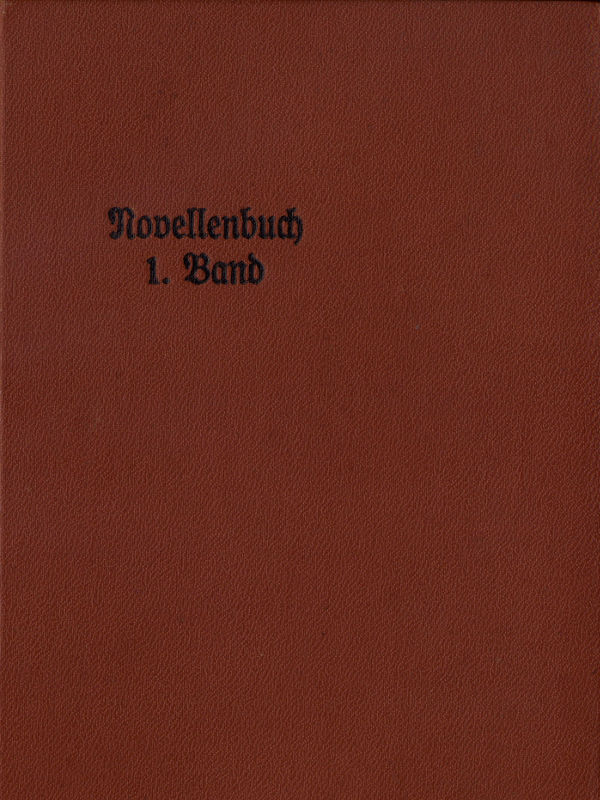
Hausbücherei
9
Hausbücherei
der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung
9. Band

Hamburg-Großborstel
Verlag der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung
1910
26.–35. Tausend
1. Band
Conrad Ferd. Meyer ▣ Friedr. Spielhagen
Ernst v. Wildenbruch ▣ Detlev v. Liliencron

Hamburg-Großborstel
Verlag der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung
1910
26.–35. Tausend
Inhaltsverzeichnis
zu den übrigen Bänden des Novellenbuchs
Band 2 (Hausbücherei Band 10):
Dorfgeschichten
Band 3 (Hausbücherei Band 14):
Geschichten aus deutscher Vorzeit
Band 4 (Hausbücherei Band 15):
Seegeschichten
Band 5 (Hausbücherei Band 22):
Frauennovellen
Band 6 (Hausbücherei Band 23):
Kindheitsgeschichten
Band 7 (Hausbücherei Band 24):
Kriegsgeschichten
| Seite | |
| Vorwort zum Novellenbuch | 6–7 |
| Vorbemerkungen zum ersten Bande | 8 |
| Meyer, Conrad Ferdinand: Das Amulet | 9–111 |
| Wildenbruch, Ernst von: Archambauld | 112–138 |
| Spielhagen, Friedrich: Breite Schultern | 139–172 |
| Liliencron, Detlev von: Greggert Meinstorff | 173–194 |
Eine der schönsten Sammlungen der deutschen Literatur ist der »Deutsche Novellenschatz«, den Paul Heyse in Gemeinschaft mit Hermann Kurz in den Jahren 1871 bis 1876 herausgab. Die Sammlung fand so großen Beifall, daß dem »Deutschen Novellenschatz«, obwohl er 24 Bände umfaßte, 1884 und 1885 der »Neue Deutsche Novellenschatz« mit 12 Bänden, herausgegeben von Paul Heyse und Ludwig Laistner, folgen konnte. Beide Sammlungen hatten den Zweck, aus der überreichen Fülle guter Novellen, die das deutsche Schrifttum aufwies, die besten herauszusuchen und in billigen Bänden einem größeren Leserkreise darzubieten.
Seit der Herausgabe der letzten Sammlung sind zwei Jahrzehnte verflossen, und die deutsche Literatur hat sich während dieser Zeit kraftvoll weiter[7] entwickelt. Kein Wunder daher, daß heute vielfach das Bedürfnis empfunden wird, sich in eine ähnliche Bändereihe zu vertiefen, die die besten Novellen der letzten zwanzig Jahre vereinigen müßte. Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung will versuchen, eine solche Sammlung herauszugeben, in der Hoffnung, dem von ihr erstrebten Ziel dadurch abermals näher zu kommen: unseren Dichtern durch Verbreitung ihrer Werke ein Denkmal im Herzen des deutschen Volkes zu setzen.
Strenge Beschränkung auf Erscheinungen der letzten zwanzig Jahre liegt übrigens nicht in ihrer Absicht. Auch Novellen aus früheren Jahren gedenkt sie in die Sammlung aufzunehmen, wenn sie dessen würdig erscheinen.
Hamburg-Großborstel,
1. Oktober 1904.
Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung.
Die Novelle »Das Amulet« von Conrad Ferdinand Meyer ist mit freundlicher Erlaubnis der Erben des Verfassers und der Verlagsbuchhandlung abgedruckt aus dem 1. Bande von Conrad Ferdinand Meyers »Novellen« (Leipzig: H. Haessel, 24. Auflage 1902).
Für die Abdruckserlaubnis von »Archambauld« schulden wir Herrn Ernst von Wildenbruch Dank.
Die Spielhagensche Novelle »Breite Schultern« ist mit gütiger Erlaubnis des Verfassers und der Verlagsbuchhandlung abgedruckt aus Friedrich Spielhagens »Sämtlichen Romanen« Bd. 17 (Quisisana, Erzählungen) (Leipzig: L. Staackmann, 1904).
»Greggert Meinstorff« von Detlev von Liliencron endlich ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Verlagsbuchhandlung abgedruckt aus Detlev von Liliencrons »Sämtlichen Werken« Band 2 (Aus Marsch und Geest) (Berlin-Leipzig: Schuster & Löffler, 2. Auflage 1904).
Conrad Ferdinand Meyer wurde am 11. Oktober 1825 in Zürich geboren und starb in Kilchberg bei Zürich am 28. November 1898.
In der französischen Schweiz, im Juragebiet hat er einen großen Teil seiner Jugend verlebt, hat er wohl die frischesten und stärksten Eindrücke seiner Jugendzeit empfangen und ist er mit französischer Sprache und Literatur besonders vertraut geworden. Auch hat er 1857 eine Reise nach Paris gemacht, und nachdem ihm das Studium der Rechte, das er in Zürich betrieb, wenig Freude gemacht, hat er viele Jahre hindurch auf eigene Hand Geschichte studiert. Auf diesen Wegen hat er wohl auch das Material und die Anregung zu seiner herrlichen Novelle »Das Amulet« gefunden.
Die Kunstgesetzgeber verlangen von dem eigentlichen Epiker oder Erzähler, daß er objektiv verfahre, d. h., daß er niemals seine eigenen Gedanken und Gefühle in die Erzählung mische, sondern nur die Erlebnisse, Meinungen, Empfindungen und Handlungen seiner Gestalten darstelle. Ob diese Forderung immer berechtigt ist, soll hier nicht untersucht werden; es soll nur gesagt werden, daß Meyer sie in höchstem Maße erfüllt – in so hohem Maße, daß man zuweilen glauben könnte, er fühle überhaupt nicht mit seinen Gestalten, sondern stehe ihnen und ihren Schicksalen kalt gegenüber. So hat man denn auch wohl bei gewissen Novellen und Gedichten Meyers von »Marmorkälte«[11] gesprochen. Vielleicht aber handelt es sich um ein Gefühl, das nur dem oberflächlichen Sinne nicht gleich bemerkbar wird, und aus vielen seiner Gedichte und Novellen, so auch aus dem »Amulet«, schlagen jedenfalls die Flammen des Mitgefühls hell und heiß genug heraus. Dazu aber zeigt der große Schweizer bei aller Kraft des Gefühls die männlich-ruhige Hand des Bildners; wenn man seine Novellen liest, sieht man unwillkürlich Bild um Bild – ja, oft wirkt eine ganze Novelle wie ein großes, einheitliches, in tiefen Farben leuchtendes Gemälde. Berühmt ist die Meyersche Kunst in der klaren und scharfen Charakteristik historischer Personen; so ist in der hier vorliegenden Novelle die kurze Schilderung Karls IX. während seines Besuches bei Coligny ein bewundernswertes Stück, und mit nicht geringerer Lebendigkeit treten der Herzog von Anjou, Katharina von Medici, Coligny, der berühmte Denker Michel Montaigne, der böhmische Fechtmeister, der liebenswürdig abergläubische Boccard und der Held der Novelle aus dem düstern Hintergrunde der Zeit hervor. Aber nicht nur im einzelnen waltet die Kunst des Dichters, auch die Gesamtstimmung: der Blutdunst und der meuchlerische Lärm der Bartholomäusnacht wie die unheilvolle Schwüle, die ihr voraufgeht, sind mit wunderbarer Sicherheit festgehalten. Der Leser, der die düster-prächtige Ballade Meyers »Die Füße im Feuer« kennt, wird bekannte Farben und Lichter wiederfinden.
O. E.

Das Amulet.
Heute am 14. März 1611 ritt ich von meinem Sitze am Bielersee hinüber nach Courtion zu dem alten Boccard, den Handel um eine mir gehörige mit Eichen und Buchen bestandene Halde in der Nähe von Münchweiler abzuschließen, der sich schon eine Weile hingezogen hatte. Der alte Herr bemühte sich in langwierigem Briefwechsel um eine Preiserniedrigung. Gegen den Wert des fraglichen Waldstreifens konnte kein ernstlicher Widerspruch erhoben werden, doch der Greis schien es für seine Pflicht zu halten, mir noch etwas abzumarkten. Da ich indessen guten Grund hatte, ihm alles Liebe zu erweisen, und überdies Geldes benötigt war, um meinem Sohn, der im Dienste der Generalstaaten steht und mit einer blonden runden Holländerin verlobt ist, die erste Einrichtung seines Hausstandes zu erleichtern, entschloß ich mich, ihm nachzugeben und den Handel rasch zu beendigen.
Ich fand ihn auf seinem altertümlichen Sitze einsam und in vernachlässigtem Zustande. Sein graues Haar hing ihm unordentlich in die Stirn und hinunter[13] auf den Nacken. Als er meine Bereitwilligkeit vernahm, blitzten seine erloschenen Augen auf bei der freudigen Nachricht. Rafft und sammelt er doch in seinen alten Tagen, uneingedenk daß sein Stamm mit ihm verdorren und er seine Habe lachenden Erben lassen wird.
Er führte mich in ein kleines Turmzimmer, wo er in einem wurmstichigen Schranke seine Schriften verwahrt, hieß mich Platz nehmen und bat mich, den Kontrakt schriftlich aufzusetzen. Ich hatte meine kurze Arbeit beendigt und wandte mich zu dem Alten um, der unterdessen in den Schubladen gekramt hatte, nach seinem Siegel suchend, das er verlegt zu haben schien. Wie ich ihn alles hastig durcheinanderwerfen sah, erhob ich mich unwillkürlich, als müßt' ich ihm helfen. Er hatte eben wie in fieberhafter Eile ein geheimes Schubfach geöffnet, als ich hinter ihn trat, einen Blick hineinwarf und – tief aufseufzte.
In dem Fache lagen neben einander zwei seltsame, beide mir nur zu wohl bekannte Gegenstände: ein durchlöcherter Filzhut, den einst eine Kugel durchbohrt hatte, und ein großes rundes Medaillon von Silber mit dem Bilde der Muttergottes von Einsiedeln in getriebener, ziemlich roher Arbeit.
Der Alte kehrte sich um, als wollte er meinen Seufzer beantworten, und sagte in weinerlichem Tone:
»Jawohl, Herr Schadau, mich hat die Dame von Einsiedeln noch behüten dürfen zu Haus und im Felde; aber seit die Ketzerei in die Welt gekommen ist und auch unsre Schweiz verwüstet hat, ist die Macht der guten Dame erloschen, selbst für die Rechtgläubigen! Das hat sich an Wilhelm gezeigt – meinem lieben Jungen.« Und eine Träne quoll unter seinen grauen Wimpern hervor.
Mir war bei diesem Auftritte weh ums Herz und ich richtete an den Alten ein paar tröstende Worte über den Verlust seines Sohnes, der mein Altersgenosse gewesen und an meiner Seite tödlich getroffen worden war. Doch meine Rede schien ihn zu verstimmen, oder er überhörte sie, denn er kam hastig wieder auf unser Geschäft zu reden, suchte von neuem nach dem Siegel, fand es endlich, bekräftigte die Urkunde und entließ mich dann bald ohne sonderliche Höflichkeit.
Ich ritt heim. Wie ich in der Dämmerung meines Weges trabte, stiegen mit den Düften der Frühlingserde die Bilder der Vergangenheit vor mir auf mit einer so drängenden Gewalt, in einer solchen Frische, in so scharfen und einschneidenden Zügen, daß sie mich peinigten.
Das Schicksal Wilhelm Boccards war mit dem meinigen aufs engste verflochten, zuerst auf eine freundliche, dann auf eine fast schreckliche Weise.[15] Ich habe ihn in den Tod gezogen. Und doch, so sehr mich dies drückt, kann ich es nicht bereuen und müßte wohl heute im gleichen Falle wieder so handeln, wie ich es mit zwanzig Jahren tat. Immerhin setzte mir die Erinnerung der alten Dinge so zu, daß ich mit mir einig wurde, den ganzen Verlauf dieser wundersamen Geschichte schriftlich niederzulegen und so mein Gemüt zu erleichtern.

Ich bin im Jahre 1553 geboren und habe meinen Vater nicht gekannt, der wenige Jahre später auf den Wällen von St. Quentin fiel. Ursprünglich ein thüringisches Geschlecht, hatten meine Vorfahren von jeher in Kriegsdienst gestanden und waren manchem Kriegsherrn gefolgt. Mein Vater hatte sich besonders dem Herzog Ulrich von Würtemberg verpflichtet, der ihm für treu geleistete Dienste ein Amt in seiner Grafschaft Mümpelgard anvertraute und eine Heirat mit einem Fräulein von Bern vermittelte, deren Ahn einst sein Gastfreund gewesen war, als Ulrich sich landesflüchtig in der Schweiz umtrieb. Es duldete meinen Vater jedoch nicht lange auf diesem ruhigen Posten, er nahm Dienst in Frankreich, das damals die Picardie gegen England und Spanien[16] verteidigen mußte. Dies war sein letzter Feldzug.
Meine Mutter folgte dem Vater nach kurzer Frist ins Grab, und ich wurde von einem mütterlichen Ohm aufgenommen, der seinen Sitz am Bielersee hatte und eine feine, eigentümliche Erscheinung war. Er mischte sich wenig in die öffentlichen Angelegenheiten, ja er verdankte es eigentlich nur seinem in die Jahrbücher von Bern glänzend eingetragenen Namen, daß er überhaupt auf Bernerboden geduldet wurde. Er gab sich nämlich von Jugend auf viel mit Bibelerklärung ab, in jener Zeit religiöser Erschütterung nichts Ungewöhnliches; aber er hatte, und das war das Ungewöhnliche, aus manchen Stellen des heiligen Buches, besonders aus der Offenbarung Johannis, die Überzeugung geschöpft, daß es mit der Welt zu Ende gehe und es deshalb nicht rätlich und ein eitles Werk sei, am Vorabend dieser durchgreifenden Krise eine neue Kirche zu gründen, weswegen er sich des ihm zuständigen Sitzes im Münster zu Bern beharrlich und grundsätzlich entschlug. Wie gesagt, nur seine Verborgenheit schützte ihn vor dem gestrengen Arm des geistlichen Regimentes.
Unter den Augen dieses harmlosen und liebenswürdigen Mannes wuchs ich – wo nicht ohne Zucht, doch ohne Rute – in ländlicher Freiheit auf. Mein[17] Umgang waren die Bauernjungen des benachbarten Dorfes und dessen Pfarrer, ein strenger Calvinist, durch den mich mein Ohm mit Selbstverleugnung in der Landesreligion unterrichten ließ.
Die zwei Pfleger meiner Jugend stimmten in manchen Punkten nicht zusammen. Während der Theologe mit seinem Meister Calvin die Ewigkeit der Höllenstrafen als das unentbehrliche Fundament der Gottesfurcht ansah, getröstete sich der Laie der einstigen Versöhnung und fröhlichen Wiederbringung aller Dinge. Meine Denkkraft übte sich mit Genuß an der herben Konsequenz der calvinischen Lehre und bemächtigte sich ihrer, ohne eine Masche des festen Netzes fallen zu lassen; aber mein Herz gehörte sonder Vorbehalt dem Oheim. Seine Zukunftsbilder beschäftigten mich wenig, nur einmal gelang es ihm, mich zu verblüffen. Ich nährte seit langem den Wunsch, einen wilden jungen Hengst, den ich in Biel gesehen, einen prächtigen Falben, zu besitzen, und näherte mich mit diesem großen Anliegen auf der Zunge eines Morgens meinem in ein Buch vertieften Oheim, eine Weigerung befürchtend, nicht wegen des hohen Preises, wohl aber der landeskundigen Wildheit des Tieres, das ich zu schulen wünschte. Kaum hatte ich den Mund geöffnet, als er mit seinen leuchtend blauen Augen mich scharf betrachtete und mich feierlich anredete: »Weißt du,[18] Hans, was das fahle Pferd bedeutet, auf dem der Tod sitzt?« –
Ich verstummte vor Erstaunen über die Sehergabe meines Oheims; aber ein Blick in das vor ihm aufgeschlagene Buch belehrte mich, daß er nicht von meinem Falben, sondern von einem der vier apokalyptischen Reiter sprach.
Der gelehrte Pfarrer unterwies mich zugleich in der Mathematik und sogar in den Anfängen der Kriegswissenschaft, soweit sie sich aus den bekannten Handbüchern schöpfen läßt; denn er war in seiner Jugend als Student in Genf mit auf die Wälle und ins Feld gezogen.
Es war eine ausgemachte Sache, daß ich mit meinem siebzehnten Jahre in Kriegsdienste zu treten habe; auch das war für mich keine Frage, unter welchem Feldherrn ich meine ersten Waffenjahre verbringen würde. Der Name des großen Coligny erfüllte damals die ganze Welt. Nicht seine Siege, deren hatte er keinen erfochten, sondern seine Niederlagen, welchen er durch Feldherrnkunst und Charaktergröße den Wert von Siegen zu geben wußte, hatten ihn aus allen lebenden Feldherrn hervorgehoben, wenn man ihm nicht den spanischen Alba an die Seite setzen wollte; diesen aber haßte ich wie die Hölle. Nicht nur war mein tapferer Vater treu und trotzig zum protestantischen Glauben[19] gestanden, nicht nur hatte mein bibelkundiger Ohm vom Papsttum einen übeln Begriff und meinte, es in der Babylonierin der Offenbarung vorgebildet zu sehen, sondern ich selbst fing an, mit warmem Herzen Partei zu nehmen. Hatte ich doch schon als Knabe mich in die protestantische Heerschar eingereiht, als es im Jahre 1567 galt, die Waffen zu ergreifen, um Genf gegen einen Handstreich Alba's zu sichern, der sich aus Italien längs der Schweizergrenze nach den Niederlanden durchwand. Den Jüngling litt es kaum mehr in der Einsamkeit von Chaumont, so hieß der Sitz meines Oheims.
Im Jahre 1570 gab das Pazifikationsedikt von St. Germain en Laye den Hugenotten in Frankreich Zutritt zu allen Ämtern, und Coligny, nach Paris gerufen, beriet mit dem König, dessen Herz er, wie die Rede ging, vollständig gewonnen hatte, den Plan eines Feldzugs gegen Alba zur Befreiung der Niederlande. Ungeduldig erwartete ich die jahrelang sich verzögernde Kriegserklärung, die mich zu Coligny's Scharen rufen sollte; denn seine Reiterei bestand von jeher aus Deutschen, und der Name meines Vaters mußte ihm aus frühern Zeiten bekannt sein.
Aber diese Kriegserklärung wollte noch immer nicht kommen, und zwei ärgerliche Erlebnisse sollten mir die letzten Tage in der Heimat verbittern.
Als ich eines Abends im Mai mit meinem Ohm unter der blühenden Hoflinde das Vesperbrod verzehrte, erschien vor uns in ziemlich kriechender Haltung und schäbiger Kleidung ein Fremder, dessen unruhige Augen und gemeine Züge auf mich einen unangenehmen Eindruck machten. Er empfahl sich der gnädigen Herrschaft als Stallmeister, was in unsern Verhältnissen nichts andres als Reitknecht bedeutete, und schon war ich im Begriff, ihn kurz abzuweisen, denn mein Ohm hatte ihm bis jetzt keine Aufmerksamkeit geschenkt, als der Fremdling mir alle seine Kenntnisse und Fertigkeiten herzuzählen begann.
»Ich führe die Stoßklinge,« sagte er, »wie Wenige, und kenne die hohe Fechtschule aus dem Fundament.«
Bei meiner Entfernung von jedem städtischen Fechtboden empfand ich gerade diese Lücke meiner Ausbildung schmerzlich und trotz meiner instinktiven Abneigung gegen den Ankömmling ergriff ich die Gelegenheit ohne Bedenken, zog den Fremden in meine Fechtkammer und gab ihm eine Klinge in die Hand, mit welcher er die meinige so vortrefflich meisterte, daß ich sogleich mit ihm abmachte und ihn in unsre Dienste nahm.
Dem Ohm stellte ich vor, wie günstig die Gelegenheit sei, noch im letzten Augenblick vor der Abreise den Schatz meiner ritterlichen Kenntnisse zu bereichern.
Von nun an brachte ich mit dem Fremden – er bekannte sich zu böhmischer Abkunft – Abend um Abend oft bis zu später Stunde in der Waffenkammer zu, die ich mit zwei Mauerlampen möglichst erleuchtete. Leicht erlernte ich Stoß, Parade, Finte, und bald führte ich, theoretisch vollkommen fest, die ganze Schule richtig und zur Befriedigung meines Lehrers durch; dennoch brachte ich diesen in helle Verzweiflung dadurch, daß es mir unmöglich war, eine gewisse angeborene Gelassenheit los zu werden, welche er Langsamkeit schalt und mit seiner blitzschnell zuckenden Klinge spielend besiegte.
Um mir das mangelnde Feuer zu geben, verfiel er auf ein seltsames Mittel. Er nähte sich auf sein Fechtwams ein Herz von rotem Leder, das die Stelle des pochenden anzeigte, und auf welches er im Fechten mit der Linken höhnisch und herausfordernd hinwies. Dazu stieß er mannigfache Kriegsrufe aus, am häufigsten: »Alba hoch! – Tod den niederländischen Rebellen!« – oder auch: »Tod dem Ketzer Coligny! An den Galgen mit ihm!« –
Obwohl mich diese Rufe im Innersten empörten und mir den Menschen noch widerlicher machten, als er mir ohnehin war, gelang es mir nicht, mein Tempo zu beschleunigen, da ich schon als pflichtschuldig Lernender ein Maß von Behendigkeit aufgewendet hatte, das sich nun einmal nicht überschreiten[22] ließ. Eines Abends, als der Böhme gerade ein fürchterliches Geschrei anhob, trat mein Oheim besorgt durch die Seitentüre ein, zu sehen, was es gäbe, zog sich aber entsetzt zurück, da er meinen Gegner mit dem Ausruf: »Tod den Hugenotten« mir einen derben Stoß mitten auf die Brust versetzen sah, der mich, galt es Ernst, durchbohrt hätte.
Am nächsten Morgen, als wir unter unsrer Linde frühstückten, hatte der Ohm etwas auf dem Herzen, und ich denke, es war der Wunsch, sich des unheimlichen Hausgenossen zu entledigen, als von dem Bieler Stadtboten ein Schreiben mit einem großen Amtssiegel überbracht wurde. Der Ohm öffnete es, runzelte im Lesen die Stirn und reichte es mir mit den Worten: »Da haben wir die Bescherung! – Lies, Hans, und dann wollen wir beraten, was zu tun sei.«
Da stand nun zu lesen, daß ein Böhme, der sich vor einiger Zeit in Stuttgart als Fechtmeister niedergelassen, sein Weib, eine geborene Schwäbin, aus Eifersucht meuchlerisch erstochen; daß man in Erfahrung gebracht, der Täter habe sich nach der Schweiz geschlagen, ja, daß man ihn, oder jemand, der ihm zum Verwechseln gleiche, im Dienste des Herrn zu Chaumont wolle gesehen haben; daß man diesen, dem in Erinnerung des seligen Schadau, seines Schwagers, der Herzog Christoph sonderlich gewogen[23] sei, dringend ersuche, den Verdächtigen zu verhaften, selbst ein erstes Verhör vorzunehmen und bei bestätigtem Verdachte den Schuldigen an die Grenze liefern zu lassen. Unterzeichnet und besiegelt war das Schreiben von dem herzoglichen Amte in Stuttgart.
Während ich das Aktenstück las, blickte ich nachdenkend einmal darüber hinweg nach der Kammer des Böhmen, die sich, im Giebel des Schlosses gelegen, mit dem Auge leicht erreichen ließ, und sah ihn am Fenster beschäftigt, eine Klinge zu putzen. Entschlossen, den Übeltäter festzunehmen und der Gerechtigkeit zu überliefern, erhob ich doch unwillkürlich das Schreiben in der Weise, daß ihm das große, rote Siegel, wenn er gerade herunter lauerte, sichtbar wurde – seinem Schicksal eine kleine Frist gebend, ihn zu retten.
Dann erwog ich mit meinem Ohm die Festnehmung und den Transport des Schuldigen; denn daß er dieses war, daran zweifelten wir beide keinen Augenblick.
Hierauf stiegen wir, jeder ein Pistol in der Hand, auf die Kammer des Böhmen. Sie war leer; aber durch das offene Fenster über die Bäume des Hofes weg – weit in der Ferne, wo sich der Weg um den Hügel wendet, sahn wir einen Reiter gallopieren, und jetzt beim Hinuntersteigen trat uns der[24] Bote von Biel, der das Schreiben überbracht hatte, jammernd entgegen, er suche vergeblich sein Roß, welches er am hintern Hoftor angebunden, während ihm selbst in der Küche ein Trunk gereicht wurde.
Zu dieser leidigen Geschichte, die im Land viel Aufsehn erregte und im Mund der Leute eine abenteuerliche Gestalt gewann, kam noch ein anderer Unfall, der machte, daß meines Bleibens daheim nicht länger sein konnte.
Ich ward auf eine Hochzeit nach Biel geladen, wo ich, da das Städtchen kaum eine Stunde entfernt liegt, manche, wenn auch nur flüchtige Beziehungen hatte. Bei meiner ziemlich abgeschlossenen Lebensweise galt ich für stolz, und mit meinen Gedanken in der nahen Zukunft, die mich, wenn auch in bescheidenster Stellung, in die großen Geschicke der protestantischen Welt verflechten sollte, konnte ich den innern Händeln und dem Stadtklatsch der kleinen Republik Biel kein Interesse abgewinnen. So lächelte mir diese Einladung nicht besonders, und nur das Drängen meines ebenso zurückgezogenen, doch dabei leutseligen Oheims bewog mich, der Einladung Folge zu leisten.
Den Frauen gegenüber war ich schüchtern. Von kräftigem Körperbau und ungewöhnlicher Höhe des Wuchses, aber unschönen Gesichtszügen, fühlte ich[25] wohl, wenn ich mir davon auch nicht Rechenschaft gab, daß ich die ganze Summe meines Herzens auf eine Nummer zu setzen habe, und die Gelegenheit dazu, so schwebte mir dunkel vor, mußte sich in der Umgebung meines Helden finden. Auch stand bei mir fest, daß ein volles Glück mit vollem Einsatz, mit dem Einsatze des Lebens wolle gewonnen sein.
Unter meinen jugendlichen Bewunderungen nahm neben dem großen Admiral sein jüngerer Bruder Dandelot die erste Stelle ein, dessen weltkundige, stolze Brautfahrt meine Einbildungskraft entzündete. Seine Flamme, ein lothringisches Fräulein, hatte er vor den Augen seiner katholischen Todfeinde, der Guisen, aus ihrer Stadt Nancy weggeführt, in festlichem Zuge unter Drommetenschall dem herzoglichen Schlosse vorüberreitend.
Etwas derartiges wünschte ich mir vorbestimmt.
Ich machte mich also nüchternen und verdrossenen Herzens nach Biel auf den Weg. Man war höchst zuvorkommend gegen mich und gab mir meinen Platz an der Tafel neben einem liebenswürdigen Mädchen. Wie es schüchternen Menschen zu gehen pflegt, geriet ich, um jedem Verstummen vorzubeugen, in das entgegengesetzte Fahrwasser, und um nicht unhöflich zu erscheinen, machte ich meiner Nachbarin lebhaft den Hof. Uns gegenüber saß der Sohn des Schultheißen, eines vornehmen Spezereihändlers,[26] der an der Spitze der aristokratischen Partei stand; denn das kleine Biel hatte gleich größeren Republiken seine Aristokraten und Demokraten. Franz Godillard, so hieß der junge Mann, der vielleicht Absichten auf meine Nachbarin haben mochte, verfolgte unser Gespräch, ohne daß ich anfänglich dessen gewahr wurde, mit steigendem Interesse und feindseligen Blicken.
Da fragte mich das hübsche Mädchen, wann ich nach Frankreich zu gehen gedächte.
– »Sobald der Krieg erklärt ist gegen den Bluthund Alba!« erwiderte ich eifrig.
– »Man dürfte von einem solchen Manne in weniger respektwidrigen Ausdrücken reden!« warf mir Godillard über den Tisch zu.
– »Ihr vergeßt wohl«, entgegnete ich, »die mißhandelten Niederländer! Keinen Respekt ihrem Unterdrücker, und wäre er der größte Feldherr der Welt!«
– »Er hat Rebellen gezüchtigt«, war die Antwort, »und ein heilsames Beispiel auch für unsre Schweiz gegeben.«
– »Rebellen!« schrie ich und stürzte ein Glas feurigen Cortaillod hinunter. »So gut, oder so wenig Rebellen, als die Eidgenossen auf dem Rütli!« –
Godillard nahm eine hochmütige Miene an, zog[27] die Augenbrauen erst mit Wichtigkeit in die Höhe und versetzte dann grinsend: »Untersucht einmal ein gründlicher Gelehrter die Sache, wird es sich vielleicht weisen, daß die aufrührerischen Bauern der Waldstätte gegen Österreich schwer im Unrecht und offener Rebellion schuldig waren. Übrigens gehört das nicht hieher; ich behaupte nur, daß es einem jungen Menschen ohne Verdienst, ganz abgesehen von jeder politischen Meinung, übel ansteht, einen berühmten Kriegsmann mit Worten zu beschimpfen.«
Dieser Hinweis auf die unverschuldete Verzögerung meines Kriegsdienstes empörte mich aufs Tiefste, die Galle lief mir über und: »Ein Schurke!« rief ich aus, »wer den Schurken Alba in Schutz nimmt!«
Jetzt entstand ein sinnloses Getümmel, aus welchem Godillard mit zerschlagenem Kopfe weggetragen wurde und ich mich mit blutender, vom Wurf eines Glases zerschnittener Wange zurückzog.
Am Morgen erwachte ich in großer Beschämung, voraussehend, daß ich, ein Verteidiger der evangelischen Wahrheit, in den Ruf eines Trunkenboldes geraten würde.
Ohne langes Besinnen packte ich meinen Mantelsack, beurlaubte mich bei dem Oheim, dem ich mein Mißgeschick andeutete und der nach einigem Hin- und Herreden sich damit einverstanden erklärte, daß[28] ich den Ausbruch des Krieges in Paris erwarten möge, steckte eine Rolle Gold aus dem kleinen Erbe meines Vaters zu mir, bewaffnete mich, sattelte meinen Falben und machte mich auf den Weg nach Frankreich.

Ich durchzog ohne nennenswerte Abenteuer die Freigrafschaft und Burgund, erreichte den Lauf der Seine und näherte mich eines Abends den Türmen von Melun, die noch eine kleine Stunde entfernt liegen mochten, über denen aber ein schweres Gewitter hing. Ein Dorf durchreitend, das an der Straße lag, erblickte ich auf der steinernen Hausbank der nicht unansehnlichen Herberge zu den drei Lilien einen jungen Mann, welcher wie ich ein Reisender und ein Kriegsmann zu sein schien, dessen Kleidung und Bewaffnung aber eine Eleganz zeigte, von welcher meine schlichte kalvinistische Tracht gewaltig abstach. Da es in meinem Reiseplan lag, vor Nacht Melun zu erreichen, erwiderte ich seinen Gruß nur flüchtig, ritt vorüber und glaubte noch den Ruf: »Gute Reise, Landsmann!« hinter mir zu vernehmen.
Eine Viertelstunde trabte ich beharrlich weiter, während das Gewitter mir schwarz entgegenzog,[29] die Luft unerträglich dumpf wurde und kurze, heiße Windstöße den Staub der Straße in Wirbeln aufjagten. Mein Roß schnaubte. Plötzlich fuhr ein blendender und krachender Blitzstrahl wenige Schritte vor mir in die Erde. Der Falbe stieg, drehte sich und jagte in wilden Sprüngen gegen das Dorf zurück, wo es mir endlich unter strömendem Regen vor dem Tore der Herberge gelang, des geängsteten Tieres Herr zu werden.
Der junge Gast erhob sich lächelnd von der durch das Vordach geschützten Steinbank, rief den Stallknecht, war mir beim Abschnallen des Mantelsacks behilflich und sagte: »Laßt es Euch nicht reuen, hier zu nächtigen, Ihr findet vortreffliche Gesellschaft.«
»Daran zweifle ich nicht!« versetzte ich grüßend.
»Ich spreche natürlich nicht von mir,« fuhr er fort, »sondern von einem alten, ehrwürdigen Herrn, den die Wirtin Herr Parlamentrat nennt – also ein hoher Würdenträger – und von seiner Tochter oder Nichte, einem ganz unvergleichlichen Fräulein … Öffnet dem Herrn ein Zimmer!« Dies sprach er zu dem herantretenden Wirt, »und Ihr, Herr Landsmann, kleidet Euch rasch um und laßt uns nicht warten, denn der Abendtisch ist gedeckt.«
»Ihr nennt mich Landsmann?« entgegnete ich[30] französisch, wie er mich angeredet hatte. »Woran erkennt Ihr mich als solchen?«
»An Haupt und Gliedern!« versetzte er lustig. »Vorerst seid Ihr ein Deutscher, und an Eurem ganzen festen und gesetzten Wesen erkenne ich den Berner. Ich aber bin Euer treuer Verbündeter von Fryburg und nenne mich Wilhelm Boccard.« –
Ich folgte dem voranschreitenden Wirte in die Kammer, die er mir anwies, wechselte die Kleider und stieg hinunter in die Gaststube, wo ich erwartet war. Boccard trat auf mich zu, ergriff mich bei der Hand und stellte mich einem ergrauten Herrn von feiner Erscheinung und einem schlanken Mädchen im Reitkleide vor mit den Worten: »Mein Kamerad und Landsmann …« dabei sah er mich fragend an.
»Schadau von Bern,« schloß ich die Rede.
»Es ist mir höchst angenehm,« erwiderte der alte Herr verbindlich, »mit einem jungen Bürger der berühmten Stadt zusammenzutreffen, der meine Glaubensbrüder in Genf so viel zu danken haben. Ich bin der Parlamentrat Chatillon, dem der Religionsfriede erlaubt, nach seiner Vaterstadt Paris zurückzukehren.«
»Chatillon?« wiederholte ich in ehrfurchtsvoller Verwunderung. »Das ist der Familienname des großen Admirals.«
»Ich habe nicht die Ehre, mit ihm verwandt zu sein,« versetzte der Parlamentsrat, »oder wenigstens nur ganz von fern; aber ich kenne ihn und bin ihm befreundet, so weit es der Unterschied des Standes und des persönlichen Wertes gestattet. Doch setzen wir uns, meine Herrschaften. Die Suppe dampft, und der Abend bietet noch Raum genug zum Gespräch.« –
Ein Eichentisch mit gewundenen Füßen vereinigte uns an seinen vier Seiten. Oben war dem Fräulein, zu ihrer Rechten und Linken dem Rat und Boccard und mir am untern Ende der Tafel das Gedeck gelegt. Nachdem unter den üblichen Erkundigungen und Reisegesprächen das Mahl beendigt und zu einem bescheidenen Nachtisch das perlende Getränk der benachbarten Champagne aufgetragen war, fing die Rede an, zusammenhängender zu fließen.
»Ich muß es an Euch loben, Ihr Herren Schweizer,« begann der Rat, »daß Ihr nach kurzen Kämpfen gelernt habt, Euch auf kirchlichem Gebiete friedlich zu vertragen. Das ist ein Zeichen von billigem Sinn und gesundem Gemüt, und mein unglückliches Vaterland könnte sich an Euch ein Beispiel nehmen. – Werden wir denn nie lernen, daß sich die Gewissen nicht meistern lassen, und daß ein Protestant sein Vaterland so glühend lieben, so[32] mutig verteidigen und seinen Gesetzen so gehorsam sein kann, als ein Katholik!«
»Ihr spendet uns zu reichliches Lob!« warf Boccard ein. »Freilich vertragen wir Katholiken und Protestanten uns im Staate leidlich; aber die Geselligkeit ist durch die Glaubensspaltung völlig verdorben. In früherer Zeit waren wir von Fryburg mit denen von Bern vielfach verschwägert. Das hat nun aufgehört, und langjährige Bande sind zerschnitten. Auf der Reise,« fuhr er scherzend zu mir gewendet fort, »sind wir uns noch zuweilen behilflich; aber zu Hause grüßen wir uns kaum.«
»Laßt mich Euch erzählen: Als ich auf Urlaub in Fryburg war, – ich diene unter den Schweizern seiner allerchristlichsten Majestät – wurde gerade die Milchmesse auf den Plaffeyer Alpen gefeiert, wo mein Vater begütert ist und auch die Kirchberge von Bern ein Weidrecht besitzen. Das war ein trübseliges Fest. Der Kirchberg hatte seine Töchter, vier stattliche Bernerinnen, mitgebracht, die ich, als wir Kinder waren, auf der Alp alljährlich im Tanze schwenkte. Könnt Ihr glauben, daß nach beendigtem Ehrentanze die Mädchen mitten unter den läutenden Kühen ein theologisches Gespräch begannen und mich, der ich mich nie viel um diese Dinge bekümmert habe, einen Götzendiener und Christenverfolger schalten, weil ich auf den Schlachtfeldern von[33] Jarnac und Moncontour gegen die Hugenotten meine Pflicht getan?«
»Religionsgespräche,« begütigte der Rat, »liegen jetzt eben in der Luft; aber warum sollte man sie nicht mit gegenseitiger Achtung führen und in versöhnlichem Geiste sich verständigen können? So bin ich versichert, Herr Boccard, daß Ihr mich wegen meines evangelischen Glaubens nicht zum Scheiterhaufen verdammt, und daß Ihr nicht der Letzte seid, die Grausamkeit zu verwerfen, mit der die Kalvinisten in meinem armen Vaterlande lange Zeit behandelt worden sind.«
»Seid davon überzeugt!« erwiderte Boccard. »Nur dürft Ihr nicht vergessen, daß man das Alte und Hergebrachte in Staat und Kirche nicht grausam nennen darf, wenn es sein Dasein mit allen Mitteln verteidigt. Was übrigens die Grausamkeiten betrifft, so weiß ich keine grausamere Religion als den Kalvinismus.«
»Ihr denkt an Servet?« – sagte der Rat mit leiser Stimme, während sich sein Antlitz trübte.
»Ich dachte nicht an menschliche Strafgerichte,« versetzte Boccard, »sondern an die göttliche Gerechtigkeit, wie sie der finstere neue Glaube verunstaltet. Wie gesagt, ich verstehe nichts von der Theologie, aber mein Ohm, der Chorherr in Fryburg, ein glaubwürdiger und gelehrter Mann, hat[34] mich versichert, es sei ein kalvinistischer Satz, daß, eh' es Gutes oder Böses getan hat, das Kind schon in der Wiege zur ewigen Seligkeit bestimmt, oder der Hölle verfallen sei. Das ist zu schrecklich, um wahr zu sein!«
»Und doch ist es wahr,« sagte ich, des Unterrichts meines Pfarrers mich erinnernd, »schrecklich oder nicht, es ist logisch!«
»Logisch?« fragte Boccard. »Was ist logisch?«
»Was sich nicht selbst widerspricht,« ließ sich der Rat vernehmen, den mein Eifer zu belustigen schien.
»Die Gottheit ist allwissend und allmächtig,« fuhr ich mit Siegesgewißheit fort, »was sie voraussieht und nicht hindert, ist ihr Wille, demnach ist allerdings unser Schicksal schon in der Wiege entschieden.«
»Ich würde Euch das gern umstoßen,« sagte Boccard, »wenn ich mich jetzt nur auf das Argument meines Oheims besinnen könnte! Denn er hatte ein treffliches Argument dagegen …«
»Ihr tätet mir einen Gefallen,« meinte der Rat, »wenn es Euch gelänge, Euch dieses trefflichen Arguments zu erinnern.« –
Der Fryburger schenkte sich den Becher voll, leerte ihn langsam und schloß die Augen. Nach einigem Besinnen sagte er heiter: »Wenn die Herrschaften geruhn, mir nichts einzuwerfen und mich meine Gedanken ungestört entwickeln zu lassen, so hoff' ich,[35] nicht übel zu bestehn. Angenommen also, Herr Schadau, Ihr wäret von Eurer kalvinistischen Vorsehung seit der Wiege zur Hölle verdammt – doch bewahre mich Gott vor solcher Unhöflichkeit – gesetzt denn, ich wäre im Voraus verdammt; aber ich bin ja, Gott sei Dank, kein Kalvinist …« Hierauf nahm er einige Krumen des vortrefflichen Weizenbrotes, formte sie mit den Fingern zu einem Männchen, das er auf seinen Teller setzte mit den Worten: »Hier steht ein von Geburt an zur Hölle verdammter Kalvinist. Nun gebt Acht, Schadau! – Glaubt Ihr an die zehn Gebote?«
»Wie, Herr?« fuhr ich auf.
»Nun, nun, man darf doch fragen. Ihr Protestanten habt so manches Alte abgeschafft! Also Gott befiehlt diesem Kalvinisten: Tue das! Unterlasse jenes! Ist solches Gebot nun nicht eitel böses Blendwerk, wenn der Mann zum Voraus bestimmt ist, das Gute nicht tun zu können und das Böse tun zu müssen? Und einen solchen Unsinn mutet Ihr der höchsten Weisheit zu? Nichtig ist das, wie dies Gebilde meiner Finger!« und er schnellte das Brotmännchen in die Höhe.
»Nicht übel!« meinte der Rat.
Während Boccard seine innere Genugtuung zu verbergen suchte, musterte ich eilig meine Gegengründe; aber ich wußte in diesem Augenblicke nichts[36] Triftiges zu antworten und sagte mit einem Anfluge unmutiger Beschämung: »Das ist ein dunkler, schwerer Satz, der sich nicht leichthin erörtern läßt. Übrigens ist seine Behauptung nicht unentbehrlich, um den Papismus zu verwerfen, dessen augenfällige Mißbräuche Ihr selbst, Boccard, nicht leugnen könnt. Denkt an die Unsitten der Pfaffen!«
»Es gibt schlimme Vögel unter ihnen,« nickte Boccard.
»Der blinde Autoritätsglaube …«
»Ist eine Wohltat für menschliche Schwachheit,« unterbrach er mich, »muß es doch in Staat und Kirche wie in dem kleinsten Rechtshandel eine letzte Instanz geben, bei der man sich beruhigen kann!«
»Die wundertätigen Reliquien!«
»Heilten der Schatten St. Petri und die Schweißtüchlein St. Pauli Kranke,« versetzte Boccard mit großer Gelassenheit, »warum sollten nicht auch die Gebeine der Heiligen Wunder wirken?«
»Dieser alberne Mariendienst …«
Kaum war das Wort ausgesprochen, so veränderte sich das helle Angesicht des Fryburgers, das Blut stieg ihm mit Gewalt zu Haupte, zornrot sprang er vom Sessel auf, legte die Hand an den Degen und rief mir zu: »Wollt Ihr mich persönlich beleidigen? Ist das Eure Absicht, so zieht!«
Auch das Fräulein hatte sich bestürzt von seinem[37] Sitze erhoben, und der Rat streckte beschwichtigend beide Hände nach dem Fryburger aus. Ich erstaunte, ohne die Fassung zu verlieren, über die ganz unerwartete Wirkung meiner Worte.
»Von einer persönlichen Beleidigung kann nicht die Rede sein,« sagte ich ruhig. »Wie konnte ich ahnen, daß Ihr, Boccard, der in jeder Äußerung den Mann von Welt und Bildung bekundet und der, wie Ihr selbst sagt, gelassen über religiöse Dinge denkt, in diesem einzigen Punkte eine solche Leidenschaft an den Tag legen würdet.«
»So wisset Ihr denn nicht, Schadau, was im ganzen Gebiete von Fryburg und weit darüber hinaus bekannt ist, daß Unsere liebe Frau von Einsiedeln ein Wunder an mir Unwürdigem getan hat?«
»Nein, wahrlich nicht,« erwiderte ich. »Setzt Euch, lieber Boccard, und erzählt uns das.«
»Nun, die Sache ist weltkundig und abgemalt auf einer Votivtafel im Kloster selbst.
In meinem dritten Jahre befiel mich eine schwere Krankheit, und ich blieb in Folge derselben an allen Gliedern gelähmt. Alle erdenklichen Mittel wurden vergeblich angewendet, kein Arzt wußte Rat. Endlich tat meine liebe, gute Mutter barfuß für mich eine Wallfahrt nach Einsiedeln. Und, siehe da, es geschah ein Gnadenwunder! Von Stund an ging[38] es besser mit mir, ich erstarkte und gedieh und bin heute, wie Ihr seht, ein Mann von gesunden und geraden Gliedern! Nur der guten Dame von Einsiedeln danke ich es, wenn ich heute meiner Jugend froh bin und nicht als ein unnützer, freudeloser Krüppel mein Herz in Gram verzehre. So werdet Ihr es begreifen, liebe Herrn, und natürlich finden, daß ich meiner Helferin zeitlebens zu Dank verbunden und herzlich zugetan bleibe.«
Mit diesen Worten zog er eine seidene Schnur, die er um den Hals trug und an der ein Medaillon hing, aus dem Wams hervor und küßte es mit Inbrunst.
Herr Chatillon, der ihn mit einem seltsamen Gemisch von Spott und Rührung betrachtete, begann nun in seiner verbindlichen Weise: »Aber glaubt Ihr wohl, Herr Boccard, daß jede Madonna diese glückliche Kur an Euch hätte verrichten können?«
»Nicht doch!« versetzte Boccard lebhaft, »die Meinigen versuchten es an manchem Gnadenorte, bis sie an die rechte Pforte klopften. Die liebe Frau von Einsiedeln ist eben einzig in ihrer Art.«
»Nun,« fuhr der alte Franzose lächelnd fort, »so wird es leicht sein, Euch mit Euerm Landsmanne zu versöhnen, wenn dies bei Euerm wohlwollenden Gemüt und heitern Naturell, wovon Ihr uns allen schon Proben gegeben habt, noch notwendig sein[39] sollte. Herr Schadau wird seinem harten Urteile über den Mariendienst in Zukunft nicht vergessen die Klausel anzuhängen: mit ehrenvoller Ausnahme der lieben Frau von Einsiedeln.«
»Dazu bin ich gerne bereit,« sagte ich, auf den Ton des alten Herrn eingehend, freilich nicht ohne eine innere Wallung gegen seinen Leichtsinn.
Da ergriff der gutmütige Boccard meine Hand und schüttelte sie treuherzig. Das Gespräch nahm eine andere Wendung, und bald erhob sich der junge Fryburger, gute Nacht wünschend und sich beurlaubend, da er morgen in der ersten Frühe aufzubrechen gedenke.
Nun erst, da das erregte Hin- und Herreden ein Ende genommen hatte, richtete ich meine Blicke aufmerksamer auf das junge Mädchen, das unserm Gespräch stillschweigend mit großer Spannung gefolgt war, und erstaunte über ihre Unähnlichkeit mit ihrem Vater oder Oheim. Der alte Rat hatte ein fein geschnittenes, fast furchtsames Gesicht, welches kluge, dunkle Augen bald wehmütig, bald spöttisch, immer geistvoll beleuchteten; die junge Dame dagegen war blond, und ihr unschuldiges, aber entschlossenes Antlitz beseelten wunderbar strahlende blaue Augen.
»Darf ich Euch fragen, junger Mann,« begann der Parlamentrat, »was Euch nach Paris führt?[40] Wir sind Glaubensgenossen, und wenn ich Euch einen Dienst leisten kann, so verfügt über mich.«
»Herr,« erwiderte ich, »als Ihr den Namen Chatillon ausspracht, geriet mein Herz in Bewegung. Ich bin ein Soldatenkind und will den Krieg, mein väterliches Handwerk, erlernen. Ich bin ein eifriger Protestant und möchte für die gute Sache so viel tun, als in meinen Kräften steht. Diese beiden Ziele habe ich erreicht, wenn mir vergönnt ist, unter den Augen des Admirals zu dienen und zu fechten. Könnt Ihr mir dazu helfen, so erweist Ihr mir den größten Dienst.«
Jetzt öffnete das Mädchen den Mund und fragte: »Habt Ihr denn eine so große Verehrung für den Herrn Admiral?«
»Er ist der erste Mann der Welt!« antwortete ich feurig.
»Nun, Gasparde,« fiel der Alte ein, »bei so vortrefflichen Gesinnungen dürftest du für den jungen Herrn ein Fürwort bei deinem Paten einlegen.«
»Warum nicht?« sagte Gasparde ruhig, »wenn er so brav ist, wie er das Aussehen hat. Ob aber mein Fürwort fruchten wird, das ist die Frage. Der Herr Admiral ist jetzt, am Vorabend des flandrischen Krieges, vom Morgen bis in die Nacht in Anspruch genommen, belagert, ruhelos, und ich weiß nicht, ob nicht schon alle Stellen vergeben sind, über[41] die er zu verfügen hat. Bringt Ihr nicht eine Empfehlung mit, die besser wäre als die meinige?«
»Der Name meines Vaters,« versetzte ich etwas eingeschüchtert, »ist vielleicht dem Admiral nicht unbekannt.« – Jetzt fiel mir aufs Herz, wie schwer es dem unempfohlenen Fremdling werden könnte, bei dem großen Feldherrn Zutritt zu erlangen, und ich fuhr niedergeschlagen fort: »Ihr habt Recht, Fräulein, ich fühle, daß ich ihm wenig bringe: ein Herz und einen Degen, wie er über deren tausende gebietet. Lebte nur sein Bruder Dandelot noch! Der stünde mir näher, an den würde ich mich wagen! War er doch von Jugend auf in allen Dingen mein Vorbild: kein Feldherr, aber ein tapferer Krieger; kein Staatsmann, aber ein standhafter Parteigenosse; kein Heiliger, aber ein warmes, treues Herz!« –
Während ich diese Worte sprach, begann Fräulein Gasparde zu meinem Erstaunen, erst leise zu erröten, und ihre mir rätselhafte Verlegenheit steigerte sich, bis sie mit Rot wie übergossen war. Auch der alte Herr wurde sonderbarer Weise verstimmt und sagte spitz:
»Was werdet Ihr wissen, ob Herr Dandelot ein Heiliger war oder nicht! Doch ich bin schläfrig, heben wir die Sitzung auf. Kommt Ihr nach Paris, Herr Schadau, so beehrt mich mit Euerm Besuche. Ich wohne auf der Insel St. Louis. Morgen werden[42] wir uns wohl nicht mehr sehen. Wir halten Rasttag und bleiben in Melun. Jetzt aber schreibt mir noch Euern Namen in diese Brieftasche. So! Gehabt Euch wohl, gute Nacht.« –

Am zweiten Abende nach diesem Zusammentreffen ritt ich durch das Tor St. Honoré in Paris ein und klopfte müde, wie ich war, an die Pforte der nächsten, kaum hundert Schritte vom Tor entfernten Herberge.
Die erste Woche verging mir in der Betrachtung der mächtigen Stadt und im vergeblichen Aufsuchen eines Waffengenossen meines Vaters, dessen Tod ich erst nach mancher Anfrage in Erfahrung brachte. Am achten Tage machte ich mich mit pochendem Herzen auf den Weg nach der Wohnung des Admirals, die mir unfern vom Louvre in einer engen Straße gewiesen wurde.
Es war ein finsteres, altertümliches Gebäude, und der Pförtner empfing mich unfreundlich, ja mißtrauisch. Ich mußte meinen Namen auf ein Stück Papier schreiben, das er zu seinem Herrn trug, dann wurde ich eingelassen und trat durch ein großes Vorgemach, das mit vielen Menschen gefüllt war,[43] Kriegern und Hofleuten, die den durch ihre Reihen Gehenden mit scharfen Blicken musterten, in das kleine Arbeitszimmer des Admirals. Er war mit Schreiben beschäftigt und winkte mir zu warten, während er einen Brief beendigte. Ich hatte Muße, sein Antlitz, das mir durch einen gelungenen, ausdrucksvollen Holzschnitt, der bis in die Schweiz gelangt war, sich unauslöschlich eingeprägt hatte, mit Rührung zu betrachten.
Der Admiral mochte damals fünfzig Jahre zählen, aber seine Haare waren schneeweiß, und eine fieberische Röte durchglühte die abgezehrten Wangen. Auf seiner mächtigen Stirn, auf den magern Händen traten die blauen Adern hervor, und ein furchtbarer Ernst sprach aus seiner Miene. Er schaute wie ein Richter in Israel.
Nachdem er sein Geschäft beendigt hatte, trat er zu mir in die Fensternische und heftete seine großen blauen Augen durchdringend auf die meinigen.
»Ich weiß, was Euch herführt,« sagte er, »Ihr wollt der guten Sache dienen. Bricht der Krieg aus, so gebe ich Euch eine Stelle in meiner deutschen Reiterei. Inzwischen – seid Ihr der Feder mächtig? Ihr versteht Deutsch und Französisch?« –
Ich verneigte mich bejahend.
»Inzwischen will ich Euch in meinem Kabinet beschäftigen. Ihr könnt mir nützlich sein. So seid[44] mir denn willkommen. Ich erwarte Euch morgen um die achte Stunde. Seid pünktlich.« –
Nun entließ er mich mit einer Handbewegung, und wie ich mich vor ihm vorbeugte, fügte er mit großer Freundlichkeit bei:
»Vergeßt nicht, den Rat Chatillon zu besuchen, mit dem Ihr unterwegs bekannt geworden seid.«
Als ich wieder auf der Straße war und, dem Erlebten nachsinnend, den Weg nach meiner Herberge einschlug, wurde mir klar, daß ich für den Admiral kein Unbekannter mehr war, und ich konnte nicht im Zweifel sein, wem ich es zu verdanken hatte. Die Freude, an ein ersehntes Ziel, das mir schwer zu erreichen schien, so leicht gelangt zu sein, war mir von guter Vorbedeutung für meine beginnende Laufbahn, und die Aussicht, unter den Augen des Admirals zu arbeiten, gab mir ein Gefühl von eigenem Wert, das ich bisher noch nicht gekannt hatte. Alle diese glücklichen Gedanken traten aber fast gänzlich zurück vor etwas, das mich zugleich anmutete und quälte, lockte und beunruhigte, vor etwas unendlich Fragwürdigem, von dem ich mir durchaus keine Rechenschaft zu geben wußte. Jetzt nach langem, vergeblichen Suchen wurde es mir plötzlich klar. Es waren die Augen des Admirals, die mir nachgingen. Und warum verfolgten sie mich? Weil es ihre Augen waren. Kein Vater,[45] keine Mutter konnten ihrem Kinde getreuer diesen Spiegel der Seele vererben! Ich geriet in eine unsagbare Verwirrung. Sollten, konnten ihre Augen von den seinigen abstammen? War das möglich? Nein, ich hatte mich getäuscht. Meine Einbildungskraft hatte mir eine Tücke gespielt, und um diese Gauklerin durch die Wirklichkeit zu widerlegen, beschloß ich eilig, in meine Herberge zurückzukehren und dann auf der Insel St. Louis meine Bekannten von den drei Lilien aufzusuchen.
Als ich eine Stunde später das hohe, schmale Haus des Parlamentrats betrat, das, dicht an der Brücke St. Michel gelegen, auf der einen Seite in die Wellen der Seine, auf der andern über eine Seitengasse hinweg in die gotischen Fenster einer kleinen Kirche blickte, fand ich die Türen des untern Stockwerks verschlossen, und als ich das zweite betrat, stand ich unversehens vor Gasparde, die an einer offenen Truhe beschäftigt schien.
»Wir haben Euch erwartet,« begrüßte sie mich, »und ich will Euch zu meinem Ohm führen, der sich freuen wird, Euch zu sehn.«
Der Alte saß behaglich im Lehnstuhle, einen großen Folianten durchblätternd, den er auf die dazu eingerichtete Seitenlehne stützte. Das weite Gemach war mit Büchern gefüllt, die in schön geschnitzten Eichenschränken standen. Statuetten, Münzen, Kupferstiche[46] bevölkerten, jedes an der geeigneten Stelle, diese friedliche Gedankenstätte. Der gelehrte Herr hieß mich, ohne sich zu erheben, einen Sitz an seine Seite rücken, grüßte mich als alten Bekannten und vernahm mit sichtlicher Freude den Bericht über meinen Eintritt in die Bedienung des Admirals.
»Gebe Gott, daß es ihm diesmal gelinge!« sagte er. »Uns Evangelischen, die wir leider am Ende doch nur eine Minderheit unter der Bevölkerung unserer Heimat sind, ohne verruchten Bürgerkrieg Luft zu schaffen, gab es zwei Wege, nur zwei Wege: entweder auswandern über den Ozean in das von Kolumbus entdeckte Land – diesen Gedanken hat der Admiral lange Jahre in seinem Gemüte bewegt und, hätten sich nicht unerwartete Hindernisse dagegen erhoben, wer weiß! – oder das Nationalgefühl entflammen und einen großen, der Menschheit heilbringenden auswärtigen Krieg führen, wo Katholik und Hugenott Seite an Seite fechtend in der Vaterlandsliebe zu Brüdern werden und ihren Religionshaß verlernen könnten. Das will der Admiral jetzt, und mir, dem Manne des Friedens, brennt der Boden unter den Füßen, bis der Krieg erklärt ist! Die Niederlande vom spanischen Joche befreiend, werden unsre Katholiken widerwillig in die Strömung der Freiheit gerissen werden. Aber es eilt! Glaubt mir, Schadau, über Paris brütet eine dumpfe Luft.[47] Die Guisen suchen einen Krieg zu vereiteln, der den jungen König selbständig und sie entbehrlich machen würde. Die Königin Mutter ist zweideutig – durchaus keine Teufelin, wie die Heißsporne unsrer Partei sie schildern, aber sie windet sich durch von heute auf morgen, selbstsüchtig nur auf das Interesse ihres Hauses bedacht. Gleichgültig gegen den Ruhm Frankreichs, ohne Sinn für Gutes und Böses, hält sie das Entgegengesetzte in ihren Händen, und der Zufall kann die Wahl entscheiden. Feig und unberechenbar wie sie ist, wäre sie freilich des Schlimmsten fähig! – Der Schwerpunkt liegt in dem Wohlwollen des jungen Königs für Coligny, und dieser König …« hier seufzte Chatillon, »nun, ich will Euerm Urteil nicht vorgreifen! Da er den Admiral nicht selten besucht, so werdet Ihr mit eignen Augen sehen.«
Der Greis schaute vor sich hin, dann plötzlich den Gegenstand des Gesprächs wechselnd und den Titel des Folianten aufblätternd, frug er mich: »Wißt Ihr, was ich da lese? Seht einmal!«
Ich las in lateinischer Sprache: Die Geographie des Ptolemäus, herausgegeben von Michael Servetus.
»Doch nicht der in Genf verbrannte Ketzer?« frug ich bestürzt.
»Kein anderer. Er war ein vorzüglicher Gelehrter,[48] ja, so weit ich es beurteilen kann, ein genialer Kopf, dessen Ideen in der Naturwissenschaft vielleicht später mehr Glück machen werden, als seine theologischen Grübeleien. – Hättet Ihr ihn auch verbrannt, wenn Ihr im Genfer Rat gesessen hättet?«
»Gewiß, Herr!« antwortete ich mit Überzeugung. »Bedenkt nur das Eine: was war die gefährlichste Waffe, mit welcher die Papisten unsern Kalvin bekämpften? Sie warfen ihm vor, seine Lehre sei Gottesleugnung. Nun kommt ein Spanier nach Genf, nennt sich Kalvins Freund, veröffentlicht Bücher, in welchen er die Dreieinigkeit leugnet, wie wenn das nichts auf sich hätte, und mißbraucht die evangelische Freiheit. War es nun Kalvin nicht den Tausenden und Tausenden schuldig, die für das reine Wort litten und bluteten, diesen falschen Bruder vor den Augen der Welt aus der evangelischen Kirche zu stoßen und dem weltlichen Richter zu überliefern, damit keine Verwechslung zwischen uns und ihm möglich sei und wir nicht unschuldigerweise fremder Gottlosigkeit geziehen werden?«
Chatillon lächelte wehmütig und sagte: »Da Ihr Euer Urteil über Servedo so trefflich begründet habt, müßt Ihr mir schon den Gefallen tun, diesen Abend bei mir zu bleiben. Ich führe Euch an ein Fenster, das auf die Laurentiuskapelle hinüberschaut, deren Nachbarschaft wir uns hier erfreuen und wo der berühmte[49] Franziskaner Panigarola heute Abend predigen wird. Da werdet Ihr vernehmen, wie man Euch das Urteil spricht. Der Pater ist ein gewandter Logiker und ein feuriger Redner. Ihr werdet keines seiner Worte verlieren und – Eure Freude dran haben. – Ihr wohnt noch im Wirtshause? Ich muß Euch doch für ein dauerndes Obdach sorgen, – was rätst du, Gasparde?« wandte er sich an diese, die eben eingetreten war.
Gasparde antwortete heiter: »Der Schneider Gilbert, unser Glaubensgenosse, der eine zahlreiche Familie zu ernähren hat, wäre wohl froh und hochgeehrt, wenn er dem Herrn Schadau sein bestes Zimmer abtreten dürfte. Und das hätte noch das Gute, daß der redliche, aber furchtsame Christ unsren evangelischen Gottesdienst wieder zu besuchen wagte, von diesem tapfern Kriegsmanne begleitet. – Ich gehe gleich hinüber und will ihm den Glücksfall verkündigen.« – Damit eilte die Schlanke weg.
So kurz ihre Erscheinung gewesen war, hatte ich doch aufmerksam forschend in ihre Augen geschaut, und ich geriet in neues Staunen. Von einer unwiderstehlichen Gewalt getrieben, mir ohne Aufschub dieses Rätsels Lösung zu verschaffen, kämpfte ich nur mit Mühe eine Frage nieder, die gegen allen Anstand verstoßen hätte, da kam mir der Alte selbst zu Hilfe, indem er spöttisch fragte: »Was findet Ihr Besonderes[50] an dem Mädchen, daß Ihr es so starr betrachtet?«
»Etwas sehr Besonderes,« erwiderte ich entschlossen, »die wunderbare Ähnlichkeit ihrer Augen mit denen des Admirals.«
Wie wenn er eine Schlange berührt hätte, fuhr der Rat zurück und sagte gezwungen lächelnd: »Gibt es keine Naturspiele, Herr Schadau? Wollt Ihr dem Leben verbieten, ähnliche Augen hervorzubringen?«
»Ihr habt mich gefragt, was ich Besonderes an dem Fräulein finde,« versetzte ich kaltblütig, »diese Frage habe ich beantwortet. Erlaubt mir eine Gegenfrage: da ich hoffe, Euch weiterhin besuchen zu dürfen, der ich mich von Euerm Wohlwollen und von Euerm überlegenen Geiste angezogen fühle, wie wünscht Ihr, daß ich fortan dieses schöne Fräulein begrüße? Ich weiß, daß sie von ihrem Paten Coligny den Namen Gasparde führt, aber Ihr habt mir noch nicht gesagt, ob ich die Gunst habe, mit Eurer Tochter oder mit einer Eurer Verwandten zu sprechen.«
»Nennt sie, wie Ihr wollt!« murmelte der Alte verdrießlich und fing wieder an, in der Geographie des Ptolemäus zu blättern.
Durch dies absonderliche Benehmen ward ich in meiner Vermutung bestärkt, daß hier ein Dunkel walte, und begann die kühnsten Schlüsse zu ziehn.[51] In der kleinen Druckschrift, die der Admiral über seine Verteidigung von St. Quentin veröffentlicht hatte und die ich auswendig wußte, schloß er ziemlich unvermittelt mit einigen geheimnisvollen Worten, worin er seinen Übertritt zum Evangelium andeutete. Hier war von der Sündhaftigkeit der Welt die Rede, an welcher er bekannte, auch selber teilgenommen zu haben. Konnte nun Gaspardes Geburt nicht im Zusammenhange stehn mit diesem vorevangelischen Leben? So streng ich sonst in solchen Dingen dachte, hier war mein Eindruck ein anderer; es lag mir diesmal ferne, einen Fehltritt zu verurteilen, der mir die unglaubliche Möglichkeit auftat, mich der Blutsverwandten des erlauchten Helden zu nähern, – wer weiß, vielleicht um sie zu werben. Während ich meiner Einbildungskraft die Zügel schießen ließ, glitt wahrscheinlich ein glückliches Lächeln durch meine Züge, denn der Alte, der mich insgeheim über seinen Folianten weg beobachtet hatte, wandte sich gegen mich mit unerwartetem Feuer:
»Ergötzt es Euch, junger Herr, an einem großen Mann eine Schwäche entdeckt zu haben, so wißt: er ist makellos! – Ihr seid im Irrtume. Ihr betrügt Euch!«
Hier erhob er sich wie unwillig und schritt das Gemach auf und nieder, dann, plötzlich den Ton wechselnd, blieb er dicht vor mir stehen, indem er[52] mich bei der Hand faßte: »Junger Freund,« sagte er, »in dieser schlimmen Zeit, wo wir Evangelischen aufeinander angewiesen sind und uns wie Brüder betrachten sollen, wächst das Vertrauen geschwind; es darf keine Wolke zwischen uns sein. Ihr seid ein braver Mann, und Gasparde ist ein liebes Kind. Gott verhüte, daß etwas Verdecktes Eure Begegnung unlauter mache. Ihr könnt schweigen, das trau' ich Euch zu; auch ist die Sache ruchbar und könnte Euch aus hämischem Munde zu Ohren kommen. So hört mich an!
Gasparde ist weder meine Tochter, noch meine Nichte; aber sie ist bei mir aufgewachsen und gilt als meine Verwandte. Ihre Mutter, die kurze Zeit nach der Geburt des Kindes starb, war die Tochter eines deutschen Reiteroffiziers, den sie nach Frankreich begleitet hatte. Gaspardes Vater aber,« hier dämpfte er die Stimme – »ist Dandelot, des Admirals jüngerer Bruder, dessen wunderbare Tapferkeit und frühes Ende Euch nicht unbekannt sein wird. Jetzt wißt Ihr genug. Begrüßt Gasparde als meine Nichte, ich liebe sie wie mein eigenes Kind. Im übrigen haltet reinen Mund und begegnet ihr unbefangen.«
Er schwieg, und ich brach das Schweigen nicht, denn ich war ganz erfüllt von der Mitteilung des alten Herrn. Jetzt wurden wir, uns beiden nicht[53] unwillkommen, unterbrochen und zum Abendtische gerufen, wo mir die holdselige Gasparde den Platz an ihrer Seite anwies. Als sie mir den vollen Becher reichte und ihre Hand die meinige berührte, durchrieselte mich ein Schauer, daß in diesen jungen Adern das Blut meines Helden rinne. Auch Gasparde fühlte, daß ich sie mit andern Augen betrachte als kurz vorher, sie sann und ein Schatten der Befremdung glitt über ihre Stirne, die aber schnell wieder hell wurde, als sie mir fröhlich erzählte, wie hoch sich der Schneider Gilbert geehrt fühle, mich zu beherbergen.
»Es ist wichtig,« sagte sie scherzend, »daß ihr einen christlichen Schneider an der Hand habt, der euch die Kleider streng nach hugenottischem Schnitte verfertigt. Wenn euch Pate Coligny, der jetzt beim König so hoch in Gunsten steht, bei Hofe einführt und die reizenden Fräulein der Königin Mutter Euch umschwärmen, da wäret Ihr verloren, wenn nicht Eure ernste Tracht sie gebührend in Schranken hielte.«
Während dieses heitern Gespräches vernahmen wir über die Gasse, von Pausen unterbrochen, bald lang gezogene, bald heftig ausgestoßene Töne, die den verwehten Bruchstücken eines rednerischen Vortrags glichen, und als bei einem zufälligen Schweigen ein Satz fast unverletzt an unser Ohr schlug, erhob sich Herr Chatillon unwillig.
»Ich verlasse euch!« sagte er, »der grausame Hanswurst da drüben verjagt mich.« – Mit diesen Worten ließ er uns allein.
»Was bedeutet das?« fragte ich Gasparde.
»Ei,« sagte sie, »in der Laurentiuskirche drüben predigt Pater Panigarola. Wir können von unserm Fenster mitten in das andächtige Volk hineinsehen und auch den wunderlichen Pater erblicken. Den Oheim empört sein Gerede, mich langweilt der Unsinn, ich höre gar nicht hin, habe ich ja Mühe, in unsrer evangelischen Versammlung, wo doch die lautere Wahrheit gepredigt wird, mit Andacht und Erbauung, wie es dem heiligen Gegenstande geziemt, bis ans Ende aufzuhorchen.« –
Wir waren unterdessen ans Fenster getreten, das Gasparde ruhig öffnete.
Es war eine laue Sommernacht, und auch die erleuchteten Fenster der Kapelle standen offen. Im schmalen Zwischenraume hoch über uns flimmerten Sterne. Der Pater auf der Kanzel, ein junger, blasser Franziskanermönch mit südlich feurigen Augen und zuckendem Mienenspiel, geberdete sich so seltsam heftig, daß er mir erst ein Lächeln abnötigte; bald aber nahm seine Rede, von der mir keine Silbe entging, meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
»Christen,« rief er, »was ist die Duldung, welche man von uns verlangt? Ist sie christliche Liebe?[55] Nein, sage ich, dreimal nein! Sie ist eine fluchwürdige Gleichgültigkeit gegen das Los unsrer Brüder! Was würdet ihr von einem Menschen sagen, der einen andern am Rande des Abgrunds schlummern sähe und ihn nicht weckte und zurückzöge? Und doch handelt es sich in diesem Falle nur um Leben und Sterben des Leibes. Um wie viel weniger dürfen wir, wo ewiges Heil oder Verderben auf dem Spiele steht, ohne Grausamkeit unsern Nächsten seinem Schicksal überlassen! Wie? es wäre möglich, mit den Ketzern zu wandeln und zu handeln, ohne den Gedanken auftauchen zu lassen, daß ihre Seelen in tödtlicher Gefahr schweben? Gerade unsre Liebe zu ihnen gebietet uns, sie zum Heil zu überreden und, sind sie störrisch, zum Heil zu zwingen, und sind sie unverbesserlich, sie auszurotten, damit sie nicht durch ihr schlechtes Beispiel ihre Kinder, ihre Nachbarn, ihre Mitbürger in die Flammen mitreißen! Denn ein christlich Volk ist ein Leib, von dem geschrieben steht: wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus! Wenn dich deine rechte Hand ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn, siehe, es ist besser, daß eines deiner Glieder verderbe, als daß dein ganzer Leib in das nie verlöschende Feuer geworfen werde!« –
Dies ungefähr war der Gedankengang des Paters, den er aber mit einer leidenschaftlichen Rhetorik[56] und mit ungezügelten Geberden zu einem wilden Schauspiel verkörperte. War es nun das ansteckende Gift des Fanatismus oder das grelle von oben fallende Lampenlicht – die Gesichter der Zuhörer nahmen einen so verzerrten und, wie mir schien, blutdürstigen Ausdruck an, daß mir auf einmal klar wurde, auf welchem Vulkan wir Hugenotten in Paris stünden.
Gasparde wohnte der unheimlichen Szene fast gleichgültig bei und richtete ihr Auge auf einen schönen Stern, der über dem Dache der Kapelle mild leuchtend aufstieg.
Nachdem der Italiener seine Rede mit einer Handbewegung geschlossen, die mir eher einer Fluchgeberde als einem Segen zu gleichen schien, begann das Volk in dichtem Gedränge aus der Pforte zu strömen, an deren beiden Seiten zwei große brennende Pechfackeln in eiserne Ringe gesteckt wurden. Ihr blutiger Schein beleuchtete die Heraustretenden und erhellte zeitweise auch Gaspardes Antlitz, die das Volksgewühle mit Neugierde betrachtete, während ich mich in den Schatten zurückgelehnt hatte. Plötzlich sah ich sie erblassen, dann flammte ihr Blick empört auf, und als der meinige ihm folgte, sah ich einen hohen Mann in reicher Kleidung ihr mit halb herablassender, halb gieriger Geberde einen Kuß zuwerfen. Gasparde bebte vor Zorn. Sie ergriff meine Hand und indem sie mich an ihre Seite[57] zog, sprach sie mit vor Erregung zitternder Stimme in die Gasse hinunter:
»Du beschimpfst mich, Memme, weil du mich schutzlos glaubst! Du irrst dich! Hier steht Einer, der dich züchtigen wird, wenn du noch einen Blick wagst!« –
Hohnlachend schlug der Kavalier, der, wenn nicht ihre Rede, doch die ausdrucksvolle Geberde verstanden hatte, seinen Mantel um die Schulter und verschwand in der strömenden Menge.
Gaspardes Zorn löste sich in einen Tränenstrom auf, und sie erzählte mir schluchzend, wie dieser Elende, der zu dem Hofstaate des Herzogs von Anjou, des königlichen Bruders, gehöre, schon seit dem Tage ihrer Ankunft sie auf der Straße verfolge, wenn sie einen Ausgang wage, und sich sogar durch das Begleit ihres Oheims nicht abhalten lasse, ihr freche Grüße zuzuwerfen.
»Ich mag dem lieben Ohm bei seiner erregbaren und etwas ängstlichen Natur nicht davon sagen. Es würde ihn beunruhigen, ohne daß er mich beschützen könnte. Ihr aber seid jung und führt einen Degen, ich zähle auf Euch! Die Unziemlichkeit muß um jeden Preis ein Ende nehmen. – Nun lebt wohl, mein Ritter!« fügte sie lächelnd hinzu, während ihre Tränen noch flossen, »und vergeßt nicht, meinem Ohm gute Nacht zu sagen!« –
Ein alter Diener leuchtete mir in das Gemach seines Herrn, bei dem ich mich beurlaubte.
»Ist die Predigt vorüber?« fragte der Rat. »In jüngeren Tagen hätte mich das Fratzenspiel belustigt; jetzt aber, besonders seit ich in Nîmes, wo ich das letzte Jahrzehnt mit Gasparde zurückgezogen gelebt habe, im Namen Gottes Mord und Auflauf anstiften sah, kann ich keinen Volkshaufen um einen aufgeregten Pfaffen versammelt sehen ohne die Beängstigung, daß sie nun gleich etwas Verrücktes oder Grausames unternehmen werden. Es fällt mir auf die Nerven.« –
Als ich die Kammer meiner Herberge betrat, warf ich mich in den alten Lehnstuhl, der außer einem Feldbette ihre ganze Bequemlichkeit ausmachte. Die Erlebnisse des Tages arbeiteten in meinem Kopfe fort, und an meinem Herzen zehrte es wie eine zarte, aber scharfe Flamme. Die Turmuhr eines nahen Klosters schlug Mitternacht, meine Lampe, die ihr Öl aufgebraucht hatte, erlosch, aber taghell war es in meinem Innern.
Daß ich Gaspardes Liebe gewinnen könne, schien mir nicht unmöglich, Schicksal, daß ich es mußte, und Glück, mein Leben dafür einzusetzen.

Am nächsten Morgen zur anberaumten Stunde stellte ich mich bei dem Admiral ein und fand ihn in einem abgegriffenen Taschenbuche blätternd.
»Dies sind,« begann er, »meine Aufzeichnungen aus dem Jahre siebenundfünfzig, in welchem ich St. Quentin verteidigte und mich dann den Spaniern ergeben mußte. Da steht unter den tapfersten meiner Leute, mit einem Kreuze bezeichnet, der Name Sadow, mir dünkt, es war ein Deutscher. Sollte dieser Name mit dem Eurigen derselbe sein?«
»Kein andrer als der Name meines Vaters! Er hatte die Ehre, unter Euch zu dienen und vor Euern Augen zu fallen!«
»Nun denn,« fuhr der Admiral fort, »das bestärkt mich in dem Vertrauen, das ich in Euch setze. Ich bin von Leuten, mit denen ich lange zusammenlebte, verraten worden, Euch trau' ich auf den ersten Anblick und ich glaube, es wird mich nicht betrügen.«
Mit diesen Worten ergriff er ein Papier, das mit seiner großen Handschrift von oben bis unten bedeckt war: »Schreibt mir das ins Reine, und wenn Ihr Euch daraus über manches unterrichtet, das Euch das Gefährliche unsrer Zustände zeigt, so laßt's Euch[60] nicht anfechten. Alles Große und Entscheidende ist ein Wagnis. Setzt Euch und schreibt.« –
Was mir der Admiral übergeben hatte, war ein Memorandum, das er an den Prinzen von Oranien richtete. Mit steigendem Interesse folgte ich dem Gange der Darstellung, die mit der größten Klarheit, wie sie dem Admiral eigen war, sich über die Zustände von Frankreich verbreitete. Den Krieg mit Spanien um jeden Preis und ohne jeden Aufschub herbeizuführen, dies, schrieb der Admiral, ist unsre Rettung. Alba ist verloren, wenn er von uns und von Euch zugleich angegriffen wird. Mein Herr und König will den Krieg; aber die Guisen arbeiten mit aller Anstrengung dagegen; die katholische Meinung, von ihnen aufgestachelt, hält die französische Kriegslust im Schach, und die Königin Mutter, welche den Herzog von Anjou dem Könige auf unnatürliche Weise vorzieht, will nicht, daß dieser ihren Liebling verdunkle, indem er sich im Feld auszeichnet, wonach mein Herr und König Verlangen trägt, und was ich ihm als treuer Untertan gönne und, so viel an mir liegt, verschaffen möchte.
Mein Plan ist folgender: Eine hugenottische Freischar ist in diesen Tagen in Flandern eingefallen. Kann sie sich gegen Alba halten – und dies hängt zum großen Teil davon ab, daß Ihr gleichzeitig den spanischen Feldherrn von Holland her angreift – so[61] wird dieser Erfolg den König bewegen, alle Hindernisse zu überwinden und entschlossen vorwärts zu gehn. Ihr kennt den Zauber eines ersten Gelingens.
Ich war mit dem Schreiben zu Ende, als ein Diener erschien und dem Admiral etwas zuflüsterte. Ehe dieser Zeit hatte, sich von seinem Sitze zu erheben, trat ein sehr junger Mann von schlanker, kränklicher Gestalt heftig erregt ins Gemach und eilte mit den Worten auf ihn zu:
»Guten Morgen, Väterchen! Was gibt es Neues? Ich verreise auf einige Tage nach Fontainebleau. Habt Ihr Nachricht aus Flandern?« Jetzt wurde er meiner gewahr, und auf mich hindeutend, frug er herrisch: »Wer ist der da?«
»Mein Schreiber, Sire, der sich gleich entfernen wird, wenn Eure Majestät es wünscht.«
»Weg mit ihm!« rief der junge König, »ich will nicht belauscht sein, wenn ich Staatsgeschäfte behandle! Vergeßt Ihr, daß wir von Spähern umstellt sind? – Ihr seid zu arglos, lieber Admiral!«
Jetzt warf er sich in einen Lehnstuhl und starrte ins Leere; dann, plötzlich aufspringend, klopfte er Coligny auf die Schulter, und als hätte er mich, dessen Entfernung er eben gefordert, vergessen, brach er in die Worte aus:
»Bei den Eingeweiden des Teufels! wir erklären seiner katholischen Majestät nächstens den Krieg!«[62] Nun aber schien er wieder in den früheren Gedankengang zurückzufallen, denn er flüsterte mit geängstigter Miene: »Neulich noch, erinnert Ihr euch? als wir Beide in meinem Kabinet Rat hielten, da raschelte es hinter der Tapete. Ich zog den Degen, wißt Ihr? und durchstach sie zweimal, dreimal! Da hob sie sich, und wer trat darunter hervor? Mein lieber Bruder, der Herzog von Anjou, mit einem Katzenbuckel!« Hier machte der König eine nachahmende Geberde und brach in unheimliches Lachen aus. »Ich aber,« fuhr er fort, »maß ihn mit einem Blicke, den er nicht ertragen konnte und der ihn flugs aus der Türe trieb.«
Hier nahm das bleiche Antlitz einen Ausdruck so wilden Hasses an, daß ich es erschrocken anstarrte.
Coligny, für den ein solcher Auftritt wohl nichts Ungewöhnliches hatte, dem aber die Gegenwart eines Zeugen peinlich sein mochte, entfernte mich mit einem Winke.
»Ich sehe, Eure Arbeit ist vollendet,« sagte er, »auf Wiedersehen morgen.« –
Während ich meinen Heimweg einschlug, ergriff mich ein unendlicher Jammer. Dieser unklare Mensch also war es, von dem die Entscheidung der Dinge abhing. – Wo sollte bei so knabenhafter Unreife und flackernder Leidenschaftlichkeit die Stetigkeit des Gedankens, die Festigkeit des Entschlusses herkommen?[63] Konnte der Admiral für ihn handeln? Aber wer bürgte dafür, daß nicht andere, feindliche Einflüsse sich in der nächsten Stunde schon dieses verworrenen Gemütes bemächtigten! Ich fühlte, daß nur dann Sicherheit war, wenn Coligny in seinem König eine selbstbewußte Stütze fand; besaß er in ihm nur ein Werkzeug, so konnte ihm dieses morgen entrissen werden.
In so böse Zweifel verstrickt, verfolgte ich meinen Weg, als sich eine Hand auf meine Schulter legte. Ich wandte mich und blickte in das wolkenlose Gesicht meines Landsmannes Boccard, der mich umhalste und mit den lebhaftesten Freudenbezeugungen begrüßte.
»Willkommen, Schadau, in Paris!« rief er, »Ihr seid, wie ich sehe, müßig, das bin ich auch, und da der König eben verritten ist, so müßt Ihr mit mir kommen, ich will Euch das Louvre zeigen. Ich wohne dort, da meine Kompanie die Wache der innern Gemächer hat. – Es wird Euch hoffentlich nicht belästigen,« fuhr er fort, da er in meinen Mienen kein ungemischtes Vergnügen über seinen Vorschlag las, »mit einem königlichen Schweizer Arm in Arm zu gehn? Da ja Euer Abgott Coligny die Verbrüderung der Parteien wünscht, so würde ihm das Herz im Leibe lachen ob der Freundschaft seines Schreibers mit einem Leibgardisten.«
»Wer hat Euch gesagt …« unterbrach ich ihn erstaunt –
»Daß Ihr des Admirals Schreiber seid?« lachte Boccard. »Guter Freund, am Hofe wird mehr geschwatzt, als billig ist! Heute morgen beim Ballspiel war unter den hugenottischen Hofleuten die Rede von einem Deutschen, der bei dem Admiral Gunst gefunden hätte, und aus einigen Äußerungen über die fragliche Persönlichkeit erkannte ich zweifellos meinen Freund Schadau. Es ist nur gut, daß Euch jenes Mal Blitz und Donner in die drei Lilien zurückjagten, sonst wären wir uns fremd geblieben, denn Eure Landsleute im Louvre hättet Ihr wohl schwerlich aus freien Stücken aufgesucht! Mit dem Hauptmann Pfyffer muß ich Euch gleich bekannt machen!«
Dies verbat ich mir, da Pfyffer nicht nur als abgezeichneter Soldat, sondern auch als fanatischer Katholik berühmt war, willigte aber gern ein, mit Boccard das Innere des Louvre zu besichtigen, da ich den viel gepriesenen Bau bis jetzt nur von außen betrachtet hatte.
Wir schritten neben einander durch die Straßen, und das freundliche Geplauder des lebenslustigen Fryburgers war mir willkommen, da es mich von meinen schweren Gedanken erlöste.
Bald betraten wir das französische Königsschloß,[65] das damals zur Hälfte aus einem finstern mittelalterlichen Kastell, zur andern Hälfte aus einem neuen, prächtigen Palast bestand, den die Medicäerin hatte aufführen lassen. Diese Mischung zweier Zeiten vermehrte in mir den Eindruck, der mich, seit ich Paris betreten, nie verlassen hatte, den Eindruck des Schwankenden, Ungleichartigen, der sich widersprechenden und mit einander ringenden Elemente.
Nachdem wir viele Gänge und eine Reihe von Gemächern durchschritten hatten, deren Verzierung in keckem Steinwerke und oft ausgelassener Malerei meinem protestantischen Geschmacke fremd und zuweilen ärgerlich war, Boccard aber herzlich belustigte, öffnete mir dieser ein Kabinet mit den Worten: »Dies ist das Studierzimmer des Königs.« –
Da herrschte eine gräuliche Unordnung. Der Boden war mit Notenheften und aufgeblätterten Büchern bestreut. An den Wänden hingen Waffen. Auf dem kostbaren Marmortische lag ein Waldhorn.
Ich begnügte mich von der Türe aus einen Blick in dies Chaos zu werfen, und weitergehend frug ich Boccard, ob der König musikalisch sei.
»Er bläst herzzerreißend,« erwiderte dieser, »oft ganze Vormittage hindurch und, was schlimmer ist, ganze Nächte, wenn er nicht hier nebenan,« er wies auf eine andere Türe, »vor dem Amboß steht und schmiedet, daß die Funken stieben. Jetzt aber ruhen[66] Waldhorn und Hammer. Er ist mit dem jungen Chateauguyon eine Wette eingegangen, welchem von ihnen es zuerst gelinge, den Fuß im Munde das Zimmer auf und nieder zu hüpfen. Das gibt ihm nun unglaublich zu tun.« –
Da Boccard sah, wie ich traurig wurde, und es ihm auch sonst passend scheinen mochte, das Gespräch über das gekrönte Haupt Frankreichs abzubrechen, lud er mich ein, mit ihm das Mittagsmahl in einem nicht weit entlegenen Gasthause einzunehmen, das er mir als ganz vorzüglich schilderte.
Um abzukürzen, schlugen wir eine enge, lange Gasse ein. Zwei Männer schritten uns vom andern Ende derselben entgegen.
»Sieh,« sagte mir Boccard, »dort kommt Graf Guiche, der berüchtigte Damenfänger und der größte Raufer vom Hofe, und neben ihm – wahrhaftig – das ist Lignerolles! Wie darf sich der am hellen Tage blicken lassen, da er doch ein vollgültiges Todesurteil auf dem Halse hat!«
Ich blickte hin und erkannte in dem Vornehmern der Bezeichneten den Unverschämten, der gestern Abend im Scheine der Fackeln Gasparde mit frecher Geberde beleidigt hatte. Auch er schien sich meiner näherschreitend zu erinnern, denn sein Auge blieb unverwandt auf mir haften. Wir hatten die halbe Breite der engen Gasse inne, die andere Hälfte den[67] uns entgegen Kommenden frei lassend. Da Boccard und Lignerolles auf der Mauerseite gingen, mußten der Graf und ich hart aneinander vorüber.
Plötzlich erhielt ich einen Stoß und hörte den Grafen sagen: »Gieb Raum, verdammter Hugenott!«
Außer mir wandte ich mich nach ihm um, da rief er lachend zurück: »Willst du dich auf der Gasse so breit machen wie am Fenster?«
Ich wollte ihm nachstürzen, da umschlang mich Boccard und beschwor mich: »Nur hier keine Scene! In diesen Zeiten würden wir in einem Augenblicke den Pöbel von Paris hinter uns her haben, und, da sie dich an deinem steifen Kragen als Hugenotten erkennen würden, wärst du unzweifelhaft verloren! Daß du Genugtuung erhalten mußt, versteht sich von selbst. Du überlässest mir die Sache, und ich will froh sein, wenn sich der vornehme Herr zu einem ehrlichen Zweikampfe versteht. Aber an dem Schweizernamen darf kein Makel haften, und wenn ich mit dem deinigen auch mein Leben einsetzen müßte! –
Jetzt sage mir um aller Heiligen willen, bist du mit Guiche bekannt? Hast du ihn gegen dich aufgebracht? Doch nein, das ist ja nicht möglich! Der Taugenichts war übler Laune und wollte sie an deiner Hugenottentracht auslassen.«
Unterdessen waren wir in das Gasthaus eingetreten,[68] wo wir rasch und in gestörter Stimmung unser Mahl hielten.
»Ich muß meinen Kopf zusammenhalten,« sagte Boccard, »denn ich werde mit dem Grafen einen harten Stand haben.«
Wir trennten uns und ich kehrte in meine Herberge zurück, Boccard versprechend, ihn dort zu erwarten. Nach Verlauf von zwei Stunden trat er in meine Kammer mit dem Ausrufe: »Es ist gut abgelaufen! Der Graf wird sich mit dir schlagen, morgen bei Tagesanbruch vor dem Tore St. Michel. Er empfing mich nicht unhöflich, und als ich ihm sagte, du wärest von gutem Hause, meinte er, es sei jetzt nicht der Augenblick, deinen Stammbaum zu untersuchen, was er kennen zu lernen wünsche, sei deine Klinge.
Und wie steht es damit?« fuhr Boccard fort, »ich bin sicher, daß du ein methodischer Fechter bist, aber ich fürchte, du bist langsam, langsam, zumal einem so raschen Teufel gegenüber.«
Boccards Gesicht nahm einen besorgten Ausdruck an, und nachdem er nach ein paar Übungsklingen gerufen – es befand sich zu ebener Erde neben meinem Gasthause ein Fechtsaal – gab er mir eine derselben in die Hand und sagte: »Nun zeige deine Künste!« –
Nach einigen Gängen, die ich im gewohnten Tempo durchfocht, während Boccard mich vergeblich mit dem[69] Rufe: Schneller, schneller! anfeuerte, warf er seine Klinge weg und stellte sich ans Fenster, um eine Träne vor mir zu verbergen, die ich aber schon hervordringen gesehn hatte.
Ich trat zu ihm und legte meine Hand auf seine Schulter.
»Boccard,« sagte ich, »betrübe dich nicht. Alles ist vorher bestimmt. Ist meine Todesstunde auf morgen gestellt, so bedarf es nicht der Klinge des Grafen, um meinen Lebensfaden zu zerschneiden. Ist es nicht so, wird mir seine gefährliche Waffe nichts anhaben können.« –
»Mache mich nicht ungeduldig!« versetzte er, sich rasch nach mir umdrehend. »Jede Minute der Frist, die uns bleibt, ist kostbar und muß benützt werden – nicht zum Fechten, denn in der Theorie bist du unsträflich, und dein Phlegma,« hier seufzte er, »ist unheilbar. Es gibt nur ein Mittel, dich zu retten. Wende dich an Unsre liebe Frau von Einsiedeln, und wirf mir nicht ein, du seiest Protestant – einmal ist keinmal! Muß es sie nicht doppelt rühren, wenn einer der Abtrünnigen sein Leben in ihre Hände befiehlt! Du hast jetzt noch Zeit, für deine Rettung viele Ave Maria zu sprechen, und glaube mir, die Gnadenmutter wird dich nicht im Stiche lassen! Überwinde dich, lieber Freund, und folge meinem Rate.« –
»Laß mich in Ruhe, Boccard!« versetzte ich, über seine wunderliche Zumutung ungehalten und doch von seiner Liebe gerührt.
Er aber drang noch eine Weile vergeblich in mich. Dann ordneten wir das Notwendige für morgen, und er nahm Abschied.
In der Türe wandte er sich noch einmal zurück und sagte: »Nur einen Stoßseufzer, Schadau, vor dem Einschlafen!« –

Am nächsten Morgen wurde ich durch eine rasche Berührung aus dem Schlafe geweckt. Boccard stand vor meinem Lager.
»Auf!« rief er, »es eilt, wenn wir nicht zu spät kommen sollen! Ich vergaß gestern, dir zu sagen, von wem der Graf sich sekundieren läßt, – von Lignerolles. Ein Schimpf mehr, wenn du willst! Aber es hat den Vorteil, daß, im Falle du –« er seufzte – »deinen Gegner ernstlich verwunden solltest, dieser ehrenwerte Sekundant gewiß reinen Mund halten wird, da er tausend gute Gründe hat, die öffentliche Aufmerksamkeit in keiner Weise auf sich zu ziehen.« –
Während ich mich ankleidete, bemerkte ich wohl,[71] daß dem Freund eine Bitte auf dem Herzen lag, die er mit Mühe niederkämpfte.
Ich hatte mein noch in Bern verfertigtes, nach Schweizersitte auf beiden Seiten mit derben Taschen versehenes Reisewams angezogen und drückte meinen breitkrämpigen Filz in die Stirne, als mich Boccard auf einmal in großer Gemütsbewegung heftig umhalste und, nachdem er mich geküßt, seinen Lockenkopf an meine Brust lehnte. Diese überschwengliche Teilnahme erschien mir unmännlich, und ich drückte das duftende Haupt mit beiden Händen beschwichtigend weg. Mir däuchte, daß sich Boccard in diesem Augenblicke etwas an meinem Wams zu schaffen machte; aber ich gab nicht weiter darauf acht, da die Zeit drängte.
Wir gingen schweigend durch die morgenstillen Gassen, während es leise zu regnen anfing, durchschritten das Tor, das eben geöffnet worden war, und fanden in kleiner Entfernung vor demselben einen mit verfallenden Mauern umgebenen Garten. Diese verlassene Stätte war zu der Begegnung ausersehn.
Wir traten ein und erblickten Guiche mit Lignerolles, die unsrer harrend zwischen den Buchenhecken des Hauptganges auf- und niederschritten. Der Graf grüßte mich mit spöttischer Höflichkeit. Boccard und Lignerolles traten zusammen, um Kampfstelle und Waffen zu regeln.
»Der Morgen ist kühl,« sagte der Graf, »ist es Euch genehm, so fechten wir im Wams.« –
»Der Herr ist nicht gepanzert?« warf Lignerolles hin, indem er eine tastende Bewegung nach meiner Brust machte.
Guiche bedeutete ihn mit einem Blicke, es zu lassen.
Zwei lange Stoßklingen wurden uns geboten. Der Kampf begann, und ich merkte bald, daß ich einem an Behendigkeit mir überlegenen und dabei völlig kaltblütigen Gegner gegenüber stehe. Nachdem er meine Kraft mit einigen spielenden Stößen wie auf dem Fechtboden geprüft hatte, wich seine nachlässige Haltung. Es wurde tötlicher Ernst. Er zeigte Quart und stieß Sekunde in beschleunigtem Tempo. Meine Parade kam genau noch rechtzeitig: wiederholte er dieselben Stöße um eine Kleinigkeit rascher, so war ich verloren. Ich sah ihn befriedigt lächeln und machte mich auf mein Ende gefaßt.
Blitzschnell kam der Stoß, aber die geschmeidige Stahlklinge bog sich hoch auf, als träfe sie einen harten Gegenstand, ich parierte, führte den Nachstoß und rannte dem Grafen, der, seiner Sache sicher, weit ausgefallen war, meinen Degen durch die Brust. Er verlor die Farbe, wurde aschfahl, ließ die Waffe sinken und brach zusammen.
Lignerolles beugte sich über den Sterbenden, während Boccard mich von hinnen zog.
Wir folgten dem Umkreise der Stadtmauer in flüchtiger Eile bis zum zweitnächsten Tore, wo Boccard mit mir in eine kleine, ihm bekannte Schenke trat. Wir durchschritten den Flur und ließen uns hinter dem Hause unter einer dicht überwachsenen Laube nieder. Noch war in der feuchten Morgenfrühe alles wie ausgestorben. Der Freund rief nach Wein, der uns nach einer Weile von einem verschlafenen Schenkmädchen gebracht wurde. Er schlürfte in behaglichen Zügen, während ich den Becher unberührt vor mir stehen ließ. Ich hatte die Arme über der Brust gekreuzt und senkte das Haupt. Der Tote lag mir auf der Seele.
Boccard forderte mich zum Trinken auf, und nachdem ich ihm zu Gefallen den Becher geleert hatte, begann er:
»Ob nun gewisse Leute ihre Meinung ändern werden über Unsre liebe Frau von Einsiedeln?« –
»Laß mich zufrieden!« versetzte ich unwirsch, »was hat denn sie damit zu schaffen, daß ich einen Menschen getötet?« –
»Mehr als du denkst!« erwiderte Boccard mit einem vorwurfsvollen Blicke. »Daß du hier neben mir sitzest, hast du nur ihr zu danken! Du bist ihr eine dicke Kerze schuldig!«
Ich zuckte die Achseln.
»Ungläubiger!« rief er und zog, in meine linke[74] Brusttasche langend, triumphierend das Medaillon daraus hervor, welches er um den Hals zu tragen pflegte, und das er heute morgen während seiner heftigen Umarmung mir heimlich in das Wams geschoben haben mußte.
Jetzt fiel es mir wie eine Binde von den Augen.
Die silberne Münze hatte den Stoß aufgehalten, der mein Herz durchbohren sollte. Mein erstes Gefühl war zornige Scham, als ob ich ein unehrliches Spiel getrieben und entgegen den Gesetzen des Zweikampfes meine Brust geschützt hätte. Darein mischte sich der Groll, einem Götzenbilde mein Leben zu schulden.
»Läge ich doch lieber tot,« murmelte ich, »als daß ich bösem Aberglauben meine Rettung verdanken muß!« –
Aber allmählich lichteten sich meine Gedanken.
Gasparde trat mir vor die Seele und mit ihr alle Fülle des Lebens. Ich war dankbar für das neu geschenkte Sonnenlicht, und als ich wieder in die freudigen Augen Boccards blickte, brachte ich es nicht über mich, mit ihm zu hadern, so gern ich es gewollt hätte. Sein Aberglaube war verwerflich, aber seine Freundestreue hatte mir das Leben gerettet.
Ich nahm von ihm mit Herzlichkeit Abschied und eilte ihm voraus durch das Tor und quer durch die[75] Stadt nach dem Hause des Admirals, der mich zu dieser Stunde erwartete.
Hier brachte ich den Vormittag am Schreibtische zu, diesmal mit der Durchsicht von Rechnungen beauftragt, die sich auf die Ausrüstung der nach Flandern geworfenen hugenottischen Freischaar bezogen. Als der Admiral in einem freien Augenblicke zu mir trat, wagte ich die Bitte, er möchte mich nach Flandern schicken, um an dem Einfalle teilzunehmen und ihm rasche und zuverlässige Nachricht von dem Verlaufe desselben zu senden.
»Nein, Schadau,« antwortete er kopfschüttelnd, »ich darf Euch nicht Gefahr laufen lassen, als Freibeuter behandelt zu werden und am Galgen zu sterben. Etwas anderes ist es, wenn Ihr nach erklärten Feindseligkeiten an meiner Seite fallen solltet. Ich bin es Euerm Vater schuldig, Euch keiner andern Gefahr auszusetzen als einem ehrlichen Soldatentode!« –
Es mochte ungefähr Mittag sein, als sich das Vorzimmer in auffallender Weise füllte und ein immer erregter werdendes Gespräch hörbar wurde.
Der Admiral rief seinen Schwiegersohn, Teligny, herein, der ihm berichtete, Graf Guiche sei diesen Morgen im Zweikampfe gefallen, sein Sekundant, der verrufene Lignerolles, habe die Leiche vor dem Tore St. Michel durch die gräfliche Dienerschaft[76] abholen lassen und ihr, bevor er sich flüchtete, nichts anderes zu sagen gewußt, als daß ihr Herr durch die Hand eines ihm unbekannten Hugenotten gefallen sei.
Coligny zog die Brauen zusammen und brauste auf: »Habe ich nicht streng untersagt – habe ich nicht gedroht, gefleht, beschworen, daß keiner unsrer Leute in dieser verhängnisvollen Zeit einen Zwist beginne oder aufnehme, der zu blutigem Entscheide führen könnte! Ist der Zweikampf an sich schon eine Tat, die kein Christ ohne zwingende Gründe auf sein Gewissen laden soll, so wird er in diesen Tagen, wo ein ins Pulverfaß springender Funke uns Alle verderben kann, zum Verbrechen an unsern Glaubensgenossen und am Vaterlande.« –
Ich blickte von meinen Rechnungen nicht auf und war froh, als ich die Arbeit zu Ende gebracht hatte. Dann ging ich in meine Herberge und ließ mein Gepäck in das Haus des Schneiders Gilbert bringen.
Ein kränklicher Mann mit einem furchtsamen Gesichtchen geleitete mich unter vielen Höflichkeiten in das mir bestimmte Zimmer. Es war groß und luftig und überschaute, das oberste Stockwerk des Hauses bildend, den ganzen Stadtteil, ein Meer von Dächern, aus welchem Turmspitzen in den Wolkenhimmel aufragten.
»Hier seid Ihr sicher!« sagte Gilbert mit feiner Stimme und zwang mir damit ein Lächeln ab.
»Mich freut es,« erwiderte ich, »bei einem Glaubensbruder Herberge zu nehmen.« –
»Glaubensbruder?« lispelte der Schneider, »sprecht nicht so laut, Herr Hauptmann. Es ist wahr, ich bin ein evangelischer Christ, und – wenn es nicht anders sein kann – will ich auch für meinen Heiland sterben; aber verbrannt werden, wie es mit Dubourg auf dem Greveplatze geschah! – ich sah damals als kleiner Knabe zu – hu, davor hab' ich einen Schauder!« –
»Habt keine Angst,« beruhigte ich, »diese Zeiten sind vorüber, und das Friedensedikt gewährleistet uns Allen freie Religionsübung.«
»Gott gebe, daß es dabei bleibe!« seufzte der Schneider. »Aber Ihr kennt unsern Pariser Pöbel nicht. Das ist ein wildes und ein neidisches Volk, und wir Hugenotten haben das Privilegium, sie zu ärgern. Weil wir eingezogen, züchtig und rechtschaffen leben, so werfen sie uns vor, wir wollen uns als die Bessern von ihnen sondern; aber, gerechter Himmel! wie ist es möglich, die zehn Gebote zu halten und sich nicht vor ihnen auszuzeichnen!«
Mein neuer Hauswirt verließ mich, und bei der einbrechenden Dämmerung ging ich hinüber in die[78] Wohnung des Parlamentrats. Ich fand ihn höchst niedergeschlagen.
»Ein böses Verhängnis waltet über unsrer Sache,« hub er an. »Wißt Ihr es schon, Schadau? Ein vornehmer Höfling, Graf Guiche, ward diesen Morgen im Zweikampfe von einem Hugenotten erstochen. Ganz Paris ist voll davon, und ich denke, Pater Panigarola wird die Gelegenheit nicht versäumen, auf uns Alle als auf eine Genossenschaft von Mördern hinzuweisen und seinen tugendhaften Gönner – denn Guiche war ein eifriger Kirchgänger – in einer seiner wirkungsvollen Abendpredigten als Märtyrer des katholischen Glaubens auszurufen … Der Kopf schmerzt mich, Schadau, und ich will mich zur Ruhe begeben. Laßt Euch von Gasparde den Abendtrunk kredenzen.«
Gasparde stand während dieses Gesprächs neben dem Sitze des alten Herrn, auf dessen Rückenlehne sie sich nachdenkend stützte. Sie war heute sehr blaß, und tiefernst blickten ihre großen blauen Augen.
Als wir allein waren, standen wir uns einige Augenblicke schweigend gegenüber. Jetzt stieg der schlimme Verdacht in mir auf, daß sie, die selbst mich zu ihrer Verteidigung aufgefordert, nun vor dem Blutbefleckten schaudernd zurücktrete. Die seltsamen Umstände, die mich gerettet hatten und die[79] ich Gasparde nicht mitteilen konnte, ohne ihr kalvinistisches Gefühl schwer zu verletzen, verwirrten mein Gewissen mehr, als die nach Mannesbegriffen leichte Blutschuld es belastete. Gasparde fühlte mir an, daß meine Seele beschwert war, und konnte den Grund davon allein in der Tötung des Grafen und den daraus unsrer Partei erwachsenden Nachteilen suchen.
Nach einer Weile sagte sie mit gepreßter Stimme: »Du also hast den Grafen umgebracht?«
»Ich,« war meine Antwort.
Wieder schwieg sie. Dann trat sie mit plötzlichem Entschlusse an mich heran, umschlang mich mit beiden Armen und küßte mich inbrünstig auf den Mund.
»Was du immer verbrochen hast,« sagte sie fest, »ich bin deine Mitschuldige. Um meinetwillen hast du die Tat begangen. Ich bin es, die dich in Sünde gestürzt hat. Du hast dein Leben für mich eingesetzt. Ich möchte es dir vergelten, doch wie kann ich es.« –
Ich faßte ihre beiden Hände und rief: »Gasparde, laß mich, wie heute, so morgen und immerdar dein Beschützer sein! Teile mit mir Gefahr und Rettung, Schuld und Heil! Eins und untrennbar laß uns sein bis zum Tode!«
»Eins und untrennbar!« sagte sie.

Seit dem verhängnisvollen Tage, an welchem ich Guiche getödtet und Gaspardes Liebe gewonnen hatte, war ein Monat verstrichen. Täglich schrieb ich im Kabinet des Admirals, der mit meiner Arbeit zufrieden schien und mich mit steigendem Vertrauen behandelte. Ich fühlte, daß ihm die Innigkeit meines Verhältnisse zu Gasparde nicht unbekannt geblieben war, ohne daß er es jedoch mit einem Worte berührt hätte.
Während dieser Zeit hatte sich die Lage der Protestanten in Paris sichtlich verschlimmert. Der Einfall in Flandern war mißlungen, und der Rückschlag machte sich am Hofe und in der öffentlichen Stimmung fühlbar. Die Hochzeit des Königs von Navarra mit Karls reizender, aber leichtfertiger Schwester erweiterte die Kluft zwischen den beiden Parteien, statt sie zu überbrücken. Kurz vorher war Jeanne d'Albret, die wegen ihres persönlichen Wertes von den Hugenotten hoch verehrte Mutter des Navarresen, plötzlich gestorben, an Gift, so hieß es.
Am Hochzeittage selber schritt der Admiral, statt der Messe beizuwohnen, auf dem Platze der Notredame in gemessenem Gange auf und nieder und[81] sprach, er der sonst so Vorsichtige, ein Wort aus, das in bitterster Feindseligkeit gegen ihn ausgebeutet wurde. »Notredame,« sagte er, »ist mit den Fahnen behängt, die man uns im Bürgerkrieg abgenommen; sie müssen weg und ehrenvollere Trophäen an ihre Stelle!« Damit meinte er spanische Fahnen, aber das Wort wurde falsch gedeutet.
Coligny sandte mich mit einem Auftrage nach Orleans, wo deutsche Reiterei lag. Als ich von dort zurückkehrte und meine Wohnung betrat, kam mir Gilbert mit entstellter Miene entgegen.
»Wißt Ihr schon, Herr Hauptmann,« jammerte er, »daß der Admiral gestern meuchlerisch verwundet worden ist, als er aus dem Louvre nach seinem Palaste zurückkehrte? Nicht tötlich, sagt man; aber bei seinem Alter und der kummervollen Sorge, die auf ihm lastet, wer kann wissen, wie das endet! Und stirbt er, was soll aus uns werden?« –
Ich begab mich schleunig nach der Wohnung des Admirals, wo ich abgewiesen wurde. Der Pförtner sagte mir, es sei hoher Besuch im Hause, der König und die Königin Mutter. Dies beruhigte mich, da ich in meiner Arglosigkeit daraus schloß, unmöglich könne Katharina an der Untat Anteil haben, wenn sie selbst das Opfer besuche. Der König aber, versicherte der Pförtner, sei wütend über den tückischen Angriff auf das Leben seines väterlichen Freundes.
Jetzt wandte ich meine Schritte zurück nach der Wohnung des Parlamentrats, den ich in lebhaftem Gespräche mit einer merkwürdigen Persönlichkeit fand, einem Manne in mittleren Jahren, dessen bewegtes Geberdenspiel den Südfranzosen verriet und der den St. Michaelsorden trug. Noch nie hatte ich in klugere Augen geblickt. Sie leuchteten von Geist, und in den zahllosen Falten und Linien um Augen und Mund bewegte sich ein unruhiges Spiel schalkhafter und scharfsinniger Gedanken.
»Gut, daß Ihr kommt, Schadau!« rief mir der Rat entgegen, während ich unwillkürlich das unschuldige Antlitz Gaspardes, in dem nur die Lauterkeit einer einfachen und starken Seele sich spiegelte, mit der weltklugen Miene des Gastes verglich, »gut, daß Ihr kommt! Herr Montaigne will mich mit Gewalt nach seinem Schlosse in Perigord entführen …«
»Wir wollen dort den Horaz zusammen lesen,« warf der Fremdling ein, »wie wir es vor Zeiten in den Bädern von Aix taten, wo ich das Vergnügen hatte, den Herrn Rat kennen zu lernen.«
»Meint Ihr, Montaigne,« fuhr der Rat fort, »ich dürfe die Kinder allein lassen? Gasparde will sich nicht von ihrem Paten und dieser junge Berner sich nicht von Gasparde trennen.«
»Ei was,« spottete Herr Montaigne, sich gegen mich verbeugend, »sie werden, um sich in der Tugend[83] zu stärken, das Buch Tobiä zusammen lesen!« und den Ton wechselnd, da er mein ernstes Gesicht sah: »Kurz und gut,« schloß er, »Ihr kommt mit mir, lieber Rat!«
»Ist denn eine Verschwörung gegen uns Hugenotten im Werke?« fragte ich, aufmerksam werdend.
»Eine Verschwörung?« wiederholte der Gascogner. »Nicht daß ich wüßte! Wenn nicht etwa eine solche, wie sie die Wolken anzetteln, bevor ein Gewitter losbricht. Vier Fünfteile einer Nation von dem letzten Fünfteil zu etwas gezwungen, was sie nicht wollen – das heißt zum Kriege in Flandern – das kann die Atmosphäre schon elektrisch machen. Und, nehmt es mir nicht übel, junger Mann, Ihr Hugenotten verfehlt Euch gegen den ersten Satz der Lebensweisheit: daß man das Volk, unter dem man wohnt, nicht durch Mißachtung seiner Sitten beleidigen darf.«
»Rechnet Ihr die Religion zu den Sitten eines Volkes?« fragte ich entrüstet.
»In gewissem Sinne, ja,« meinte er, »doch diesmal dachte ich nur an die Gebräuche des täglichen Lebens: Ihr Hugenotten kleidet Euch düster, tragt ernsthafte Mienen, versteht keinen Scherz und seid so steif wie Eure Halskragen. Kurz, Ihr schließt Euch ab, und das bestraft sich in der größten Stadt wie auf dem kleinsten Dorfe! Da verstehn die Guisen das Leben besser! Eben kam ich vorüber,[84] als der Herzog Heinrich vor seinem Palaste abstieg und den umstehenden Bürgern die Hände schüttelte, lustig wie ein Franzose und gemütlich wie ein Deutscher! So ist es recht! Sind wir ja alle vom Weibe geboren, und ist doch die Seife nicht teuer!«
Mir schien, als ob der Gascogner schwere Besorgnis unter diesem scherzhaften Tone verberge, und ich wollte ihn weiter zur Rede stellen, als der alte Diener einen Boten des Admirals meldete, welcher mich und Gasparde unverzüglich zu sich berief.
Gasparde warf einen dichten Schleier über, und wir eilten.
Unterwegs erzählte sie mir, was sie in meiner Abwesenheit ausgestanden. »An deiner Seite durch einen Kugelregen zu reiten, wäre mir ein Spiel dagegen!« versicherte sie. »Der Pöbel in unsrer Straße ist so giftig geworden, daß ich das Haus nicht verlassen konnte, ohne mit Schimpfworten verfolgt zu werden. Kleidete ich mich nach meinem Stande, so schrie man mir nach: Seht die Übermütige! Legte ich schlichtes Gewand an, so hieß es: Seht die Heuchlerin! – Einen Tag oder eine Woche hielte man das schon aus; aber wenn man kein Ende davon absieht! – Unsere Lage hier in Paris erinnert mich an die jenes Italieners, den sein Feind in einen Kerker mit vier kleinen Fenstern werfen ließ. Als er am nächsten Morgen erwachte, waren deren nur[85] noch drei, am folgenden zwei, am dritten noch eins, kurz, er begriff, daß sein höllischer Feind ihn in eine Maschine gesperrt hatte, die sich allmählich in einen erdrückenden Sarg verwandelte.«
Unter diesen Reden waren wir in die Wohnung des Admirals gelangt, der uns sogleich zu sich beschied.
Er saß aufrecht auf seinem Lager, den verwundeten linken Arm in der Schlinge, blaß und ermattet. Neben ihm stand ein Geistlicher mit eisgrauem Barte. Er ließ uns nicht zu Worten kommen.
»Meine Zeit ist gemessen,« sprach er, »hört mich an und gehorcht mir! Du, Gasparde, bist mir durch meinen teuern Bruder blutverwandt. Es ist jetzt nicht der Augenblick, etwas zu verhüllen, das du weißt und diesem nicht verborgen bleiben darf. – Deiner Mutter ist durch einen Franzosen Unrecht geschehn; ich will nicht, daß auch du unsres Volkes Sünden mitbüßest. Wir bezahlen, was unsre Väter verschuldet haben. Du aber sollst, so viel solches an mir liegt, auf deutscher Erde ein frommes und ruhiges Leben führen.«
Dann sich zu mir wendend, fuhr er fort: »Schadau, Ihr werdet Eure Kriegsschule nicht unter mir durchmachen. Hier sieht es dunkel aus. Mein Leben geht zur Neige, und mein Tod ist der Bürgerkrieg. Mischt Euch nicht darein, ich verbiete es Euch. – Reicht Gasparde die Hand, ich gebe sie Euch zum[86] Weibe. Führt sie ohne Säumnis in Eure Heimat. Verlaßt dieses ungesegnete Frankreich, sobald Ihr meinen Tod erfahrt. Bereitet ihr eine Stätte auf Schweizerboden; dann nehmt Dienste unter dem Prinzen von Oranien und kämpft für die gute Sache!« –
Jetzt winkte er dem Greise und forderte ihn auf, uns zu trauen.
»Macht es kurz,« flüsterte er, »ich bin müde und bedarf der Ruhe.«
Wir ließen uns an seinem Lager auf die Kniee nieder, und der Geistliche verrichtete sein Amt, unsre Hände zusammenfügend und die liturgischen Worte aus dem Gedächtnisse sprechend.
Dann segnete uns der Admiral mit seiner ebenfalls verstümmelten Rechten.
»Lebt wohl!« schloß er, legte sich nieder und kehrte sein Antlitz gegen die Wand.
Da wir zögerten, das Gemach zu verlassen, hörten wir noch die gleichmäßigen Atemzüge des ruhig Entschlummerten.
Schweigend und in wunderbarer Stimmung kamen wir zurück und fanden Chatillon noch in lebhaftem Gespräche mit Herrn Montaigne.
»Gewonnen Spiel!« jubelte dieser, »der Papa willigt ein, und ich selbst will ihm seinen Koffer packen; denn darauf verstehe ich mich vortrefflich.« –
»Geht, lieber Oheim!« mahnte Gasparde, »und macht Euch keine Sorge um mich. Das ist von nun an die Sache meines Gemahls.« Und sie drückte meine Hand an ihre Brust. Auch ich drang in den Rat, mit Montaigne zu verreisen.
Da mit einem Male, wie wir Alle ihm zuredeten und ihn überzeugt glaubten, fragte er: »Hat der Admiral Paris verlassen?« Und als er hörte, Coligny bleibe und werde trotz des Drängens der Seinigen bleiben, auch wenn sein Zustand die Abreise erlauben sollte, da rief Chatillon mit glänzenden Augen und mit einer festen Stimme, die ich an ihm kannte:
»So bleibe auch ich! Ich bin im Leben oftmals feig und selbstsüchtig gewesen; ich stand nicht zu meinen Glaubensgenossen, wie ich sollte; in dieser letzten Stunde aber will ich sie nicht verlassen.«
Montaigne biß sich die Lippe. Unser Aller Zureden fruchtete nun nichts mehr, der Alte blieb bei seinem Entschlusse.
Jetzt klopfte ihm der Gascogner auf die Schulter und sagte mit einem Anfluge von Hohn:
»Alter Junge, du betrügst dich selbst, wenn du glaubst, daß du aus Heldenmut so handelst. Du tust es aus Bequemlichkeit. Du bist zu träge geworden, dein behagliches Nest zu verlassen, selbst auf die Gefahr hin, daß der Sturm es morgen wegfegt.[88] Das ist auch ein Standpunkt, und in deiner Weise hast du Recht.«
Jetzt verwandelte sich der spöttische Ausdruck auf seinem Gesichte in einen tief schmerzlichen, er umarmte Chatillon, küßte ihn und schied eilig.
Der Rat, welcher seltsam bewegt war, wünschte allein zu sein.
»Verlaßt mich, Schadau!« sagte er, mir die Hand drückend, »und kommt heute Abend noch einmal vor Schlafengehen.« –
Gasparde, die mich begleitete, ergriff unter der Türe plötzlich das Reisepistol, das noch in meinem Gürtel stak.
»Laß das!« warnte ich. »Es ist scharf geladen.«
»Nein,« lachte sie, den Kopf zurückwerfend, »ich behalte es als Unterpfand, daß du uns diesen Abend nicht versäumst!« und sie entfloh damit ins Haus.

Auf meinem Zimmer lag ein Brief meines Oheims im gewohnten Format, mit den wohlbekannten altmodischen Zügen überschrieben. Der rote Abdruck des Siegels mit seiner Devise: Pèlerin et Voyageur! war diesmal unmäßig groß geraten.
Noch hielt ich das Schreiben uneröffnet in der Hand, als Boccard ohne anzuklopfen hereinstürzte.
»Hast du dein Versprechen vergessen, Schadau?« rief er mir zu.
»Welches Versprechen?« fragte ich mißmutig.
»Schön!« versetzte er mit einem kurzen Lachen, das gezwungen klang. »Wenn das so fortgeht, so wirst du nächstens deinen eignen Namen vergessen! Am Vorabende deiner Abreise nach Orleans, in der Schenke zum Mohren, hast du mir feierlich gelobt, dein längst gegebenes Versprechen zu lösen und unsern Hauptmann Pfyffer einmal zu begrüßen. Ich lud dich dann in seinem Auftrage zu seinem Namensfeste in das Louvre ein.
Heute nun ist Bartholomäustag. Der Hauptmann hat zwar viele Namen, wohl acht bis zehn; da aber unter diesen allen der geschundene Barthel in seinen Augen der größte Heilige und Märtyrer ist, so feiert er als guter Christ diesen Tag in besonderer Weise. Bliebest du weg, er legte dir's als hugenottischen Starrsinn aus.« –
Ich besann mich freilich, von Boccard häufig mit solchen Einladungen bestürmt worden zu sein und ihn von Woche zu Woche vertröstet zu haben. Daß ich ihm auf heute zugesagt, war mir nicht erinnerlich, aber es konnte sein.
»Boccard,« sagte ich, »heute ist mir's ungelegen.[90] Entschuldige mich bei Pfyffer und laß mich zu Hause.«
Nun aber begann er, auf die wunderlichste Weise in mich zu dringen, jetzt scherzend und kindischen Unsinn vorbringend, jetzt flehentlich mich beschwörend. Zuletzt fuhr er auf:
»Wie? Hältst du so dein Ehrenwort?« – Und unsicher wie ich war, ob ich nicht doch vielleicht mein Wort gegeben, konnte ich diesen Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen und willigte endlich, wenn auch bitter ungern, ein, ihn zu begleiten. Ich marktete, bis er versprach, in einer Stunde mich freizugeben, und wir gingen nach dem Louvre.
Paris war ruhig. Wir trafen nur einzelne Gruppen von Bürgern, die sich über den Zustand des Admirals flüsternd besprachen.
Pfyffer hatte ein Gemach zu ebener Erde im großen Hofe zu Louvre inne. Ich war erstaunt, seine Fenster nur spärlich erleuchtet zu sehen und Totenstille zu finden statt eines fröhlichen Festlärms. Wie wir eintraten, stand der Hauptmann allein in der Mitte des Zimmers, vom Kopfe bis zu den Füßen bewaffnet und in eine Depesche vertieft, die er aufmerksam zu lesen, ja zu buchstabieren schien, denn er folgte den Zeilen mit dem Zeigefinger der linken Hand. Er wurde meiner ansichtig und, auf mich zutretend, fuhr er mich barsch an:
»Euern Degen, junger Herr! Ihr seid mein Gefangener.« – Gleichzeitig näherten sich zwei Schweizer, die im Schatten gestanden hatten. Ich trat einen Schritt zurück.
»Wer gibt Euch ein Recht an mich, Herr Hauptmann?« – rief ich aus. »Ich bin der Schreiber des Admirals.«
Ohne mich einer Antwort zu würdigen, griff er mit eigner Hand nach meinem Degen und bemächtigte sich desselben. Die Überraschung hatte mich so außer Fassung gebracht, daß ich an keinen Widerstand dachte.
»Tut Eure Pflicht!« befahl Pfyffer. Die beiden Schweizer nahmen mich in die Mitte, und ich folgte ihnen wehrlos, einen Blick grimmigen Vorwurfs auf Boccard werfend. Ich konnte mir nichts anders denken, als daß Pfyffer einen königlichen Befehl erhalten habe, mich wegen meines Zweikampfes mit Guiche in Haft zu nehmen.
Zu meinem Erstaunen wurde ich nur wenige Schritte weit nach der mir wohlbekannten Kammer Boccards geführt. Der eine Schweizer zog einen Schlüssel hervor und versuchte zu öffnen, aber vergeblich. Es schien ihm in der Eile ein unrechter übergeben worden zu sein, und er sandte seinen Kameraden zurück, um von Boccard, der bei Pfyffer geblieben war, den rechten zu fordern.
In dieser kurzen Frist vernahm ich lauschend die rauhe, scheltende Stimme des Hauptmanns: »Euer freches Stücklein kann mich meine Stelle kosten! In dieser Teufelsnacht wird uns hoffentlich keiner zur Rede stellen, doch wie bringen wir morgen den Ketzer aus dem Louvre fort? Die Heiligen mögen mir's verzeihn, daß ich einem Hugenotten das Leben rette – aber einen Landsmann und Bürger von Bern dürfen wir von diesen verfluchten Franzosen auch nicht abschlachten lassen – da habt Ihr wiederum Recht, Boccard …«
Jetzt ging die Türe auf, ich stand in dem dunklen Gelaß, der Schlüssel wurde hinter mir gedreht und ein schwerer Riegel vorgeschoben.
Ich durchmaß das mir von manchem Besuche her wohlbekannte Gemach, in quälenden Gedanken auf und nieder schreitend, während sich das mit Eisenstäben vergitterte, hochgelegene Fenster allmählich erhellte, denn der Mond ging auf. Der einzige wahrscheinliche Grund meiner Verhaftung, ich mochte die Sache wenden, wie ich wollte, war und blieb der Zweikampf. Unerklärlich waren mir freilich Pfyffers unmutige letzte Worte; aber ich konnte dieselben mißhört haben, oder der tapfere Hauptmann war etwas bezecht. Noch unbegreiflicher, ja haarsträubend erschien mir das Benehmen Boccards, dem ich nie und nimmer einen so schmählichen Verrat zugetraut hätte.
Je länger ich die Sache übersann, in desto beunruhigendere Zweifel und unlösbarere Widersprüche verstrickte ich mich.
Sollte wirklich ein blutiger Plan gegen die Hugenotten bestehn? War das denkbar? Konnte der König, wenn er nicht von Sinnen war, in die Vernichtung einer Partei willigen, deren Untergang ihn zum willenlosen Sklaven seiner ehrgeizigen Vettern von Lothringen machen mußte?
Oder war ein neuer Anschlag auf die Person des Admirals geschmiedet, und wollte man einen seiner treuen Diener von ihm entfernen? Aber ich erschien mir zu unbedeutend, als daß man zuerst an mich gedacht hätte. Der König hatte heftig gezürnt über die Verwundung des Admirals. Konnte ein Mensch, ohne dem Wahnsinne verfallen zu sein, von warmer Neigung zu stumpfer Gleichgültigkeit oder wildem Hasse in der Frist weniger Stunden übergehn?
Während ich so meinen Kopf zerarbeitete, schrie mein Herz, daß mein Weib mich zu dieser Stunde erwarte, die Minuten zähle, und ich hier gefangen sei, ohne ihr Nachricht geben zu können.
Noch immer schritt ich auf und nieder, als die Turmuhr des Louvre schlug; ich zählte zwölf Schläge. Es war Mitternacht. Da kam mir der Gedanke, einen Stuhl an das hohe Fenster zu rücken, in die Nische zu steigen, es zu öffnen und, an die Eisenstäbe[94] mich anklammernd, in die Nacht auszuschauen. Das Fenster blickte auf die Seine. Alles war still. Schon wollte ich wieder ins Gemach herunterspringen, als ich meinen Blick noch über mich richtete und vor Entsetzen erstarrte.
Rechts von mir, auf einem Balkon des ersten Stockwerks, so nahe, daß ich sie fast mit der Hand erreichen konnte, erblickte ich, vom Mondlicht taghell erleuchtet, drei über das Geländer vorgebeugte, lautlos lauschende Gestalten. Mir zunächst der König mit einem Antlitz, dessen nicht unedle Züge die Angst, die Wut, der Wahnsinn zu einem Höllenausdruck verzerrten. Kein Fiebertraum kann schrecklicher sein als diese Wirklichkeit. Jetzt, da ich das längst Vergangene niederschreibe, sehe ich den Unseligen wieder mit den Augen des Geistes – und ich schaudere. Neben ihm lehnte sein Bruder, der Herzog von Anjou, mit dem schlaffen, weibisch grausamen Gesichtchen, und schlotterte vor Furcht. Hinter ihnen, bleich und regungslos, die Gefaßteste von Allen, stand Katharina die Medicäerin mit halbgeschlossenen Augen und fast gleichgültiger Miene.
Jetzt machte der König, wie von Gewissensangst gepeinigt, eine krampfhafte Geberde, als wollte er einen gegebenen Befehl zurücknehmen, und in demselben Augenblicke knallte ein Büchsenschuß, mir schien im Hofe des Louvre.
»Endlich!« flüsterte die Königin erleichtert, und die drei Nachtgestalten verschwanden von der Zinne.
Eine nahe Glocke begann Sturm zu läuten, eine zweite, eine dritte heulte mit; greller Fackelschein glomm auf wie eine Feuersbrunst, Schüsse knatterten, und meine gespannte Einbildungskraft glaubte Sterbeseufzer zu vernehmen.
Der Admiral lag ermordet, daran konnte ich nicht mehr zweifeln. Aber was bedeuteten die Sturmglocken, die erst vereinzelt, dann immer häufiger fallenden Schüsse, die Mordrufe, die jetzt von fern an mein lauschendes Ohr drangen? Geschah das Unerhörte? Wurden alle Hugenotten in Paris gemeuchelt?
Und Gasparde, meine mir vom Admiral anvertraute Gasparde, war mit dem wehrlosen Alten diesen Schrecken preisgegeben! Das Haar stand mir zu Berge, das Blut gerann mir in den Adern. Ich rüttelte an der Türe aus allen Kräften, die eisernen Schlösser und das schwere Eichenholz wichen nicht. Ich suchte tastend nach einer Waffe, nach einem Werkzeuge, um sie zu sprengen, und fand keines. Ich schlug mit den Fäusten, stieß mit den Füßen gegen die Türe und schrie nach Befreiung – draußen im Gange blieb es totenstill.
Wieder schwang ich mich auf in die Fensternische und rüttelte wie ein Verzweifelter an dem Eisengitter, es war nicht zu erschüttern.
Ein Fieberfrost ergriff mich und meine Zähne schlugen auf einander. Dem Wahnsinne nahe warf ich mich auf Boccards Lager und wälzte mich in tötlicher Bangigkeit. Endlich, als der Morgen zu grauen begann, verfiel ich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlummern, der sich nicht beschreiben läßt. Ich meinte mich noch an die Eisenstäbe zu klammern und hinaus zu blicken auf die rastlos flutende Seine. Da plötzlich erhob sich aus ihren Wellen ein halbnacktes, vom Mondlichte beglänztes Weib, eine Flußgöttin, auf ihre sprudelnde Urne gestützt, wie sie in Fontainebleau an den Wasserkünsten sitzen, und begann zu sprechen. Aber ihre Worte richteten sich nicht an mich, sondern an eine Steinfrau, die dicht neben mir die Zinne trug, auf welcher die drei fürstlichen Verschwörer gestanden.
»Schwester,« frug sie aus dem Flusse, »weißt vielleicht du, warum sie sich morden? Sie werfen mir Leichnam auf Leichnam in mein strömendes Bett, und ich bin schmierig von Blut. Pfui, pfui! Machen vielleicht die Bettler, die ich abends ihre Lumpen in meinem Wasser waschen sehe, den Reichen den Garaus?«
»Nein,« raunte das steinerne Weib, »sie morden sich, weil sie nicht einig sind über den richtigen Weg zur Seligkeit.« – Und ihr kaltes Antlitz verzog sich zum Hohn, als belache sie eine ungeheure Dummheit …
In diesem Augenblicke knarrte die Türe, ich fuhr auf aus meinem Halbschlummer und erblickte Boccard, blaß und ernst, wie ich ihn noch nie gesehen hatte, und hinter ihm zwei seiner Leute, von welchen einer einen Laib Brot und eine Kanne Wein trug.
»Um Gotteswillen, Boccard,« rief ich und stürzte ihm entgegen, »was ist heute Nacht vorgegangen? … Sprich!«
Er ergriff meine Hand und wollte sich zu mir auf das Lager setzen. Ich sträubte mich und beschwor ihn zu reden.
»Beruhige dich!« sagte er. »Es war eine schlimme Nacht. Wir Schweizer können nichts dafür, der König hat es befohlen.«
»Der Admiral ist tot?« frug ich, ihn starr ansehend.
Er bejahte mit einer Bewegung des Hauptes.
»Und die andern hugenottischen Führer?«
»Tot. Wenn nicht der eine oder andere, wie der Navarrese, durch besondere Gunst des Königs verschont blieb.«
»Ist das Blutbad beendigt?«
»Nein, noch wütet es fort in den Straßen von Paris. Kein Hugenott darf am Leben bleiben.«
Jetzt zuckte mir der Gedanke an Gasparde wie ein glühender Blitz durchs Gehirn, und alles andere verschwand im Dunkel.
»Laß mich!« schrie ich. »Mein Weib! mein armes Weib!«
Boccard sah mich erstaunt und fragend an. »Dein Weib? Bist du verheiratet?«
»Gib Raum, Unseliger!« rief ich und warf mich auf ihn, der mir den Ausweg vertrat. Wir rangen miteinander, und ich hätte ihn übermannt, wenn nicht einer seiner Schweizer ihm zu Hilfe gekommen wäre, indeß der andere die Türe bewachte.
Ich wurde auf das Knie gedrückt.
»Boccard!« stöhnte ich. »Im Namen des barmherzigen Gottes – bei Allem, was dir teuer ist – bei dem Haupte deines Vaters – bei der Seligkeit deiner Mutter – erbarm' dich meiner und laß mich frei! Ich sage dir, Mensch, daß mein Weib da draußen ist – daß sie vielleicht in diesem Augenblicke gemordet – daß sie vielleicht in diesem Augenblicke mißhandelt wird! Oh, oh!« – und ich schlug mit geballter Faust gegen die Stirn.
Boccard erwiderte begütigend, wie man mit einem Kranken spricht: »Du bist von Sinnen, armer Freund! Du könntest nicht fünf Schritte ins Freie tun, bevor dich eine Kugel niederstreckte! Jedermann kennt dich als den Schreiber des Admirals. Nimm Vernunft an! Was du verlangst, ist unmöglich.« –
Jetzt begann ich, auf den Knieen liegend, zu schluchzen wie ein Kind.
Noch einmal, halb bewußtlos wie ein Ertrinkender, erhob ich das Auge nach Rettung, während Boccard schweigend die im Ringen zerrissene Seidenschnur wieder zusammenknüpfte, an der die Silbermünze mit dem Bildnis der Madonna tief niederhing.
»Im Namen der Muttergottes von Einsiedeln!« – flehte ich mit gefalteten Händen.
Jetzt stand Boccard wie gebannt, die Augen nach oben gewendet und etwas murmelnd wie ein Gebet. Dann berührte er das Medaillon mit den Lippen und schob es sorgfältig wieder in sein Wams.
Noch schwiegen wir Beide, da trat, eine Depesche emporhaltend, ein junger Fähndrich ein.
»Im Namen des Königs und auf Befehl des Hauptmanns,« sagte er, »nehmt zwei Eurer Leute, Herr Boccard, und überbringt eigenhändig diese Ordre dem Kommandanten der Bastille.« – Der Fähndrich trat ab.
Jetzt eilte Boccard, nach einem Augenblicke des Besinnens, das Schreiben in der Hand, auf mich zu:
»Tausche schnell die Kleider mit Cattani hier!« flüsterte er. »Ich will es wagen. Wo wohnt sie?«
»Isle St. Louis.«
»Gut. Labe dich noch mit einem Trunke, du hast Kraft nötig.«
Nachdem ich eilig meiner Kleider mich entledigt,[100] warf ich mich in die Tracht eines königlichen Schweizers, gürtete das Schwert um, ergriff die Hallebarde, und Boccard, ich und der zweite Schweizer, wir stürzten ins Freie.

Schon im Hofe des Louvre bot sich meinen Augen ein schrecklicher Anblick. Die Hugenotten vom Gefolge des Königs von Navarra lagen hier, frisch getötet, manche noch röchelnd, in Haufen übereinander. Längs der Seine weiter eilend begegneten wir auf jedem Schritte einem Gräuel. Hier lag ein armer Alter mit gespaltetem Schädel in seinem Blute, dort sträubte sich ein totenblasses Weib in den Armen eines rohen Lanzenknechts. Eine Gasse lag still wie das Grab, aus einer andern erschollen noch Hilferufe und mißtönige Sterbeseufzer.
Ich aber, unempfindlich für diese unfaßbare Größe des Elends, stürmte wie ein Verzweifelter vorwärts, so daß mir Boccard und der Schweizer kaum zu folgen vermochten. Endlich war die Brücke erreicht und überschritten. Ich stürzte in vollem Laufe nach dem Hause des Rats, die Augen unverwandt auf seine hochgelegenen Fenster geheftet. An einem derselben wurden ringende Arme sichtbar, eine menschliche[101] Gestalt mit weißen Haaren ward hinausgedrängt. Der Unglückliche, es war Chatillon, klammerte sich einen Augenblick noch mit schwachen Händen an das Gesims, dann ließ er es los und stürzte auf das Pflaster. An dem Zerschmetterten vorüber erklomm ich in wenigen Sprüngen die Treppe und stürzte in das Gemach. Es war mit Bewaffneten gefüllt, und ein wilder Lärm erscholl aus der offenen Türe des Bibliothekzimmers. Ich bahnte mir mit meiner Hallebarde den Weg und erblickte Gasparde, in eine Ecke gedrängt und von einer gierigen, brüllenden Meute umstellt, die sie, mein Pistol in der Hand und bald auf diesen, bald auf jenen zielend, von sich abhielt. Sie war farblos wie ein Wachsbild, und aus ihren weit geöffneten blauen Augen sprühte ein schreckliches Feuer.
Alles vor mir niederwerfend, mit einem einzigen Anlaufe, war ich an ihrer Seite und »Gott sei Dank, du bist es!« rief sie noch und sank mir dann bewußtlos in die Arme.
Unterdessen war Boccard mit dem Schweizer nachgedrungen. »Leute!« drohte er, »im Namen des Königs verbiete ich euch, diese Dame nur mit einem Finger zu berühren! Zurück, wem sein Leben lieb ist! Ich habe Befehl, sie ins Louvre zu bringen!«
Er war neben mich getreten, und ich hatte die ohnmächtige Gasparde in den Lehnstuhl des Rats gelegt.
Da sprang aus dem Getümmel ein scheußlicher Mensch mit blutigen Händen und blutbeflecktem Gesichte hervor, in dem ich den vervehmten Lignerolles erkannte.
»Lug und Trug!« schrie er, »das, Schweizer? – Verkappte Hugenotten sind's und von der schlimmsten Sorte! Dieser hier – ich kenne dich wohl, vierschrötiger Halunke – hat den frommen Grafen Guiche gemordet, und jener war dabei. Schlagt tot! Es ist ein verdienstliches Werk, diese schurkischen Ketzer zu vertilgen! Aber rührt mir das Mädel nicht an – die ist mein!« –
Und der Verwilderte warf sich wütend auf mich.
»Bösewicht,« rief Boccard, »dein Stündlein ist gekommen! Stoß zu, Schadau!« Rasch drängte er mit geschickter Parade die ruchlose Klinge in die Höhe, und ich stieß dem Buben mein Schwert bis an das Heft in die Brust. Er stürzte.
Ein rasendes Geheul erhob sich aus der Rotte.
»Weg von hier!« winkte mir der Freund. »Nimm dein Weib auf den Arm und folge mir!«
Jetzt griffen Boccard und der Schweizer mit Hieb und Stoß das Gesindel an, das uns von der Türe trennte, und brachen eine Gasse, durch die ich, Gasparde tragend, schleunig nachschritt.
Wir gelangten glücklich die Treppen hinunter und betraten die Straße. Hier hatten wir vielleicht zehn[103] Schritte getan, da fiel ein Schuß aus einem Fenster. Boccard schwankte, griff mit unsicherer Hand nach dem Medaillon, riß es hervor, drückte es an die erblassenden Lippen und sank nieder.
Er war durch die Schläfe getroffen. Der erste Blick überzeugte mich, daß ich ihn verloren hatte, der zweite, nach dem Fenster gerichtete, daß ihn der Tod aus meinem Reiterpistol getroffen, welches Gaspardes Hand entfallen war und das jetzt der Mörder frohlockend emporhielt. Die scheußliche Horde an den Fersen, riß ich mich mit blutendem Herzen von dem Freunde los, bei dem sein treuer Soldat niederkniete, bog um die nahe Ecke in das Seitengäßchen, wo meine Wohnung gelegen war, erreichte sie unbemerkt und eilte durch das abgestorbene Haus mit Gasparde hinauf in meine Kammer.
Auf dem Flur des ersten Stockwerkes schritt ich durch breite Blutlachen. Der Schneider lag ermordet, sein Weib und seine vier Kinder, am Herd in ein Häuflein zusammengesunken, schliefen den Todesschlummer. Selbst der kleine Pudel, des Hauses Liebling, lag verendet bei ihnen. Blutgeruch erfüllte das Haus. Die letzte Treppe ersteigend, sah ich mein Zimmer offen, die halbzerschmetterte Türe schlug der Wind auf und zu.
Hier hatten die Mörder, da sie mein Lager leer fanden, nicht lange geweilt, das ärmliche Aussehen[104] meiner Kammer versprach ihnen keine Beute. Meine wenigen Bücher lagen zerrissen auf dem Boden zerstreut, in eines derselben hatte ich, als mich Boccard überraschte, den Brief meines Ohms geborgen, er war herausgefallen und ich steckte ihn zu mir. Meine kleine Barschaft trug ich noch von der Reise her in einem Gurt auf dem Leibe.
Ich hatte Gasparde auf mein Lager gebettet, wo die Bleiche zu schlummern schien, und stand neben ihr, überlegend, was zu tun sei. Sie war unscheinbar wie eine Dienerin gekleidet, wohl in der Absicht, mit ihrem Pflegevater zu fliehen. Ich trug die Tracht der Schweizergarde.
Ein wilder Schmerz bemächtigte sich meiner über all das frevelhaft vergossene teure und unschuldige Blut. »Fort aus dieser Hölle!« sprach ich halblaut vor mich hin.
»Ja, fort aus dieser Hölle!« wiederholte Gasparde, die Augen öffnend und sich auf dem Lager in die Höhe richtend. »Hier ist unsres Bleibens nicht! Zum ersten, nächsten Tore hinaus!«
»Bleibe noch ruhig!« erwiderte ich. »Unterdessen wird es Abend und die Dämmerung erleichtert uns vielleicht das Entrinnen.«
»Nein, nein,« versetzte sie bestimmt, »keinen Augenblick länger bleibe ich in diesem Pfuhl! Was liegt am Leben, wenn wir zusammen sterben! Laß[105] uns geradenwegs auf das nächste Tor zugehn. Werden wir überfallen und wollen sie mich mißhandeln, so erstichst du mich, und erschlägst ihrer zwei oder drei, so sterben wir nicht ungerächt. – Versprich mir das!«
Nach einigem Überlegen willigte ich ein, da es auch mir besser schien, um jeden Preis der Not ein Ende zu machen. Konnte doch der Mord morgen von neuem beginnen, waren doch die Tore nachts strenger bewacht als am Tage.
Wir machten uns auf den Weg, durch die blutgetränkten Gassen langsam neben einander wandelnd unter einem wolkenlosen, dunkelblauen Augusthimmel.
Unangefochten erreichten wir das Tor.
Im Torwege vor dem Pförtchen der Wachtstube stand mit verschränkten Armen ein lothringischer Kriegsmann mit der Feldbinde der Guisen, der uns mit stechendem Blicke musterte.
»Zwei wunderliche Vögel!« lachte er. »Wo hinaus, Herr Schweizer, mit Euerm Schwesterchen?«
Das Schwert lockernd schritt ich näher, entschlossen ihm die Brust zu durchbohren; denn ich war des Lebens und der Lüge müde.
»Bei den Hörnern des Satans! Seid Ihr es, Herr Schadau?« sagte der lothringische Hauptmann, bei dem letzten Worte seine Stimme dämpfend. »Tretet ein, hier stört uns niemand.«
Ich blickte ihm ins Gesicht und suchte mich zu erinnern. Mein ehemaliger böhmischer Fechtmeister tauchte mir auf.
»Ja freilich bin ich es,« fuhr er fort, da er meinen Gedanken mir im Auge las, »und bin's, wie mir dünkt, zur gelegenen Stunde.«
Mit diesen Worten zog er mich in die Stube, und Gasparde folgte.
In dem dumpfigen Raume lagen auf einer Bank zwei betrunkene Kriegsknechte, Würfel und Becher neben ihnen am Boden.
»Auf, ihr Hunde!« fuhr sie der Hauptmann an. Der eine erhob sich mühsam. Er packte ihn am Arme und stieß ihn vor die Türe mit den Worten: »Auf die Wache, Schuft! Du bürgst mir mit deinem Leben, daß niemand passiert!« – Den andern, der nur einen grunzenden Ton von sich gegeben hatte, warf er von der Bank und stieß ihn mit dem Fuße unter dieselbe, wo er ruhig fortschnarchte.
»Jetzt belieben die Herrschaften Platz zu nehmen!« und er zeigte mit einer kavaliermäßigen Handbewegung auf den schmutzigen Sitz.
Wir ließen uns nieder, er rückte einen zerbrochenen Stuhl herbei, setzte sich rittlings darauf, den Ellbogen auf die Lehne stützend, und begann in familiärem Tone:
»Nun laßt uns plaudern! Euer Fall ist mir klar,[107] Ihr braucht ihn mir nicht zu erläutern. Ihr wünscht einen Paß nach der Schweiz, nicht wahr? – Ich rechne es mir zur Ehre, Euch einen Gegendienst zu leisten für die Gefälligkeit, mit der Ihr mir seinerzeit das schöne württembergische Siegel gezeigt habt, weil Ihr wußtet, ich sei ein Kenner. Eine Hand wäscht die andere. Siegel gegen Siegel. Diesmal kann ich Euch mit einem aushelfen.«
Er kramte in seiner Brusttasche und zog mehrere Papiere heraus.
»Seht, als ein vorsichtiger Mann ließ ich mir für alle Fälle von meinem gnädigen Herzog Heinrich für mich und meine Leute, die wir gestern Nacht dem Admiral unsre Aufwartung machten,« diese Worte begleitete er mit einer Mordgeberde, vor der mir schauderte, »die nötigen Reisepapiere geben. Der Streich konnte fehlen. Nun, die Heiligen haben sich dieser guten Stadt Paris angenommen! – Einer der Pässe – hier ist er – lautet auf einen beurlaubten königlichen Schweizer, den Fourier Koch. Steckt ihn zu Euch! er gewährt Euch freie Straße durch Lothringen an die Schweizer Grenze. Das wäre nun in Ordnung. – Was das Fortkommen mit Euerm Schätzchen betrifft, zu dem ich Euch, ohne Schmeichelei, Glück wünsche,« hier verneigte er sich gegen Gasparde, »so wird die schöne Dame schwerlich gut zu Fuße sein. Da kann ich Euch denn[108] zwei Gäule abtreten, einen sogar mit Damensattel – denn auch ich bin nicht ungeliebt und pflege selbander zu reiten. Ihr gebt mir dafür vierzig Goldgulden, bar, wenn Ihr es bei Euch habt, sonst genügt mir Euer Ehrenwort. Sie sind etwas abgejagt, denn wir wurden Hals über Kopf nach Paris aufgeboten; aber bis an die Grenze werden sie noch dauern.« Und er rief durch das Fensterchen einem Stalljungen, der am Tore herumlungerte, den Befehl zu, schleunig zu satteln.
Während ich ihm das Geld, fast mein ganzes Besitztum, auf die Bank vorzählte, sagte der Böhme:
»Ich habe mit Vergnügen vernommen, daß Ihr Euerm Fechtmeister Ehre gemacht habt. Freund Lignerolles hat mir alles erzählt. Er wußte Euern Namen nicht, aber ich erkannte Euch gleich aus seiner Beschreibung. Ihr habt den Guiche erstochen! Alle Wetter, das will etwas heißen. Ich hätte Euch das nie zugetraut. Freilich meinte Lignerolles, Ihr hättet euch die Brust etwas gepanzert. Das sieht Euch nicht gleich, doch zuletzt hilft sich jeder, wie er kann.«
Während dieses grausigen Geplauders saß Gasparde stumm und bleich. Jetzt wurden die Tiere vorgeführt, der Böhme half ihr, die unter seiner Berührung zusammenschrak, kunstgerecht in den Sattel, ich schwang mich auf das andere Roß, der[109] Hauptmann grüßte, und wir sprengten durch den hallenden Torweg und über die donnernde Brücke gerettet von dannen.

Zwei Wochen später, an einem frischen Herbstmorgen ritt ich mit meinem jungen Weibe die letzte Höhe des Gebirgszuges hinan, der die Freigrafschaft von dem neuenburgischen Gebiete trennt. Der Grat war erklommen, wir ließen unsre Pferde grasen und setzten uns auf ein Felsstück.
Eine weite, friedliche Landschaft lag in der Morgensonne vor uns ausgebreitet. Zu unsern Füßen leuchteten die Seen von Neuenburg, Murten und Biel; weiterhin dehnte sich das frischgrüne Hochland von Fryburg mit seinen schönen Hügellinien und dunkeln Waldsäumen; die eben sich entschleiernden Hochgebirge bildeten den lichten Hintergrund.
»Dies schöne Land also ist deine Heimat und endlich evangelischer Boden?« fragte Gasparde.
Ich zeigte ihr links das in der Sonne blitzende Türmchen des Schlosses Chaumont.
»Dort wohnt mein guter Ohm. Noch ein paar Stunden, und er heißt dich als sein geliebtes Kind willkommen! – Hier unten an den Seen ist evangelisches[110] Land, aber dort drüben, wo du die Turmspitzen von Fryburg erkennen kannst, beginnt das katholische.« –
Als ich Fryburg nannte, verfiel Gasparde in Gedanken. »Boccards Heimat!« sagte sie dann. »Erinnerst du dich noch, wie froh er an jenem Abende war, als wir uns zum ersten Male bei Melun begegneten! Nun erwartet ihn sein Vater vergebens, – und für mich ist er gestorben.«
Schwere Tropfen sanken von ihren Wimpern.
Ich antwortete nicht, aber blitzschnell zog an meiner Seele die Geschichte der verhängnisvollen Verkettung meines Loses mit dem meines heitern Landsmannes vorüber, und meine Gedanken verklagten und entschuldigten sich unter einander.
Unwillkürlich griff ich an meine Brust auf die Stelle, wo Boccards Medaille mir den Todesstoß aufgehalten hatte.
Es knisterte in meinem Wams wie Papier; ich zog den vergessenen, noch ungelesenen Brief meines Ohms heraus und erbrach das unförmliche Siegel. Was ich las, versetzte mich in schmerzliches Erstaunen. Die Zeilen lauteten:
»Lieber Hans!
Wenn du dieses liesest, bin ich aus dem Leben oder vielmehr bin ich in das Leben gegangen.
Seit einigen Tagen fühle ich mich sehr schwach,[111] ohne gerade krank zu sein. In der Stille leg' ich ab Pilgerschuh' und Wanderstab. Dieweil ich noch die Feder führen kann, will ich Dir selbst meine Heimfahrt melden und den Brief an dich eigenhändig überschreiben, damit eine fremde Handschrift Dich nicht betrübe. – Bin ich hinüber, so hat der alte Jochem den Auftrag, ein Kreuz zu meinem Namen zu setzen und den Brief zu siegeln. Rot, nicht schwarz. Ziehe auch kein Trauergewand um mich an, denn ich bin in der Freude. Ich lasse Dir mein irdisches Gut, vergiß Du das himmlische nicht.
Dein treuer Ohm Renat.«
Daneben war mit ungeschickter Hand ein großes Kreuz gemalt. Ich kehrte mich ab und ließ meinen Tränen ihren Lauf. Dann erhob ich das Haupt und wandte mich zu Gasparde, die mit gefalteten Händen an meiner Seite stand, um sie in das verödete Haus meiner Jugend einzuführen.


Ernst von Wildenbruch wurde als Sohn des preußischen Konsuls von Wildenbruch am 3. Februar 1845 in Beiruth in Syrien geboren, und unter dem tiefblauen Himmel des Orients ist ihm die Kindheit dahingegangen, zuletzt am Goldenen Horn, als sein Vater zum Gesandten in Konstantinopel aufgerückt war. Später studierte Wildenbruch in Deutschland die Rechte, eine Tätigkeit, die durch die Feldzüge von 1866 und 1870 unterbrochen wurde. Als tapferer Offizier hat er an ihnen teilgenommen und die erfahrenen Eindrücke in seinen ersten gedruckten Arbeiten niedergelegt: den Heldenliedern »Vionville« und »Sedan«. Früh aber hatte der Referendar von Wildenbruch auf seinem kleinen Zimmer zu Frankfurt an der Oder Manuskripte anderer Art im Schubfach liegen, alles Verse, die niemand druckte, vor allem niemand sprach. Und sie sollten doch in die Menge klingen, denn es waren fünffüßige Jamben, Drama auf Drama.
Dann kam dem mehr als dreißig Jahre alten der erste Erfolg mit dem Trauerspiel »Die Karolinger«; er blieb ihm treu viele Jahre lang, ebbte dann ein wenig und lebte mit voller Gewalt wieder auf mit dem großen Doppeldrama »Heinrich und Heinrichs Geschlecht«. Keines dieser vielen Stücke steht in einer Linie mit dem besten, was Kleist oder Hebbel schufen. Aber sie sind alle erfüllt von dem Pulsschlag eines[115] echten Theaterbluts, sie glänzen oft im schillernden Gewande einer hinreißenden Pathetik und haben (so im »Christoph Marlow«) Untertöne eines tief lyrischen Empfindens. Mir scheint, Wildenbruch ist für das Drama hohen Stils das gleiche, wie Anzengruber für das bürgerliche Drama.
Und ebenso wie Anzengruber die volle Meisterschaft, die ihn zu den ersten gesellt, im Roman, in der Prosadichtung erreichte, so fand Wildenbruch sein Höchstes in der Novelle. Die »Franceska von Rimini« hat in dem Sturmgang ihrer Leidenschaft schlechthin kein Seitenstück in der deutschen Dichtung. Und viele andere Arbeiten stehn ihr nahe, wenn sie sie schon nicht erreichen. »Neid«, »Vizemama«, »Kindertränen« will ich nennen. Was diese drei Werke besonders verbindet, ist die heiße Liebe zum Kinde, das innige Erfassen seiner Art und oft auch seiner Tragik, das Wildenbruch eine ganz besondere Stellung in der Literatur der Gegenwart gibt. Auch die kleine Erzählung »Archambauld« läßt diesen Zug erkennen. Und indem sie vom Bosporus auf das Schlachtfeld von St. Privat führt, ist sie zugleich gewissermaßen symbolisch für die Art dieses deutschen Poeten, den ein seltsames Geschick unter Palmen zur Welt kommen ließ. In Berlin ist er am 15. Januar 1909 – uns viel zu früh – gestorben und seinem Wunsche gemäß in Weimar, nahe der Gruft Schillers und Goethes, bestattet worden.
Heinrich Spiero.

Archambauld.
Ein Blatt vom Lebensbaum.
Arnautköi (sprich Arnautkjö) – wer von denen, die dieses lesen, kennt den Ort? Denen, die ihn nicht kennen, darf man raten: seht ihn Euch an, er verdient's.
An der breiten, prachtvollen Wasserstraße, die Marmara-Meer und Schwarzes Meer verbindet, am Bosporus ist er gelegen, auf der europäischen Seite, halbwegs zwischen dem Goldenen Horn, dem Hafen Stambuls, in dem die Moscheen sich spiegeln, mit ihren Minarets, und Terapia, wo die Botschafter der Großmächte ihre Sommer-Residenzen hatten und auch heute noch haben. Das Ufer gegenüber ist die Küste Asiens.
Die Küste Asiens – das wollte den Söhnen des preußischen Gesandten, der mit seiner Familie in Arnautköi wohnte, damals noch kleinen Buben, anfänglich schwer in den Sinn: Asien – das hatten sie von ihrem Hauslehrer gelernt, war doch ein anderer Erdteil – einem anderen Erdteile muß man doch ansehn, daß es eben ein anderer ist – und[117] nun sah dieses Asien eigentlich nicht ein bißchen anders aus, als das Europa, darin sie wohnten.
Von ihrem Hauslehrer aber, der ein Erwecker junger Seelen war, wußten sie nicht nur, daß das Land da drüben Asien hieß, sondern auch, was dieses Asien einstmals für einen finsteren Schatten auf Europa geworfen hatte: da erzählte er ihnen von dem großen Perser-Könige Darius, der vor mehr als zweitausend Jahren gelebt hatte und mit einem Heere von vielen hunderttausend Mann über den Bosporus gezogen war, um sich die Völker von Europa zu unterwerfen.
Unweit Arnautköi, etwas mehr dem Schwarzen Meere zu, ist eine Stelle, wo der Bosporus sich verengt. Alte Wachttürme, von irgend einem alten Sultan erbaut, stehen dort. Rumili-Hissar heißt der Ort. Da führte er sie auf Spaziergängen hin und erklärte ihnen, daß, wenn jemand eine Brücke über ein Wasser schlägt, er danach ausschaut, wo das Wasser am schmalsten ist, und daß also zweifelsohne hier die Stelle sei, wo einstmals König Darius von Asien nach Europa herübergekommen war. Da war es den Knaben, indem sie seinen Worten lauschten und auf das Meer hinuntersahen, auf dem jetzt keine Brücke mehr lag, als würden die uralten Dinge noch einmal lebendig, als hörten sie das Stampfen der unzähligen Schritte, unter denen die Brücke[118] sich bog, das Schnauben der Rosse, das Rasseln von Wagen, und die Weltgeschichte stieg vor ihnen auf wie eine ungeheuere, gespenstische Gestalt.
Eines Tages aber, als sie von solchem Spaziergang nach Haus kamen, sollten sie erfahren, daß die Weltgeschichte kein Gespenst, sondern etwas Lebendiges ist und mit den Menschen weiterlebt: an dem Tage nämlich war zu ihrem Vater, dem preußischen Gesandten, ein Besuch gekommen, ein russischer General, der hieß Menschikoff, zu dem sie in das Zimmer geführt wurden, weil er ihnen die Hand geben wollte. Und als er das Haus wieder verlassen hatte, nahm ihre Mutter sie bei Seite, und das Gesicht ihrer Mutter, das sonst immer heiter war wie das einer mutigen Frau, war voller Sorge, und sie sagte: »Es wird einen Krieg geben, einen furchtbaren, zwischen den Russen und den Türken, die Engländer werden kommen und die Franzosen, und mit den Türken gegen die Russen kämpfen.« Und wie sie ihnen gesagt hatte, so geschah es, und nun, Wochen und Wochen, Monate und Monate lang kamen die Kriegsschiffe der Engländer und Franzosen, riesige Drei-Decker, denn eiserne Schiffe gab's damals noch nicht, vom Marmara-Meere heran, um nach dem Schwarzen Meer zu fahren. Und weil das Elternhaus der Knaben unmittelbar am Ufer des Meeres lag, so zogen all' die mächtigen[119] Fahrzeuge unmittelbar an ihnen vorüber. Da standen sie dann und rissen die Augen auf, wenn sie die Schiffe flimmern und leuchten sahen von den unzähligen Soldaten, mit denen sie gefüllt waren, englischen Soldaten in roten Röcken, französischen in blauen Röcken und roten Hosen, und wenn sie die Soldaten auf den Schiffsborden sitzen sahen und in den Strickleitern bis zu den Raaen der Maste hinauf. Und wenn sie sich erkundigten, wohin diese Männer alle zogen, schlug der Lehrer ihnen den Atlas auf, zeigte ihnen eine Halbinsel im Schwarzen Meere, die Krim, und auf der Halbinsel eine große russische Festung, Sewastopol, und diese Festung zu belagern und zu erstürmen, dahin zogen alle diese Männer.
Nun aber weiß jedermann, daß man zu einer Belagerung nicht nur Menschen, sondern auch Kanonen und Werkzeuge aller Art braucht. Um solches anzufertigen, wurden im Rücken der abziehenden Heere in Konstantinopel und an den Ufern des Bosporus Werkstätten angelegt, und eine solche Werkstätte der Franzosen befand sich ganz nah vom Elternhause der Knaben, in dem neben Arnautköi gelegenen Orte Kurú-Tschesme. An der Spitze dieser Werkstätte standen französische Offiziere, Artilleristen und Ingenieure, und unter diesen befand sich einer, der war ein Elsässer von Geburt. Diese Offiziere nun, höflich und gesellig, wie Franzosen es sind,[120] machten Besuch im Hause des preußischen Gesandten, ihres Nachbarn, und waren liebenswürdige Leute und immer freundlich zu den Knaben. Als man aber zu merken anfing, daß die Russen Sewastopol nicht so leichten Kaufes herzugeben, vielmehr es zu verteidigen gedachten auf Blut und Knochen, und daß der Krieg lange, vielleicht sehr lange dauern würde, ließen sie, soweit sie verheiratet waren, ihre Familien aus Frankreich nachkommen.
Verheiratet aber war von den Offizieren nur der eine, der elsässische Ingenieur, und nach einiger Zeit kam also dessen Frau in Kurú-Tschesme an und brachte ihren Jungen mit. Das war ihr und ihres Mannes einziges Kind und hieß Archambauld.
Bald darauf erschien dann die Frau Ingenieur mit ihrem Jungen und machte Besuch im Hause des Gesandten, und dabei lernten die Knaben den Archambauld kennen, einen schönen, schlanken, dunkellockigen Jungen mit großen braunen Augen, und erfuhren, daß er gerade so alt war wie sie. Anfänglich aber waren sie beiderseits etwas verlegen, denn der Archambauld sprach hauptsächlich französisch, und zwar auch ein wenig deutsch, aber nicht sehr gut, die Knaben aber hauptsächlich deutsch, und zwar auch ein wenig französisch, aber nicht sehr gut. Darum beschränkten sie sich zunächst darauf, ihm ihre Spielsachen zu zeigen, namentlich ihre Zinnsoldaten,[121] von denen sie viele besaßen, und als der Archambauld die sah, leuchteten ihm die Augen, denn Spielsachen besaß er überhaupt nicht viele, hier aber in dem fernen, fremden Lande natürlich fast gar keine. Dann spielten sie mit ihm, indem sie ihre Zinnsoldaten aufbauten, in zwei feindlichen Parteien einander gegenüber, und Papierkugeln drehten und auf beide Seiten des Tisches traten, jeder hinter eine Partei, und die Gegenpartei mit den Papierkugeln beschossen. Das machte ihnen allen dreien – denn der Knaben waren zwei, und mit Archambauld waren sie drei – großes Vergnügen, und wenn dem Archambauld ein guter Wurf gelungen war, daß recht viel Zinnsoldaten umfielen, schrie er vor Vergnügen laut auf »oh comme ils sont – ge–purzelt – est ce qu'on dit comme cela?«1 Alsdann lachten die beiden und sagten »oui, oui, on dit comme cela.«2
Trotzdem, wie gesagt, kamen sie zu dem kleinen Franzosen in kein rechtes Verhältnis, denn lieber und bequemer war es ihnen, mit ihren deutschen Freunden zu verkehren, das waren die Söhne eines deutschen Kaufmanns, die mit ihren Eltern in Bebék wohnten, dem Nachbarort von Arnautköi, auf der anderen Seite von Kurú-Tschesme. Mit denen kamen sie in jeder Woche mehrere Male zusammen, sei es, daß sie zu ihnen nach Bebék gingen, oder daß diese sie in Arnautköi besuchten; und jedesmal, wenn[122] letzteres geschah, wurde hinausgezogen in den Garten, der hinter dem Hause lag, und dann wurde alles Mögliche vorgenommen. Der Garten nämlich war wunderschön, er stieg an den Uferhöhen in Terrassen empor; diese Terrassen waren durch steinerne Treppen mit einander verbunden. Da konnte man laufen und springen. Außerdem standen große Bäume in dem Garten, da konnte man klettern. Am schönsten aber war er ganz droben, wo er den Kamm der Höhe erreichte, da ging er in eine Art von Wildnis über, eine Wildnis von Oleander- und Ginstergebüsch. Zwischen den Büschen standen Kastanien und Pinien. Mit den Kastanien konnte man sich Schlachten liefern; die Pinienäpfel konnte man am Feuer, das man sich selbst mit knisterndem Ginster anzündete, rösten und die wohlschmeckenden Kerne daraus hervorholen und essen. O ja, das war ein Leben!
Nun aber geschah etwas Merkwürdige und Trauriges: der elsässische Ingenieur, der Vater des Archambauld, ging eines Tages ganz plötzlich mit Tode ab. Er war ein Mann in den kräftigsten Jahren, in voller Gesundheit gewesen; niemand hatte etwas davon gehört, daß er krank geworden sei – also woher der plötzliche Tod? Seine Kameraden, die französischen Offiziere, machten nachdenkliche Gesichter und sprachen von der Sache mit einem Ausdruck, als wenn sie hätten sagen wollen, »sprecht[123] nicht zuviel davon«. Allmählich nämlich verbreitete es sich, daß der Mann durch eigene Hand ums Leben gekommen war. Was ihn dazu getrieben hatte, erfuhr man nicht, und hat es bis heute nicht erfahren.
Das war nun ein schwerer Schlag für seine Frau, die jetzt als Witwe mit ihrem Jungen in dem fernen, fremden Lande saß, und ihr einziger Trost im Unglück war es, daß sie die Frau des preußischen Gesandten in der Nähe hatte, die sich ihrer annahm, wie eben nur eine gute, kluge, starke Frau sich des bedrängten Mitmenschen annehmen kann.
»Denkt einmal,« sagte sie zu ihren Knaben, »wie traurig es dem armen Archambauld geht. Nun werdet ihr recht gut und freundlich zu ihm sein, so lange er noch hier ist, nicht wahr? – Ich will heute zum Besuch zu seiner Mutter gehn und ihr sollt mich begleiten. Möchtet ihr ihm nicht eine kleine Freude machen und etwas schenken von euren Spielsachen?« – Darauf gingen sie in die Stube, wo ihre Zinnsoldaten waren und nahmen jeder eine Schachtel davon, von den schönsten, und steckten sie ein; dann, als sie mit ihrer Mutter nach Kurú-Tschesme gekommen waren, wurde ihnen ganz feierlich zu Mut, denn weil erst vor kurzem das Leichenbegängnis gewesen, war die Wohnung noch ganz schwarz ausgeschlagen, und in dem dunklen Salon saß die Witwe, schwarz angezogen, und neben ihr stand der Archambauld,[124] auch schwarz gekleidet, und sein hübsches Gesicht war blaß, so daß man die braunen Augen ganz dunkel darin glänzen sah. Darauf gingen die Knaben auf ihn zu, und weil sie in ihrer Verlegenheit nicht recht wußten, was sie sagen sollten, griffen sie gleich in die Tasche und holten ihre Schachteln mit den Zinnsoldaten hervor, reichten sie ihm hin und sagten: »Du armer Archambauld, da haben wir dir etwas mitgebracht.«
Und als der Archambauld den Deckel von den Schachteln genommen hatte und die schönen Zinnsoldaten darin erblickte, die ihm damals so sehr gefallen hatten, ging ein heller Schein über sein bekümmertes Gesicht, er lief zu seiner Mutter und zeigte ihr seine Schätze und sagte ganz selig »oh Maman – ils m'en ont fait cadeau!«3
Dann kam er schüchtern, aber mit strahlenden Augen zu den Knaben und streckte ihnen die Hand hin und sagte »o das – sein schön – das sein sehr schön – oh merci! merci bien!«4 Und indem er so sprach, wurden ihm die Augen feucht, und plötzlich liefen ihm die dicken Tränen an den Wangen herab, und dann warf er sich den beiden an die Brust, erst dem einen, dann dem anderen, und umarmte sie und küßte sie und sagte schluchzend »ah que Vouz êtes bon! ah comme je Vous aime! ah comme je Vous aime!«[125]5
Den Knaben aber, die so etwas gar nicht gewöhnt waren, denn mit ihren deutschen Freunden gaben sie sich die Hand, aber sie küßten sich mit ihnen nicht, machte es einen ganz wunderbaren Eindruck, als der schöne, dunkellockige Junge, der so ganz anders aussah als jene, sie so leidenschaftlich und zärtlich in die Arme schloß und küßte, und als sie ihn so weinen sahen, wurden sie auch gerührt und fingen auch zu weinen an.
Inzwischen hatte dann die Witwe mit der Mutter der Knaben gesprochen und ihr erzählt, daß sie nun mit ihrem Jungen nach Frankreich zurückkehren würde, aber das würde noch Wochen dauern, denn zunächst müßte sie ihren Hausstand wieder auflösen, den sie vor kurzem erst eingerichtet hatte; sodann wollte sie, weil sie arm und die Reise ihr zu teuer war, das Depeschenbot der französischen Regierung erwarten, das alle sechs bis acht Wochen von Frankreich nach der Krim und von da wieder nach Frankreich zurückfuhr, weil sie auf dem freie Fahrt haben würde. Bis das aber das nächste Mal von Sewastopol wieder herunterkam, würde es noch lange dauern, weil das letzte erst ganz vor kurzem nach Frankreich gegangen war.
»Also nicht wahr,« sagte darauf die Gesandtin zu ihren Knaben, »so lange der Archambauld noch hier ist, wird er nun, so oft er kann, zu euch kommen[126] und mit euch im Garten spielen? Und wenn ihr mit dem Ernst und dem Ferdinand spielt – so hießen nämlich ihre kleinen deutschen Freunde aus Bebék – wird der Archambauld auch immer dabei sein?«
Und weil der Archambauld zwar nicht sehr gut deutsch sprach, es aber ganz gut verstand, so hatte er verstanden, was die Mutter zu ihren Knaben sagte, und sah diese mit erwartungsvollen Augen darauf an, was sie erwidern würden. Die beiden aber, als sie seinen Blick gewahrten, der so ängstlich an ihnen hing, wurden wieder so gerührt davon, daß sie beide gleichzeitig mit ausgestreckter Hand auf ihn zugingen und »du armer Archambauld« sagten. »Komm du nur so oft du kommen willst.« Da fuhr der Archambauld trotz all' seines Kummers wie ein Bolzen empor, der von einer Spiralfeder geschleudert wird, und klatschte vor Wonne in die Hände und lief zu seiner Mutter und küßte sie ins Gesicht, und dann zu der Mutter der Knaben, und küßte ihr die Hände, »oh merci madame, oh bien merci, madame!«6, und dann kam er zu den Knaben, sprang zwischen sie und faßte sie unter die Arme und hing sich in ihre Arme, so daß er zwischen den beiden wie in einer Schaukel hing, und schaukelte sich und lachte und freute sich, so daß die beiden, denen so etwas Übersprudelndes noch nie vorgekommen war, auch zu lachen anfingen und die[127] Arme höher hoben, damit er besser schaukeln könnte. Und dann, als sie Abschied nahmen, kamen sie ihrerseits und wurden vor Verlegenheit ganz rot, indem sie ihn nun ihrerseits küßten, und an der Art, wie er es erwiderte, merkten sie, daß er nicht nur ein hübscher Junge, sondern auch ein herziger, lieber Kerl war, und von da an wurden sie mit dem Archambauld gute, gute Freunde.
Schon am nächsten Tage kam er an, und dann mindestens einen Tag um den andern, häufig aber auch Tag für Tag, und als er das erste Mal erschien und den Garten erblickte, der mit seinen Terrassen vor seinen Augen emporstieg, wurde er ganz starr vor Staunen und sagte: »mais que c'est beau! que c'est beau! que c'est beau!«7
Die Knaben ließen ihn eine Zeit lang staunen, denn es machte sie stolz, daß ihm der Garten ihrer Eltern so gut gefiel, dann aber sagten sie »jetzt komm – wir wollen jetzt in den Feigenbaum gehn.«
In dem Garten nämlich stand ein Feigenbaum, ein großer, und das war ein Baum, wie er herrlicher gar nicht gedacht werden kann. Den Knaben erschien er beinah wie ein Mensch, ein langmütiger, freigebiger, gütiger Mensch, so geduldig ließ er sich mit Füßen treten, wenn sie in seinen Zweigen herumkletterten, so reichlich spendete er zur Zeit, wenn die Feigen reif wurden, seine Früchte, große grüne[128] Feigen, an deren jede er, wenn der letzte Augenblick gekommen war, ein Honigtröpfchen hing, als wollte er andeuten »jetzt müßt ihr pflücken.« Lieber aber, als die Feigen, hatten die Knaben das Klettern, und dem Archambauld ging es ebenso. Sobald sie daher an den Baum gelangt waren, ging es mit einem »hurr« den Baum hinauf, die beiden Knaben voran, hinter ihnen drein der Archambauld, und da zeigte es sich, was freilich bei seinen schlanken Gliedern nicht anders zu erwarten war, daß er ein famoser Kletterer war. Da saßen sie dann, ganz droben im Wipfel, alle drei, über ihnen rauschte der alte Baum, und wenn sie verstanden hätten, würden sie gehört haben, wie er zu ihnen sprach: »Habt euch lieb, ihr kleinen Menschen, wenn die Menschen erwachsen und groß werden, hört die Liebe zwischen ihnen auf.«
Später dann, als der Ernst und der Ferdinand aus Bebék kamen, wurden sie mit dem Archambauld bekannt gemacht, und dann zog man zusammen hinauf in die schöne Gartenwildnis, und dort oben zwischen den Ginster- und Oleandergebüschen wurde mächtig gespielt. Alle möglichen Spiele: Verstecken und Abschlag, Weißer und Indianer, vor allem aber Erstürmung von Sewastopol. Und bei all' diesen Spielen der Gewandtesten einer war der Archambauld. Wenn er so dahin sauste[129] zwischen den Gebüschen, mit den flatternden Locken, dann sah er aus wie ein befiederter Pfeil, wenn er zum Sturm auf Sewastopol angelaufen kam, einen Ginsterbusch oder Oleanderzweig als Waffe schwingend, dann war ein Feuer in ihm, daß er aussah wie eine hüpfende Flamme. Und dabei so liebenswürdig: wenn er in der Hitze des Kampfes einen von seinen beiden Freunden – denn wirkliche Freundschaft hatte er doch nur mit den beiden Knaben geschlossen – etwas unsanft getroffen hatte, gleich kam er nachher und streichelte »oh mais, cela n'a pas fait mal? n'est ce pas? cela n'a pas fait mal?«8
Einmal nun hatten sich die Eltern der Knaben für diese und ihre Freunde ein ganz besonderes Vergnügen ausgedacht: Bivak sollte gespielt werden. An einem schönen Sommerabend wurde auf der obersten Terrasse des Gartens, auf der zwei hohe Pinien und ein alter Tamarindenbaum standen, ein großes Zelt aufgeschlagen, Stroh wurde hineingelegt, und in dem Zelte sollten sie die Nacht schlafen. Das war nun ein Gaudium für alle, namentlich aber für den Archambauld, in dem sich das Soldatenblut schier ungestüm regte. Neben dem Zelte wurden Holzscheite aufgestapelt, und als es dunkelte, wurden sie angezündet. Das war das Wachtfeuer. In der Asche des Feuers brieten sie sich Kartoffeln,[130] die sie aßen, soweit sie nicht verbrannt waren, und dann setzte man sich im Kreise herum, denn die Freunde aus Bebék hatten noch andere Freunde mitgebracht, und trank etwas Glühwein und unterhielt sich.
In der Unterhaltung, die sich natürlich um den Krieg drehte, kam es nun heraus, daß jeder von den Jungen für eines von den kriegführenden Völkern Partei genommen hatte: da war der eine für die Engländer, der andere für die Russen, wieder einer für die Franzosen und der andere für die Türken. Einer – aber der wurde ausgelacht – war sogar für die Tunesen, die am Tage zuvor auf einem türkischen Linienschiff angekommen waren und mit ihren großen roten Mützen und den wilden braunen Gesichtern darunter einen graulichen Eindruck gemacht hatten. Der Archambauld, der zwischen seinen beiden Freunden saß, verhielt sich dabei ganz still – auf wessen Seite der stand, nun das brauchte man ja nicht erst zu fragen. Darauf aber meinte der, welcher für die Russen war, daß jetzt freilich die Russen ganz allein ständen, aber nächstens würden die Preußen kommen und ihnen helfen. Als der Archambauld das hörte, riß er die Augen weit auf, sodaß sich das Feuer in seinen braunen Augen spiegelte, und legte die Hände auf die Kniee seiner beiden Freunde und kniff sie[131] leise, als wenn er hätte sagen wollen »Habt ihr das gehört?« Einer von den Söhnen des deutschen Kaufmanns aus Bebék aber erwiderte »Nein« – ihr Vater, der sein Kontor in Stambul hatte, wäre heut nachmittag nach Haus gekommen und hätte erzählt, jetzt wäre es entschieden, und die Preußen würden den Russen nicht helfen, sondern sie würden neutral bleiben. Das bestätigten dann die Knaben, die von ihrer Mutter dasselbe gehört hatten. Als der Archambauld das vernahm, seufzte er wie erleichtert auf und legte die Arme um seine beiden Freunde und sagte leise: »Ah que c'est bien! que c'est bien!«9
Nun aber, weil das Feuer heruntergebrannt war, stand alles auf. Einer von den Jungen, der eine Trommel besaß, trommelte etwas darauf, das bedeutete den Zapfenstreich, und dann ging alles ins Zelt, um auf dem Stroh zu schlafen. Der Archambauld wollte natürlich nirgends anders als bei seinen beiden Freunden schlafen und richtete es so ein, daß er zwischen ihnen lag, und schob seine Arme unter sie und schmiegte sich zwischen sie und an sie, und da fühlten sie so recht, was für ein liebevolles Gemüt in dem Jungen war.
Darauf, als es in dem Zelte schon ganz still zu werden anfing, weil einige schon eingeschlafen, die anderen im Einschlafen waren, fing der Archambauld[132] zu flüstern an, so daß seine Freunde merkten, daß er noch in Gedanken wach gelegen hatte, und sie wurden auch wieder wach. »Ecoutez,«10 sagte er ganz leise, »ich – wenn ich werde groß sein – werde mich Soldat machen – ihr auch?«
Darauf erwiderten sie, daß sie gehört hätten, in Preußen müßten alle Soldat werden.
Nachdem er sodann wieder ein Weilchen geschwiegen hatte, fing er wieder an und meinte, »aber die Franzosen und die Preußen hätten noch niemals miteinander gekämpft – nicht wahr?«
Da mußten nun die beiden Knaben wirklich lachen, und sie taten es so leise wie möglich, weil sie hörten, wie wenig der Archambauld in der Geschichte Bescheid wußte, und sie sagten, »aber Archambauld, gewiß doch, sehr, weißt du denn das nicht?«
»Aber künftig,« fuhr er dann fort, »würden sie es nie wieder tun, n'est çe pas?«11
Darauf erwiderten sie, daß sie das auch hofften, denn sie hätten ja die Franzosen sehr gern, aber wissen könnte man so etwas doch nicht. Da aber zog sie der Archambauld, der seine Arme unter sie gelegt hatte, plötzlich beide so an sich, daß ihre Gesichter an seinem Gesicht lagen, und mit einem Male fühlten sie, daß seine Wangen von Tränen ganz feucht waren, und hörten, wie er leise schluchzend[133] sagte »ah que cela ne se fasse jamais! jamais! jamais!«12 Und weil sie nun gar nicht wußten, was sie darauf sagen sollten, schwiegen sie; der Archambauld wurde auch still, und bald darauf schliefen sie alle drei ein.
Inzwischen aber war nun die Zeit herangekommen, daß der Archambauld mit seiner Mutter abreisen sollte. Am letzten Tage kamen sie beide noch einmal nach Arnautköi, um mit den Knaben und deren Eltern vor der Abfahrt zu frühstücken. Da saß dann der Archambauld zum letzten Male zwischen seinen beiden Freunden und sprach kein Wort und war ganz blaß, und mit den Händen hielt er die Hände seiner Freunde.
Alsdann stiegen alle in den dreirudrigen Kaïk – so heißen dort die Ruderbote – des Gesandten, und fuhren hinaus und da sahen sie auch schon den französischen Depeschendampfer den Bosporus herunterkommen. Der Dampfer hielt an, die Passagiere aufzunehmen. Und als nun der letzte Augenblick da war, umarmte der Archambauld seine beiden Freunde noch einmal und küßte sie, und die Tränen liefen ihm an beiden Backen herab und die Stimme brach ihm, weil er so schluchzte.
»Wenn wir – werden groß sein – peut être que nous nous reverrons.13 – Wir werden sagen – Arnautköi – rien que ça, rien que ça14 –[134] werden wir wissen – alles – alles – alles!« Dann mußte er mit seiner Mutter die Treppe hinaufsteigen, die man vom Schiffe herabgelassen hatte; das Gepäck wurde hinaufgegeben. Dann setzte sich der Dampfer wieder in Gang, und vom Schiffsbord wehte ein weißes Fähnchen, das war der Archambauld, der mit dem Taschentuch seinen Freunden Lebewohl winkte, Lebewohl.
Lebewohl – Abschied fürs Leben. Nicht allzu lange mehr sollte es dauern, so trug das Meer, das den Archambauld nach Frankreich zurückgetragen hatte, auch die Knaben nach Deutschland heim. Und dann kam das Leben, der alte harte Schulmeister, und packte seine Aufgaben aus, deren erste und schwerste bekanntlich heißt: vergessen, daß man ein Kind gewesen ist. Da versank das alte Haus in Arnautköi, der Garten mit seinen Terrassen und seiner schönen Ginster- und Oleander-Wildnis, der große gütige Feigenbaum – alles wurde zum Traum, und der Traum wurde blasser und blasser.
Neue Menschen kamen, neue Gesichter tauchten auf, dafür gingen andere, alte, liebe Gesichter unter und unter diesen das eine, dessen Erlöschen der Mensch nicht verwindet, weil, wenn es hingeht, der heilige Mensch aus seinem Leben geht, das Antlitz der Mutter. Ob der Archambauld vom Tode der Frau, die auch zu ihm so gütig gewesen war,[135] etwas erfuhr? Keine Nachricht kam her, keine Nachricht ging hin – niemand hörte etwas von ihm und seiner Mutter im fernen Frankreich, so wurde auch sein Gesicht zum verblassenden Kindheitstraum und ging unter mit all' den anderen. –
Nach diesem allen aber, beinah zwei Jahrzehnte danach, ergriff die Weltgeschichte wieder das Wort, um allen, die etwa glaubten, sie wäre zum Gespenst geworden, zu zeigen, daß sie ein furchtbar lebendiges Wesen sei. Wieder, wie damals, standen die Franzosen im Feld, aber nicht wie damals gegen die Russen, sondern gegen die Deutschen und vor allem gegen die Preußen. Es hatte also nichts geholfen, was der Archambauld in jener Nacht im Bivakszelt gefleht hatte: »Ah que çela ne se fasse jamais! Möchte das niemals, niemals geschehen!« Und während sie damals auf Sewastopol und den Malakoff sturmgelaufen waren, standen die Franzosen heute, am 18. August 1870, verschanzt und verbarrikadiert auf den Höhen von Metz, in Saint-Privat, und ließen die Preußen auf sich anstürmen.
Auf die baumlose Ebene, über welche die Angreifer herauf mußten, prasselten die Mitrailleusen- und Chassepotkugeln. Es war, als wenn von droben eine eiserne Wand daherrauschte, die einem den Atem benahm, bevor sie einen zermalmte. Und sobald[136] eine solche Wand vorübergefegt war, kam eine zweite, eine dritte, und ohne Aufhören. Man sah nichts von ihnen, man hörte nur, wie sie heulend, zischend, pfeifend die Luft vor sich herschoben. Dann vernahm man dumpfes Einschlagen von Kugeln in menschliche Glieder, gräßliche Schreie, schmetterndes Niederstürzen von Leibern. Und das alles stundenlang, ohne Pause, ohne Ruhe zum Atemholen, immer weiter, einen langen, endlos langen Sommernachmittag lang. Bis daß endlich, allem zum Trotz, das schreckliche Nest, aus dem die bleiernen Todesvögel geflogen kamen, Saint-Privat, dennoch erreicht war und die Preußen, soviele von ihnen noch lebten, stürmend darin eindrangen.
In dem ummauerten Kirchhof standen die letzten Franzosen, und als jetzt die blut- und schweißbedeckten Gesichter der Preußen über der Mauer erschienen und die Preußen die Mauer zu übersteigen begannen, drehten sie die Gewehrkolben nach oben – »Ergebung! Ergebung!«
An der Spitze der Preußen kam ein Offizier; es war ein noch junger Mann, sein Rock von Kugeln aufgerissen, er selbst aber unverwundet. Drüben, unweit der Mauer, an ein Grabkreuz gelehnt, saß der Offizier, der die Franzosen kommandiert hatte, auch noch ein junger Mann; sein Gesicht war totenblaß, ein alter Sergeant stand[137] neben ihm und drückte ihm das Tuch auf die Brust, aus der das Blut quoll.
Und nun begab sich etwas Merkwürdiges:
Indem sich Angreifer und Verteidiger, Sieger und Besiegte einen Augenblick lautlos, keuchend gegenüberstanden, trat der preußische Offizier auf den jungen Franzosen drüben zu, der ihn nicht kommen sah, weil er die Augen geschlossen hatte, überhaupt nichts mehr von allem zu hören und zu sehen schien, weil er mit dem Tode rang. Wie jemand, der sich fragt »ist er's?« sah der Preuße dem anderen ins Gesicht, dann beugte er sich über ihn und sagte ihm ein Wort. Und als es der Franzose nicht mehr zu hören schien, wiederholte er das Wort ganz laut, so laut er konnte, und es war ein Wort, das weder seine Leute, noch die des Sterbenden verstanden, weil es nicht deutsch war und nicht französisch – »Arnautköi!«
Als der Sterbende das Wort vernahm, taten seine Augen sich auf, große, braune, schöne Augen, ein Ausdruck ging über sein bleiches Gesicht, wie ein fragendes Staunen, wie ein letzter, verschwimmender Erdengedanke. Er richtete den Blick auf den Preußen, seine Lippen bewegten sich, als wollte er etwas sagen, aber sprechen konnte er nicht mehr. Er ließ das Haupt sinken, daß es an der Brust des andern lag, und in den Armen des jungen Preußen starb der junge Franzose.
Das alles war so wunderbar anzusehen, daß beide Parteien, Preußen und Franzosen, wie gebannt standen. Einen Augenblick war schweigender Frieden über der blutigen Stätte, wie wenn ein Rauschen gekommen wäre – niemand hätte sagen können, woher – beinahe wie das Rauschen eines Baumes aus weiter, weiter Ferne, wie wenn eine Stimme gesprochen hätte – niemand hätte sagen können, wer da sprach – »Liebt euch, ihr Menschen, ihr Menschen, habt euch lieb.«
1 Oh wie sie – ge–purzelt sind – sagt man so?
2 Ja ja, man sagt so.
3 Oh Mama – die haben sie mir geschenkt!
4 Dank, vielen Dank!
5 Ach, wie Ihr gut seid! wie ich Euch lieb habe! wie ich Euch lieb habe!
6 Oh, ich danke Ihnen, gnädige Frau, ich danke Ihnen vielmals!
7 Wie ist das aber schön! wie schön! wie schön!
8 Es hat aber doch nicht weh getan? Nicht wahr? es hat nicht weh getan?
9 Ach, das ist gut! Das ist gut!
10 Hört!
11 Nicht wahr?
12 Ach, möchte das niemals, niemals geschehen!
13 werden wir uns vielleicht wiedersehen.
14 weiter nichts, weiter nichts.
Friedrich Spielhagen wurde am 24. Februar 1829 zu Magdeburg geboren, studierte in Berlin, Bonn und Greifswald Jurisprudenz, Philosophie und Philologie, war eine Zeitlang als Hauslehrer tätig und widmete sich bald ausschließlich dem literarischen Berufe. Seinen Ruhm begründete er durch seinen Roman »Problematische Naturen«, der bereits alle Eigentümlichkeiten der Spielhagenschen Kunst zeigte: eine kunstgerecht aufgebaute, spannende und ereignisreiche Handlung, leidenschaftlich bewegte, interessante Charaktere, das echte Pathos eines ritterlichen Mannes, eine Fülle geistvoller, horizontreicher Ideen und vornehme Behandlung der Sprache. Wie die Ereignisse jenes Romans sich auf dem Hintergrunde der 48er Revolutionsbewegung abspielen, so hat Spielhagen auch später mit Vorliebe zum Hintergrund seiner erzählenden Schöpfungen politische und soziale Kämpfe gewählt, die er von einem konsequent freisinnigen Standpunkte aus beleuchtet. Sein bestes Werk neben den »Problematischen Naturen« ist die[141] »Sturmflut«; aber auch »Hammer und Amboß«, »In Reih und Glied«, »Was die Schwalbe sang«, »Uhlenhans«, »Selbstgerecht« und die herrliche Novelle »Quisisana« sind in hohem Grade lesenswert.
Spielhagens Bedeutung liegt im allgemeinen weniger in der kleinen Erzählung als im weit ausladenden Roman und in der Novelle, die er ebenfalls breit anlegt und die bei ihm gewöhnlich einen Umfang annimmt wie bei den Neueren ein Roman. Seinen gewandten, vielseitigen und vornehmen Geist und seine Erzählerkunst zeigen aber auch seine kleineren Schöpfungen, und unter diesen haben wir »Breite Schultern« gewählt, weil sie vom Ruhm und Segen der Arbeit, auch der schweren körperlichen Arbeit spricht und weil die Bücher unserer Stiftung ja vor allem hinausgehen sollen zu den Werktätigen und Mühseligen.
O. E.

Breite Schultern.
Aber ihr wollt doch unmöglich schon fort, Ihr Herren? sagte Gottlieb.
Es ist hohe Zeit, sagte der Assessor Stricker, sich erhebend und die Spitzen seiner schlanken Finger mehrmals auf einander drückend.
Die gnädige Frau hat ganz zweifellos schon einige Male leise gegähnt, sagte der Leutnant von Berkenfeld, mit einem Blick zärtlichen Vorwurfes nach der jungen Dame in der Sophaecke.
Nonsens, sagte Gottlieb; Emma ist munter wie eine Lerche. Sehen Sie doch nur die Augen! Geh', Emmy, hol' uns noch ein wenig Zucker, Kind!
Die junge Frau erhob sich aus ihrer Ecke und ging nach dem Buffet, das im Hintergrunde des großen und stattlichen Gemaches stand.
Tut den Frauen gut, so eine kleine Motion, sagte Gottlieb mit leiserer Stimme; schlafen sonst gar zu leicht ein. Merkwürdig, wie man bei gutem Grog und guten Zigarren einschlafen kann! Aber die Weiber, die Weiber! es ist ein Jammer mit den Weibern! Es fehlt ihnen allen so der rechte Sinn für die tiefe Poesie, die aus einem beinahe leeren[143] Glase heraufblinkt; sie haben kein Herz dafür, keine Seele, keine Eingew–
Was schwätzest du da wieder einmal, du alter, schlechter – breitschultriger Mann, sagte Emmy, indem sie die Zuckerschale auf den Tisch stellte und ihrem Gatten dabei einen leisen Schlag auf die vornübergebeugten, in der Tat ungewöhnlich breiten Schultern gab.
Schilt nur nicht auf meine Schultern, Emmy, sagte Gottlieb; du weißt, daß du es einzig und allein meinem breiten Rücken verdankst, wenn du in diesem Augenblick nicht mehr Fräulein Emmy Jäger, von der Firma Jäger, Breitkopf u. Co., sondern Frau Gas-Direktorin Roland bist.
Ah bah! sagte Emmy.
Aber, Emmy, du kannst doch nicht leugnen, daß ohne meine Schultern –
Gottlieb, du bist unausstehlich, sagte Emmy, indem sie einen schwachen Versuch machte, beleidigt auszusehen.
Sie machen uns in der Tat neugierig, sagte der Assessor Stricker, der sich längst wieder gesetzt hatte.
Was ist's mit Ihren Schultern, Roland? sagte der Leutnant von Berkenfeld.
Nichts ist, gar nichts; sagte die junge Frau eifrig; Gottlieb ist ein Schwätzer, ein Fanfaron, ein Renommist –
Nein, das geht zu weit! Ihr Herren, jetzt sollt ihr selber hören und urteilen, ob diese kleine, ein halbes Jahr alte Frau hier berechtigt ist, mich, ihren lebenslänglichen Gatten, mit solchen Ehrentiteln zu schmücken; und ob ich die Bescheidenheit verletze, wenn ich behaupte, daß ich nicht meinem Witz, nicht meinen Kenntnissen, nicht meiner Liebenswürdigkeit, sondern einzig und allein diesen meinen breiten Schultern und den Armen, die daran hängen, mein einträgliches Amt und meine unverträgliche Frau verdanke.
Lassen Sie uns hören! sagte der Assessor.
Die gnädige Frau gibt Ihnen die Erlaubnis, sagte der Leutnant.
Meinetwegen, sagte Emmy.
Sie hatte sich wieder in die Sophaecke gesetzt und tat, als ob sie schmollte; aber der Leutnant sah nicht ohne Wehmut, daß die sanften Augen der jungen Frau mit sehr freundlichem Ausdruck auf der mächtigen Gestalt ihres Gatten ruhten, der den dampfenden Inhalt seines Glases noch einmal umrührte, ein paar blaue Ringe aus seiner Zigarre blies, sich behaglich in seinen Stuhl zurücklehnte und also anhub:
Sie müssen nämlich wissen, lieben Freunde, daß ich eigentlich ein Taugenichts bin, oder, wenn das zuviel sein sollte, ein Tunichtgut. Es muß das wohl[145] wahr sein, denn sie haben es mir oft genug gesagt. Als ich kaum laufen konnte, hat meine Wärterin mich gleichsam zum zweiten Male mit diesem Namen getauft; ich war noch keine halbe Stunde in der Klippschule, so hatte mich der Lehrer allen andern Kindern als einen Taugenichts denunziert; meine liebe selige Mutter hat mich oft mit Tränen an ihren Busen gedrückt und mich schluchzend gefragt: ob ich denn gar nicht gut tun wolle? und mein Vater hat mich mehr als ein Mal in seine Stube kommen lassen und mir lange Reden gehalten, von denen ich meistens nur das eine verstand: daß ich ein heilloser Taugenichts sei, dessen späteres Schicksal sein (meines braven alten Vaters) Herz mit bangster Sorge erfülle.
Sie glauben nicht, wie viel heiße Tränen mich diese düsteren Prophezeiungen gekostet haben. Ich hatte nämlich dabei stets das innigste Mitleiden mit mir selber. Ich sah mich selbst in gelb- und schwarzgestreiftem Anzuge, eine Eisenstange zwischen den Beinen, einen Besen auf der Schulter, in der Gesellschaft anderer Herren in demselben Kostüm durch die Straßen meiner Vaterstadt geführt, zum Entsetzen aller Nachbarsleute und besonders aller Nachbarskinder, die sämtlich klein und unschuldig geblieben waren, während ich zu solcher Größe des Leibes und des Lasters heranwuchs; ich sah mich[146] am Galgen hängen, des Nachts im Mondenscheine, umkrächzt von gefräßigen Raben und Dohlen; ich sah mich auf das Rad geflochten, dies Bild aber weniger deutlich, weil ich mir keine rechte Vorstellung von der interessanten Situation machen konnte. Enfin: ich war innig überzeugt, daß ich dies alles und noch viel mehr durch meine abgrundtiefe Schlechtigkeit vielfach verdient hätte, und daß, wenn der Himmel mit seinen Strafgerichten noch immer zögerte, er dies nur meines Kanarienvogel wegen tue, der ohne mich verhungern würde. Du lieber Himmel: der Kanarienvogel – es war ein hübsches goldgelbes Tierchen mit einer grün-braunen glänzenden Tolle und besaß meine ganze Liebe – er verhungerte wirklich, aber nicht ohne mich, sondern durch mich, und ich denke noch jetzt mit Entsetzen an die Nacht, die dem Tage folgte, an welchem mein Hänschen zum letzten Male mit seinen verhungerten Beinchen zum Himmel gezuckt hatte. Ich war darauf gefaßt, daß der Teufel mich holen würde, und hatte mir ein Gebet zurecht gemacht, womit ich seine Barmherzigkeit anrufen wollte, und das, glaube ich: »lieber, lieber Teufel« anfing.
Wenn die Herren mich nun fragen, worin denn eigentlich jene meine absonderliche Schlechtigkeit bestand, so weiß ich wirklich selbst noch in diesem Augenblicke keine rechte Antwort darauf zu geben.[147] Daß ich in der Schule stets da, wo der Bänke letzte sind, mich aufhielt, daß ich – und wenn es mein Leben gegolten hätte – kein lateinisches Exercitium unter einem Dutzend Fehler machen konnte – ich muß es einräumen; aber es gab dümmere und faulere Jungen, die nicht halb so viel Schläge bekamen und denen kein Mensch prophezeite, daß sie in ihren Schuhen sterben würden. Von Herzen war ich auch nicht schlecht, ja, ich darf wohl sagen, ich hatte ein gutes Herz, vielleicht, wie die Welt einmal geht und steht, ein zu gutes Herz; und mindestens die Hälfte der unzähligen dummen Streiche, deren ich mich schuldig machte, hatte mir mein Herz gespielt. Ich kam ohne Jacke nach Hause, weil ich sie einem zerlumpten Betteljungen, der mich neidisch darauf ansah, geschenkt hatte; einmal bin ich von einer Droschke übergefahren, damit ein Kind, das auf der Straße spielte, nicht unter die Räder geriet; ein anderes Mal wäre ich fast ertrunken, um einen räudigen Hund zu retten, den sie in den Kanal geworfen hatten; nie habe ich einen Kameraden in der Klemme stecken lassen, dafür aber oft genug die Schuld anderer – und nicht minder die Schläge, um die es sich in letzter Instanz handelte – auf meinen breiten Rücken genommen. Das klingt nun allerdings fast wie Prahlerei, Ihr Herren; aber, was kann ich dafür, daß meine Schädelweite und meine[148] Schulterbreite in keinem proportionalen Verhältnis standen? »Etwas muß der Mensch sein eigen nennen,« sagt Schiller, und wenn jemand von der Natur verdammt ist, in einem Extemporale stets die meisten Fehler zu machen und von jedem Knirps, den er, sozusagen, in die Tasche stecken kann, übersehen zu werden, fällt er ganz naturgemäß darauf, sich mit seinem Überfluß an Körperkraft über den Mangel seiner geistigen Kapazität zu trösten. Und ich war in jener Beziehung so ausstattet, daß man mich ebenso oft den dicken oder den starken Gottlieb, auch wohl Goliath, Mammut-Gottlieb und dergleichen, als den dummen oder den faulen Gottlieb nannte. Diese meine Stärke wurde neben meiner Gutmütigkeit die zweite Quelle, aus der für mich viel Unheil, aber auch, wie Sie bald sehen werden, das Heil meines Lebens geflossen ist. Es war, als ob mich die Natur selbst als die geeignetste Person zur Ausführung dummer und dümmster Streiche gezeichnet hätte. Es war, wie in dem Volksliede: »Geh' du voran, du hast hohe Stiefel an, daß dich der Has' nicht beißen kann.« Und was habe ich im späteren Leben nicht alles wegen meiner breiten Schultern leiden müssen! Wie oft bin ich aus den Nähten geplatzt in Zeiten, wo ich nur einen Gott und einen Rock hatte; wie oft haben sich in Post- und Eisenbahnwagen meine Nachbarn[149] bitter beklagt, daß ich gut zwei Drittel des für zwei berechneten Platzes okkupiere; noch vorgestern hat eine kleine Dame, die im Parquet hinter mir saß, angefangen von der chinesischen Mauer zu sprechen, weil sie weder rechts noch links an mir vorbeisehen konnte; ja, sie haben mich seiner Zeit meiner breiten Schultern wegen von der Schule gewiesen. Die Geschichte ist charakteristisch für den Unstern, der in früheren Jahren über meinem Haupte stand.
Es war an einem Tage vor den großen Sommerferien, und wir in der Tertia waren guter Dinge, und weil die Zeit, wo wir noch alle beisammen waren, nur noch so sehr kurz, so benutzten wir die Zwischenviertelstunde zum Ausfechten eines alten Haders, wobei es geschah, daß die Partei, zu der ich gehörte, die andere Partei schließlich zur Tür hinauswarf. »Gottlieb, du mußt die Tür zuhalten!« hieß es nun von allen Seiten. Ich stemmte also meine Schultern gegen die Tür und hielt wacker aus, so stark auch die von außen drängten, und zuletzt, wie in Verzweiflung, mit den Fäusten gegen die Tür schlugen, während meine Kameraden vor Freuden über meine Widerstandsfähigkeit wie die Besessenen tobten. Endlich wurde mir – schier zu meinem Erstaunen – der Druck gegen meine Schultern zu stark; ich mußte nachgeben, und herein[150] fielen durch die aufspringende Tür der Schuldiener, der Direktor und mindestens ein halbes Dutzend Lehrer, mit denen ich während dieser ganzen Zeit zu tun gehabt hatte. Das Ende können Sie sich denken: ich sollte meine Dränger recht gut gekannt haben; ich sollte nur dem frechen Übermut, dem Frevelmut meines bösen, verstockten Herzens gefolgt sein. Es war der schändlichste Streich, der seit Menschengedenken auf der Schule vorgekommen war, und ich wurde cum infamia relegiert.
Mein guter alter Vater war außer sich. In seinen Augen war relegiert und auf offenem Markte gestäupt und gebrandmarkt werden so ziemlich dasselbe. Er nannte mich mit Tränen im Auge seinen verlorenen Sohn, und ich dankte Gott, daß meine Mutter, wenn sie mir doch einmal so früh entrissen werden sollte, nun schon lange in der schwarzen Erde lag, und sich über die Schande ihres Sohnes nicht mehr die lieben Augen auszuweinen brauchte.
Von diesem Augenblick ging es schneller und immer schneller mit mir bergab, und weniger und immer weniger konnte ich begreifen, weshalb gerade ich Gottlieb heißen mußte, der ich weder Gott noch den Menschen lieb zu sein und etwas recht machen zu können schien.
Mein Vater hatte mich zu einem Gutsbesitzer in die Lehre getan, der ihm als ein exemplarischer[151] Ökonom gerühmt worden war. Ich hätte in keine schlimmeren Hände fallen können. Herr Bartel war ein gänzlich unwissender, brutaler Mensch, ein Vieh- und Leuteschinder, ein kleinlicher Tyrann, der jeden, der es sich gefallen ließ, mit der Reitpeitsche traktierte. Ich sah das eine Zeitlang, meines Vaters wegen, geduldig mit an, bis eines schönen Sommermorgens, zur Zeit der Roggenernte, auf offenem Felde, angesichts des Himmels und sämtlicher Gutsleute beiderlei Geschlechts, zwischen mir und Herrn Bartel eine Szene erfolgte, die der genannte Herr schwerlich provoziert haben würde, wenn er den Ausgang vorhergesehen hätte. Ich höre immer noch das dreimalige Hurrah, das aus den Kehlen der armen weißen Sklaven erschallte, als der Elende am Boden lag, und ich nach einigen letzten, kräftigsten Hieben die Reitpeitsche weit hinein in das blinkende Wasser des benachbarten Sees schleuderte. Ja, Ihr Herren, das Hurrah tut mir wohl, so oft ich daran denke, und ich habe mich schon in trüben Stunden damit getröstet, daß es im Hauptbuche meines Lebens auf der Kredit-Seite verzeichnet steht, und so eine oder die andere meiner Dummheiten straflos bleiben wird.
Nach dieser Katastrophe wagte ich, wie Sie sich denken können, nicht, in das väterliche Haus zurückzukehren. Ich drückte mich eine Zeitlang bei[152] Verwandten herum, bis der Termin kam, wo ich des Königs Rock anziehen konnte. Ich wurde mit den Kanonen viel besser fertig als mit den lateinischen Exerzitien, und da mein Hauptmann mich gern hatte und mein Vater es wünschte, meldete ich mich, als mein Jahr zu Ende war, zum Weiterdienen und brachte es auch wirklich in verhältnismäßig kurzer Zeit zum Vize-Feuerwerker. Schon sah ich die Epauletten auf meinen Schultern blinken, als – nun, Berkenfeld, Ihren Stand in allen Ehren, aber mit der militärischen Subordination ist es doch manchmal ein wunderlich Ding, das einen ehrlichen Kerl zur Verzweiflung bringen kann. Gerade zu der Zeit wurde ein Bürschchen, mit dem ich zusammen auf der Schule gewesen war, und das ich oft und oft, ich glaube noch heute verdientermaßen, durchgeprügelt hatte, aus der Kadettenschule entlassen, und natürlich – um das Maß meiner Sünden voll zu machen – in meine Batterie eingestellt. Wie viel der neugebackene Leutnant auf der Kadettenschule gelernt hatte, lasse ich dahingestellt, daß er aber nichts vergessen hatte, zum wenigsten nichts, was sich auf unser früheres Verhältnis bezog, wurde mir nur zu bald klar. Der Name tut nichts zur Sache, Ihr Herren; auch habe ich dem Manne längst vergeben, und wenn er in diesem Augenblick zur Tür hereinträte, sollte er mir willkommen sein;[153] aber damals war ich zehn Jahre jünger und dümmer, vielleicht trieb er es auch gar zu toll; zum wenigsten kam ich nur fünf Jahre auf Festung, was, wie man mir sagte, unter diesen Umständen ein ganz unerhörtes Glück zu nennen sei.
Nun: es hat jedes Ding seine zwei Seiten, selbst eine Festungshaft. Die schlimme und schlimmste Seite war für mich die, daß mein armer Vater sich über meine Schande gar nicht zu trösten vermochte und bald darauf, ich fürchte an gebrochenem Herzen, starb. Ich war sein einziges Kind gewesen, und der Himmel weiß, welche glänzende Zukunft er für mich erträumt hatte. Er hatte es nie über die Stellung eines viel gehudelten Subalternbeamten hinausbringen können; ich sollte nun wenigstens Regierungsrat werden. Er hatte mich sehr geliebt, mein guter alter Vater, und der größte Kummer meines Lebens ist, daß ich ihm – der Himmel weiß, wie sehr gegen meinen Willen! – so viel Kummer habe machen müssen. Er war vielleicht kein Genie, mein guter alter Vater, aber ein braver Mann – Friede seiner Asche!
Ja! und die gute Seite von meiner fünfjährigen Einsperrung? Vielleicht war ich zu vollblütig, oder mein Blut hatte nicht die rechte Mischung, oder mußte sich erst zurecht arbeiten, wie ein Wein, den man ein paar Monate im Keller liegen läßt, bevor[154] man ihn auf Flaschen zieht. So viel weiß ich, daß in der ersten Zeit mein Blut gar fürchterlich in mir tobte, so daß ich schier glaubte: ich überlebte es nicht, oder würde zum wenigsten verrückt werden; aber nach und nach wurde es stiller und ruhiger in mir, ordentlich sonntäglich still und ruhig, und ich konnte mich gar nicht so unglücklich fühlen, wie ich es für meine Pflicht hielt. Wenn ich auch nicht recht begreifen konnte, weshalb ein Mensch, der sich keines Verbrechens bewußt war, wie ein Verbrecher behandelt werden müsse, so dachte ich: der liebe Gott werde es wohl wissen; und wenn der sich nicht um einen armen Schelm bekümmere, so sei es eben mein Schicksal, und gegen sein Schicksal könne der Mensch nichts. Und dann war ich ja doch ohne Zweifel sehr leichtsinnig gewesen, und es fiel mir schwer auf die Seele, wie schlecht ich immer meine lateinischen Vokabeln gelernt hatte. Zuletzt kam ich auf den Gedanken: ich müsse meiner Faulheit, meines Leichtsinns und meiner dummen Streiche wegen fünf Jahre lang nachsitzen. Das tröstete mich ungemein.
Dazu kam, daß man mich auf der Festung sehr, ja, ich kann wohl sagen, unverdienterweise gut behandelte. Im Anfang hatte ich allerdings meine Karre schieben müssen, wie die anderen; aber in der wilden Stimmung, in welcher ich mich damals befand, war das eigentlich ein rechter Segen für[155] mich, und da ich Kräfte für Drei hatte, so arbeitete ich auch für Drei. In dieser Station bin ich aber nur wenige Wochen gewesen. Der Festungs-Gouverneur, Hauptmann von Eisenfresser, der trotz seines grimmigen Namens ein gar gütiger, lieber Herr war, mußte wohl recht warm für mich gesprochen haben. Die Ketten wurden mir abgenommen, und ich durfte in dem Festungsbureau als Schreiber arbeiten. Da bin ich denn die ganze übrige Zeit gewesen, und weil ich mich, schon aus purer Dankbarkeit gegen den edlen Mann, der ein wirklicher Edelmann war, wacker hielt und eine recht gute Hand schrieb – das Einzige, was ich auf der Schule ohne Anstrengung gelernt hatte – wurde ich bald Privatsekretär, so zu sagen, meines Gönners und so freundlich von ihm und seiner ganzen Familie behandelt, daß ich eigentlich nur noch dem Namen nach ein Sträfling war. Herr von Eisenfresser nahm sich meiner noch weiter an. Er machte die merkwürdige Entdeckung, daß ich nicht blos schreiben, sondern auch rechnen konnte, ja, daß ich, wie er sagte, ein entschiedenes Talent für die Mathematik habe. Ich lachte darüber zuerst ganz despektierlich; aber da er selbst ein ausgezeichneter Mathematiker und sehr stark im Beweisen war, so bewies er mir, daß er recht hatte. Mir war dabei ganz wunderlich zu Mute. Ich bekam zum ersten Male eine Art Respekt vor mir[156] selber, aber einen noch viel größeren Respekt vor meinem Wohltäter, und als ich bald darauf eine leidlich schwere Aufgabe, die er mir gestellt hatte, ganz richtig löste und er mir auf die Schulter klopfte und sagte: Sehen Sie, Roland, daß Sie das ganz gut begreifen können – da habe ich helle Freudentränen geweint und dem guten Manne aus tiefinnerster Dankbarkeit die Hände geküßt.
Er tat noch mehr für mich.
Gerade in dieser Zeit wurde in der Zitadelle ein kleiner Gasometer aufgestellt. Herr von Eisenfresser leitete die Arbeiten selbst und ließ mich in seinem Bureau nicht allein sämtliche Anschläge und Zeichnungen anfertigen, sondern stellte mich auch als Aufseher bei dem Bau an, so daß ich das Theoretische und Praktische der Sache mit seiner Hilfe gründlich kennen lernte. Das kann Ihnen für Ihre Zukunft sehr nützlich werden, lieber Roland, sagte er oft, wenn er auf den Bau kam und mir, um mir seine Zufriedenheit zu erkennen zu geben, auf die Schultern klopfte.
Er liebte meine Schultern, der brave Herr. Sie waren so breit, und die seinen so sehr schmal. Es tut einem wohl, Sie anzusehen; man atmet ordentlich leichter, meinte er manchmal, und dabei lächelte er stets so freundlich und so traurig zugleich. Ich glaube, ich hätte mein Herzblut für ihn hingeben[157] können, aber es würde ihm doch nichts geholfen haben. Er starb an der Schwindsucht – in meinen Armen, ein paar Wochen, bevor ich meine fünf Jahre nachgesessen und aus dem Karzer entlassen wurde.
Da war ich nun wieder auf freien Füßen, und, weiß es Gott, ich sehnte mich oft genug noch nach meinem Gefängnis und meinem gütigen Kerkermeister zurück. Die Welt kam mir sehr weit und, trotz all' der unzähligen Menschen, sehr öde vor. Es kümmerte sich keiner um mich. Mein Vater war tot, und so arm gestorben, wie er gelebt hatte. Meine Verwandten wollten von dem entlassenen Sträfling nichts wissen und verleugneten mich, wenn ich ihnen in den Weg kam, was ich natürlich so selten wie möglich tat. Ich kann wohl sagen, daß es mir eine Zeit lang recht herzlich schlecht ging und daß ich es für ein großes Glück hielt, als es mir endlich gelang, in der Gasanstalt hier eine Unteraufseherstelle zu erhalten. Ich hatte den Monat fünfzehn Taler. Sie können sich denken, wie weit ich damit bei meinem Appetite reichte! Oder vielmehr: Sie können es sich nicht denken. Ihr Herren seid in der Fülle des Glückes groß geworden und habt keine Ahnung davon, wie jemandem zu Mute ist, wenn ihm der Genuß in so spärlichen Rationen zugemessen wird. Und dann, war mein Vater auch[158] nur Rechnungsrevisor gewesen, so war er doch ein Gentleman und hatte mich als Gentleman erzogen, ja, im Anfang vielleicht ein wenig verzogen. Meine Mutter war eine gebildete, feine Frau, und meine Eltern hatten sich stets in Kreisen bewegt, die eigentlich schon über der Sphäre ihrer gesellschaftlichen Stellung lagen. Ich hatte, bei allem meinem Leichtsinn und wilden Wesen, dennoch den Geschmack meiner Eltern für gute Formen und vielleicht auch etwas von dem Ehrgeize meines Vaters geerbt; und wenn jemand bei solchen Ansprüchen in einer Dachkammer wohnt, in einer Garküche vorletzten Ranges unter Bedienten, Zettelträgern, Wagenschiebern und ähnlicher ganz ehrenwerter, aber nicht immer ganz feiner Gesellschaft seine Diners und Soupers einnimmt und gezwungen ist, in einer beschmutzten Bluse oder, noch schlimmer, in einem schäbigen Rock, den er beim Trödler kaufte, über die Straße zu gehen – so hat das seine Unbequemlichkeiten, wie ich Sie aus jahrelanger intimster Erfahrung versichern kann.
Indessen war auch diese Zeit für mich nicht verloren. Ich lernte mein Fach von allen Seiten und auch von denen kennen, welche nur der eigentliche Arbeiter zu sehen bekommt; dabei trieb ich, schon aus Pietät für das Andenken meines lieben verstorbenen Wohltäters, meine mathematischen Studien[159] eifrig fort, und mit Hilfe derselben und meiner täglichen praktischen Übung kam ich auf gewisse Entdeckungen in der Konstruktion der Öfen und der Behandlung des Coaks, die ich für Verbesserungen hielt und die sich in der Folge wirklich als solche bewährt haben. Das alles machte mich nun natürlich ein wenig übermütig, und ich fing an, mich mit Plänen zu tragen, wie ich aus dieser meiner abhängigen untergeordneten Stellung in eine Position gelangen möchte, in der ich meine Entdeckungen verwerten könnte, und die überhaupt des Sohnes meines Vaters würdiger wäre. Sie müssen nämlich wissen, daß mich das Andenken an meinen guten alten Vater, der in Herzeleid über mich zur Grube gefahren war, fortwährend verfolgte und daß ich die Empfindung nicht los werden konnte: er werde sich noch im Grabe freuen, wenn ich es trotz alledem in der Welt zu etwas Ordentlichem brächte.
So vergingen fünf Jahre, und ich fing nachgerade an, darüber ungeduldig zu werden, daß ich noch immer in meiner Dachkammer wohnte. Da wurde die Gasdirektorstelle hier vakant, und die Gesellschaft forderte befähigte Bewerber auf, sich zu melden. Es war am 21. Januar, also gerade heute vor einem Jahr, als ich die Anzeige las, und weil just mein dreißigster Geburtstag war, so hielt ich das für ein gutes Zeichen und sagte zu mir: »Courage,[160] Gottlieb, jetzt oder nie!« Und es tat Not, daß bei der ganzen Sache so ein günstiges Omen war, sonst hätte ich doch am Ende den Mut nicht gehabt. Sie wissen, daß mit dieser Stelle zugleich die eines technischen Ober-Direktors für die sämtlichen vierzig Gasanstalten, welche die Gesellschaft bereits gegründet hat, verbunden ist. – Ich mußte also Vorgesetzter meines eigenen bisherigen Direktors werden, und das alles aus der Position eines Unteraufsehers, die ich nach wie vor einnahm. Ihr Herren müßt zugeben, daß die Sache einen etwas tollen Anstrich hatte. Aber es war im Januar des vorigen Jahres sehr kalt; durch die Ritzen meiner Dachstube pfiff der eisige Wind; mich fror und hungerte wechselweise gar erbärmlich, und wenn der Teufel damals auf mich geboten hätte, ich glaube, er hätte mich billig haben können.
Ebenso gut aber wie zum Teufel, dachte ich, könne ich auch auf das Komtor der Firma Jäger, Breitkopf u. Co. gehen und mich als Kandidaten für die erledigte Stelle präsentieren.
Die Sache war aber nicht ganz so leicht, wie sie aussah. Zuerst war Gefahr im Verzuge, denn ich wußte, daß sich bereits binnen der drei ersten Tage zweiundzwanzig Bewerber gemeldet hatten; und doch konnte ich vor dem nächsten Sonnabend, wo ich nach der Morgenwache einen freien Nachmittag hatte,[161] meinen Posten nicht verlassen. Sodann fehlte es mir gänzlich an einer Garderobe, die für den feierlichen Akt berechnet gewesen wäre. Mit den Stiefeln und der Wäsche ging es ungefähr, auch ein paar schwarze Beinkleider fanden sich, die ihren Zweck zu erfüllen versprachen, wenn ich die Nähte mit Tinte nachschwärzte. Eine weiße Weste kaufte ich mir merkwürdig billig bei meinem Antipoden, einem Trödler, der fünf Stock unter mir im Keller desselben Hauses wohnte. Es fehlte jetzt nur noch an einem Frack, und den lieh mir mein damaliger Kollege und jetziger Ober-Aufseher und hoffentlich lebenslänglicher Freund, Hans Ohnesorge, der vor vierzehn Tagen Hochzeit gemacht hatte und im Vollbesitze eines neuen, vor Neuheit, wie mir schien, geradezu strahlenden Fracks war.
Hans Ohnesorge, sagte ich, als er mich am Sonnabend Mittag ablöste und ich den Frack, den er mir, in ein Tuch geschlagen, mitgebracht hatte, im Gasometergebäude anprobierte, Hans Ohnesorge, ich kann nicht dafür stehen, daß ich Ihnen nicht die Nähte an den Ärmeln oder gar den ganzen Rücken herausplatze.
Immer d'rauf, Herr Roland, sagte Hans Ohnesorge; wenn Sie die Stelle bekommen, können Sie mir ja einen andern schenken, und wenn Sie die Stelle nicht bekommen – aber das ist ja gar nicht möglich! Ein Mann wie Sie braucht ja nur merken[162] zu lassen, daß es ihm Ernst ist, da geht es ja von selbst.
Hans Ohnesorge, müssen Sie wissen, hielt mich so ziemlich für den größten Mann meines Jahrhunderts. Ich war ihm sein Held, sein Ideal; und wenn ich gesagt hätte: Hans Ohnesorge, ich bin entschlossen, Kaiser von Fez und Marokko zu werden, er würde gesagt haben: Immer d'rauf, Herr Roland; das ist Ihnen ja eine Kleinigkeit.
Nun, Ihr Herren, ich lachte freilich über die treuherzige Einfalt des guten Gesellen, aber so ganz geheuer war mir denn doch nicht, als ich in dem engen Frack vor dem Komtor von Jäger, Breitkopf & Co. stand und erst leise, dann lauter und zuletzt sehr laut anklopfte.
Herein, sagte endlich eine scharfe Stimme. Ich glaubte anfänglich, es habe irgendwo in der Nähe eine Tür geknarrt, aber es war wirklich eine Menschenstimme gewesen, und so trat ich denn ein.
In dem großen Zimmer befand sich in diesem Augenblick – es war nämlich schon etwas spät geworden und die Komtoristen waren zum Essen gegangen – niemand Geringeres, als – na, Ihr Herren, meine Frau ist glücklich in ihrer Ecke eingeschlafen, und so kann ich Ihnen sans gêne sagen, wie mein würdiger Schwiegervater ausschaut, wenn man ihn zum ersten Male – besonders in der Stunde[163] vor Tisch, wo er hungrig und beißig ist, sieht: wie das Titelkupfer auf dem englischen Punch ohne den Mops und den Höcker, aber noch ein wenig grimmiger – ja, wie er mir an dem Mittag vorkam, ganz außergewöhnlich, und so zu sagen: polizeiwidrig grimmig und menschenbeißig.
Was wollen Sie, schnarrte der kleine alte Herr, indem er sich auf seinem Komtorstuhl halb zu mir umdrehte.
Mich ge – ich wollte sagen gehorsamst; aber weil mir das eine verächtliche Kriecherei dünkte, so hustete ich blos und sagte dann sehr kecklich: zu der vakanten Gasdirektorstelle melden.
Sie sind der dreißigste, schnarrte Herr Jäger.
Das schadet nichts, sagte ich.
Wie so?
Einer kann sie doch nur bekommen.
Der alte Herr drehte sich noch einen Zoll weiter auf seinem Stuhle herum und sah mich noch viel grimmiger an als vorher. Die Augen unter den buschigen Brauen stachen mich ordentlich, wie Julisonnenschein vor einem Gewitter; aber ich sagte mir: wenn du jetzt mit der Wimper zuckst, bist du verloren, und so hielt ich wacker aus und dachte: Blick Du nur, Alter; der Frack ist freilich geliehen, aber es steckt ein ehrlicher Kerl darin.
In diesem Augenblick wurde abermals an die[164] Türe geklopft und herein trat, ohne Herrn Jäger's Antwort abzuwarten, ein Mensch, der mir doppelt mißfiel, erstens, weil er mich in dem tête-à-tête mit Herrn Jäger, das eben interessant zu werden anfing, störte, und zweitens, weil er eine abscheuliche Physiognomie hatte – eine rechte brutale Galgenphysiognomie, die vortrefflich zu seinem untersetzten, starkknochigen Körper paßte.
Was wollen Sie? schnarrte Herr Jäger.
Das wissen Sie eben so gut wie ich, erwiderte der Eingetretene im gröbsten Ton. Ich will mein Geld und damit basta.
Ich habe Ihnen bereits geschrieben, weshalb ich Ihnen das nicht geben kann, sagte Herr Jäger ganz höflich.
Dann soll das Wetter drein schlagen, sagte der Andere.
Das würde Ihnen wenig helfen, erwiderte Herr Jäger. – Bitte, Herr –? – Roland, sagte ich. – Herr Roland, setzen Sie sich gefälligst etwas, bis ich diesen Herrn abgefertigt habe.
Ich setzte mich in einiger Entfernung auf einen Stuhl, und das Gespräch zwischen den beiden Widersachern nahm seinen Fortgang. Der vierschrötige Kerl war ein Schiffskapitän so und so, der für das Geschäft Kohlen nach Hamburg gebracht und, wie es schien, über seinen Kontrakt hinaus Forderungen[165] an die Firma machte. Es war ein wunderliches Konzert, die Beiden sich streiten zu hören, als wenn in das Quinquilieren einer schrillen Pfeife die dumpfen und zugleich harten Töne einer allzustraff gespannten Pauke hereinplatzten. Die Pauke hielt es aber viel länger aus wie die Pfeife und brüllte zuletzt so, daß die Fensterscheiben klirrten.
Nun bin ich von Natur kein Freund von Zank und Streit, und gar das unvernünftige Schreien war mir von jeher verhaßt. Dazu kam, daß der Kapitän ganz unzweifelhaft im Unrecht war und gegen die klaren, sachgemäßen Auseinandersetzungen Herrn Jäger's nur Drohungen und Schimpfreden vorzubringen wußte. Je länger ich den Kerl toben hörte, desto fataler wurde er mir, und als er dem Herrn Jäger, der doch am Ende ein alter und ganz offenbar kränklicher, schwacher Mann war, seine plumpe Faust unter der Habichtsnase schüttelte, die in dem Augenblick sichtbar vor Furcht erbleichte – riß mir endlich vollends die Geduld. Ich stand auf, ging zur Tür, indem ich ihm pantomimisch zu verstehen gab: er würde mich sehr verbinden, wenn er uns des Vergnügens seiner Gegenwart nun enthöbe. Der Kapitän wurde vor Wut ganz dunkelrotbraun und begann, sich so wahnsinnig zu geberden, daß ich wirklich um den alten Mann, der bleich und zitternd auf seinem Stuhl saß, besorgt wurde.[166] Ich faßte also meinen Kapitän um die Schultern, drückte ihm die Arme fest gegen den Leib, hob ihn in die Höhe und trug ihn, trotzdem er sich wie ein wildes Tier geberdete, zur Tür hinaus über den Vorsaal bis an die Treppe. Dort setzte ich ihn wieder hin und beschleunigte noch in etwas seinen Rückzug die Treppe hinab. Nachdem ich mich sodann überzeugt hatte, daß er, am Fuße derselben angelangt, sehr schleunig wieder auf die Beine kommen und unter Flüchen und Drohungen das Haus verlassen konnte, kehrte ich in das Komtor zurück, machte die Türe wieder zu und sagte: Ich glaube, wir können jetzt ungestört in unserer Unterhaltung fortfahren.
Und wenn ich hundert Jahre alt würde, ich werde die Miene, mit welcher der alte Herr mich jetzt anblickte, nicht vergessen. Der Ärger und der Schrecken von vorhin mischten sich auf eine so seltsame Weise mit dem Erstaunen und, ich glaube, der Freude über meine Handlungsweise in dem schon an sich grotesken Gesicht, daß ich etwas Wunderlicheres in meinem Leben nicht gesehen habe und wirklich einen Augenblick glaubte, der alte Herr sei toll geworden. Und plötzlich fing er gar, die kleinen funkelnden Augen immer fest auf mich gerichtet, an zu lachen, oder ich müßte eigentlich sagen: zu krähen, denn es war wirklich viel mehr das Krähen eines ausländischen[167] Vogels, als das Lachen eines christlichen Europäers. Leider sah ich, oder fühlte ich gar bald, was ihm an meiner Erscheinung so lächerlich erschien. Der neue Frack des armen Ohnesorge, dessen Stoff trotz seines Glanzes nicht der allerbeste sein mochte, war bei der Anstrengung, die es mich denn doch gekostet hatte, den starken Kerl zu bewältigen, aus allen Nähten geplatzt, und hing, so zu sagen, eigentlich nur noch in Fetzen auf meinem Leibe. Ich fühlte, daß ich sehr rot wurde, aber ich war entschlossen, die Sache nicht ernster zu nehmen, als sie es verdiente.
Entschuldigen Sie, Herr Jäger, sagte ich, meine derangierte Toilette; aber da ich Ihnen mich selber und nicht meinen Rock anbieten wollte, so kommt es schließlich auf eins heraus. Kleider machen wohl Leute, aber keinen tüchtigen Gastechniker.
Sie sind mein Mann; bei Gott, Sie sind mein Mann! rief der Alte, kam von seinem Stuhl herabgehüpft, gab mir seine kleine magere Hand und blickte mit einem beinahe zärtlichen Ausdruck zu mir hinauf. – Wenn Sie Ihre Sache verstehen, sollen Sie die Stelle haben, so wahr ich Johann August Jäger heiße.
Ich verstehe meine Sache, Herr Jäger, sagte ich, und ich weiß noch bis auf den heutigen Tag nicht, woher ich in dem Augenblick den Mut zu dem zuversichtlichen, großsprecherischen Ton nahm; aus- und inwendig verstehe ich sie.
Ich glaub's, glaub's, glaube Ihnen auf's Wort; Sie sind ein Prachtmensch. Setzen Sie sich hier an den Tisch, und nun sagen Sie mir einmal, wo, wie und was Sie gelernt haben. Was denken Sie z. B. von der neuen Gasometer-Konstruktion des Mr. Hotwater in Liverpool?
Ich sah aus dieser Frage, daß mein alter Herr selber das Ding sehr gut verstand. Ich nahm mich also zusammen und setzte ihm auseinander, weshalb mir die sogenannte neue Erfindung des Mr. Hotwater keineswegs gefalle, und weshalb ich derselben meine Methode bei weitem vorziehe. Dabei holte ich ein paar Zeichnungen, in denen ich meine Erfindung erläutert hatte, aus der Tasche, breitete sie vor Herrn Jäger aus, und weil mich das Ding selbst interessierte und ich außer meinem ehrlichen Ohnesorge noch Niemanden gefunden hatte, dem ich mich hätte mitteilen können, so wurde ich ganz warm in meinem Vortrag und sprach wohl eine halbe Stunde, während der Alte unaufhörlich nickte und »Hm, hm, ja, ja; sehr gut; ausgezeichnet« dazwischen murmelte. Dann, weil ich nun gerade im Zuge war, erzählte ich noch: wer meine Eltern waren, und so in aller Kürze meine ganzen Schicksale, wobei ich meine Sträflingsperiode zu erwähnen nicht vergaß. Als ich am Ende war, streckte mir der Alte das magere Händchen entgegen und sagte: Hier,[169] meine Hand, Herr Roland; Sie sollen unser Direktor werden; zweitausend Taler jährlich fix, Dienstwohnung, freie Heizung und selbstverständlich Beleuchtung und fünf Prozent vom Nettogewinn. Sind Sie zufrieden?
Mir schlug das Herz bis an die Kehle, als ich den alten Herrn so sprechen hörte. Ich ergriff seine Hand und stammelte, ich wußte selber nicht was. Ich wußte nur, daß nun die Not zu Ende sei, und daß Ohnesorge den schönsten Frack haben sollte, den Schneiderhände machen könnten.
Und nun gehen Sie nach Hause, Herr Roland, sagte der Alte, ziehen Sie sich einen andern Rock an und kommen Sie heute um fünf wieder her und speisen Sie mit uns. Ich will Sie meiner Familie vorstellen, und hernach können wir den Kontrakt unterzeichnen. Aus Ihrer bisherigen Stellung treten Sie von diesem Augenblick aus. Ich werde sofort an Ihren Direktor schreiben und ihm die Veränderung, die in unserm Personale eingetreten ist, notifizieren. Vielleicht brauchen Sie Geld, junge Leute brauchen immer Geld. Hier sind hundert Taler Avance. Machen Sie keine Umstände. Hier unten Ihren Namen. Danke! Leben Sie wohl; auf Wiedersehen; fünf Uhr pünktlich!
Damit entließ mich der Alte; ich verbeugte mich, und dann weiß ich nicht mehr, wie ich zum Hause[170] hinaus und in Ohnesorge's Wohnung gekommen bin. Ich weiß nur, daß ich mich in den Armen der treuen Seele wiederfand, der in einem fort weinte und lachte und dazwischen rief: Ich hab' es immer gesagt: Sie brauchen ja nur merken zu lassen, daß es Ihnen Ernst ist – da geht es ja von selbst.
Nun, ihr Herren, die Fortsetzung und das Ende von der Geschichte, wie ich um fünf Uhr zu Herrn Jäger kam und Frau Jäger und Fräulein Emmy Jäger und Herrn Breitkopf und Frau Breitkopf u. Co. vorgestellt wurde, wie ich bei Tisch neben Fräulein Emmy Jäger saß und nicht wußte, ob es der Champagner oder Emmy's schöne Augen – Herr des Himmels, die Frauen! man braucht blos von ihren Augen zu sprechen, so sperren sie sie auf. Hast gut geschlafen, Emmy?
Ich habe gar nicht geschlafen, du schlechter Mann, sagte die junge Frau, die mit ihren schlummerroten Wangen und in ihrer Verlegenheit so reizend aussah, daß Herr von Berkenfeld sich einen Knopf über der Brust aufmachen mußte.
Aber Ihr wollt doch unmöglich schon fort, Ihr Herren, sagte Gottlieb.
Der Assessor lachte. Schon? es ist ein viertel auf zwei.
Ach was, sagte Gottlieb; was tut denn das? die Uhr schlägt keinem Glücklichen.
Herr von Berkenfeld seufzte.
Kommen Sie, Berkenfeld, sagte der Assessor, der schon den Hut in der Hand hatte; wir können es ja nicht verantworten.
Die beiden Herren standen auf der Straße. Der Mond glitzerte auf den schneebedeckten Dächern. Eine Nachtdroschke kam langsam dahergeknarrt.
Ich werde die Droschke nehmen, sagte der Assessor. Adieu, Berkenfeld. Und was ich sagen wollte, Berkenfeld: geben Sie die kleine Roland auf; Sie blamieren sich, Mann, und Roland ist nicht der gutmütige, einfältige Tropf, für den wir ihn anfänglich in unserm blasierten Hochmut hielten. Ich sage Ihnen, Berkenfeld: ich habe heute Abend alle Achtung vor dem Roland bekommen.
Denken Sie etwa, ich nicht? rief der Leutnant; Emmy ist entzückend, rosa bella senza spine,15 göttlich; aber Sie haben Recht: lasciate ogni speranza voi ch'entrate.16
Und er deutete auf die Tür des Hauses, das sie soeben verlassen.
Es wird das auch wohl das Gescheiteste sein, sagte der Assessor, indem er in die Droschke stieg.
Der Leutnant blickte noch einmal wehmütig nach den Fenstern hinauf und murmelte, während er die Straße hinabging:
Beneidenswerter Mensch: Zweitausend jährlich, fünf Prozent vom Nettogewinn, Schwiegervater Millionär, das reizende Weib – und welch' horribel breite Schultern der Mann hat; aber ich will ihn nicht unglücklich machen.


Detlev von Liliencron wurde am 3. Juni 1844 in Kiel geboren und ist am 22. Juli 1909 zu Alt-Rahlstedt gestorben. Seine Knabenjahre gingen einsam dahin. Im Garten, im Feld und Holz umherzustreifen, sich dort seinen Träumereien zu überlassen, war seine Lust. Seiner Neigung folgend wurde er Soldat und kostete das fröhliche, schneidige Leutnantsleben mit »seinen Freuden, seinen Rosentagen, seinem scharfen Pflichtgefühl« in vollen Zügen. In drei Schlachten und in fünfzig Gefechten kämpfte er, und zweimal ward er verwundet. Nachdem er seinen Abschied genommen, wurde er später Hardesvogt auf der nordfriesischen Insel Pellworm. Hier ward ihm das Meer lieb und vertraut und gab ihm Stoff zu einer Fülle seiner schönsten Gedichte und Geschichten.
Er war schon in der Mitte der Dreißiger, als er sein erstes Gedicht schrieb. »Durch Zufall veranlaßt,« sagt er selbst, doch es ist derselbe Zufall, der die Linde im Juni blühen, der den Quell nach langem, unterirdischem Lauf ans Tageslicht springen läßt. Von innigster Liebe zur Natur durchdrungen, von reicher Erfahrung des Lebens erfüllt, gibt er in seinen Gedichten die Frische der Natur, die Kraft des Lebens wieder. So wurden sie ein starker Damm gegen die saft- und kraftlose Modelyrik der achtziger Jahre.
Liliencron besitzt eine Anschauungskraft sondergleichen. Er beschreibt nicht, er schildert nicht; so[175] wie er es im Leben gesehen, zeigt er es uns, in Licht und Luft und Farbe mit allen Einzelheiten. Das offenbart sich am klarsten in seinen »Kriegsnovellen«, der reifsten poetischen Frucht des deutsch-französischen Krieges, wie sich die machtvolle Phantasie des Dichters nirgends gewaltiger zeigt, als in seinem großen Epos »Poggfred«.
Kann man den Poggfred als das poetische Tagebuch des Dichters bezeichnen, so ist der »Mäcen« sein prosaisches. Auch darin wie in seinen Dramen, seinen Romanen: »Breide Hummelsbüttel«, »Mit dem linken Ellenbogen«, »Leben und Lüge« sowie in den kleineren Erzählungen der Sammelbände »Aus Marsch und Geest«, »Roggen und Weizen«, »Könige und Bauern« schimmert überall das Persönliche hindurch. Gewöhnlich beginnt er die Erzählung mit scheinbar Nebensächlichem, stellt Ort und Zeit und Gelegenheit mit breitester Behaglichkeit vor Augen, um darauf mit einem Sprung uns mitten in das Ereignis und in höchste Spannung zu versetzen. Dann ein Blick ins Menschenleben, ins Menschenherz – und er läßt uns allein. Aber was wir da miterlebt, zittert in uns nach; wir fühlen, daß ein Schicksal vorübergerauscht ist. Solche Gestalten wie der Staller Greggert Meinstorff, wie die schöne, blasse, stille Silk, ihr Lieben und ihr Leiden prägen sich auf immer der Seele ein. Auch in dieser kleinen Erzählung offenbart sich uns der große Dichter.
Hamburg.
J. Loewenberg.

Greggert Meinstorff.
Greggert (Gregorius) Meinstorff war zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts Staller (Vizekönig) der friesischen Inseln. Ihm stand sogar in seinem Bezirk bei zum Tode Verurteilten das Begnadigungsrecht zu, das in den andern Provinzen nur vom Könige ausgeübt wurde. Ein strenger, aber durchaus gerechter Herr, wurde er auf seinen Inseln gefürchtet und geachtet; die Liebe seiner »Untertanen« (wenn je die freien Friesen dies Wort zuließen und zulassen) hatte er nicht. Tauchte er auf der ihm als Wohnsitz angewiesenen reichen Marschinsel Schmerhörn mit seinen breiten Schultern und seinen sechs Fuß aus den die Klinkersteige und Muschelwege zu beiden Seiten begleitenden Schilfhalmen hervor, so machten die ihm Entgegenkommenden Kehrt; auf den Fennen und Weiden versteckten sich die Bauern und Knechte hinter Pflug und Vieh, um ihn nicht grüßen zu müssen. Zu den Hofbesitzern kam er nicht, öffentliche Termine, wie es noch damals, als Rest der Thinggerichte, Sitte war, hielt er nicht, für keinen war er zu sprechen, Alles mußte schriftlich und durch »untertänigste Supplik« abgefertigt werden.[177] So kam es, daß er fremd auf seinen Inseln war, wenn er sich auch andrerseits bis ins Kleinste von den Vorfällen und Ereignissen durch seine Unterbeamten unterrichten ließ.
Greggert Meinstorff, aus einem alten holsteinischen Geschlecht, das seine Zweige weit in andre Länder getrieben, war der letzte seines Hauses. Er hatte eine Dame aus dem Landesadel geheiratet und lebte mit dieser seit elf Jahren in kinderloser Ehe. Daß er keine Nachfolger hatte, machte ihn finster und schwermütig. Die Ehe war nicht glücklich. Wenn auch beide übereinstimmten in unermeßlichem Adelsstolz, so wußte sonst Frau von Meinstorff in keiner Weise ihren Mann zu nehmen. Er, der ruhige, scheinbar kalte Verstandesmensch, dem jedes Aufwallen und Schütteln des Herzens unverständlich war, hatte Tag für Tag den Jähzorn seiner Frau zu beklagen, der oft alle Grenzen überschritt; das machte sie ihm widerwärtig.
Mit der Zeit entfernten sie sich immer mehr von einander. Freilich, eins bemerkte er nicht: daß ihn seine Frau anbetete. Zeigte sie ihm auch nicht ihr Herz, blieb sie kalt und kühl, wenn sie nicht an ihren bösen Erregtheiten litt, so ließ doch ihr Auge nicht von ihm, wenn sie ihn heimlich verfolgen konnte. Alle die kleinen Aufmerksamkeiten, die sie ihm bereitete, bemerkte er niemals. So ging er[178] schroff und hart, sie nur als ein schweres, unbequemes Anhängsel betrachtend, mit ihr durchs Leben.
Nur für einen Gegenstand zeigte der Staller lebhaftes Interesse; nur bei einer Sache hellte sich das finstre Gesicht auf, konnte er freundlicher werden, sprach er einmal ein freundliche Wort: wenn er als Kapitän auf seinem Schiffe stand. Mit den beiden königlichen Jachten, die ihm zur Verfügung gestellt waren, und mit seinen beiden eignen, ewerartig gebauten Schiffen, von denen das eine die Dogge, das andere der Drache hieß, fuhr er so oft wie angängig auf der tückischen Nordsee umher. Vielleicht hatte ers von seinen Ahnen: die Meinstorffs waren arge Seeräuber in früheren Jahrhunderten gewesen.
Sobald er sein Schiff betrat, war der ganze Mann verändert: die schwerfällige, starke Riesenfigur streckte und reckte sich: die traurigen, zu Boden blickenden Augen wurden lebhaft, weit und feurig; seine Stimme klang hell und scharf. Spritzte ihm der Gischt übers Gesicht, fiel der salzige Schleier wieder ab, lachte er. Als sei er erlöst aus schwerem Bann, so ganz wurde sein Wesen ein andres, wenn die Kommandeurflagge beim ersten Schritt, den er aufs Verdeck tat, am Topmast gehißt ward.
Auf einer dieser Fahrten, die er bis nach Helgoland, das ebenfalls unter seiner Verwaltung stand,[179] und weiter auszudehnen pflegte, kreuzte er zu eigensinnig gegen einen immer stärker werdenden Westwind. Sein langer rötlicher Schnurrbart lag fest bis zu den Ohren an den Backen. Endlich drehte er bei und raste nun mit vollgefaßten Segeln auf die Küste seiner Residenzinsel Schmerhörn zu. Die Ebbe war bedeutend im Fallen. Doch er, Flut und Ebbe verstehend und kennend, irrte sich diesmal in seinen Berechnungen: der Drache stieß mit hartem Knirschton auf eine Bank, und gleich die nächste See stürzte über die Jacht, Alles mit sich fortreißend, was sie erreichen konnte. »In die Wanten!« schrie Greggert. Und hier hielten er und seine Leute sich mit der Kraft, die die Todesgefahr einem jeden gibt. Mehr und mehr sank die Ebbe, und nach einer Stunde schon konnten alle von dem arg mitgenommenen Schiff auf den bloßgelegten Sand springen und nach halbstündiger Wandrung den Deich ersteigen.
Selbst der stahlgebaute Staller bedurfte eines Ausruhens, und so ging er mit der Mannschaft in ein nahgelegenes Wirtshaus, das, armselig genug, auf einer Werft zwischen Tagelöhnerwohnungen unmittelbar am Westerdeich seinen bescheidenen Giebel zeigte.
Es gehörte dem alten blinden Frerk Tadema Frerksen, der sich, nachdem er als holländischer See-Kapitän ein beträchtliches Vermögen erworben und[180] durch eine Fehlspekulation wieder verloren, auf seine Heimatinsel zurückgezogen hatte, um den Rest seines Lebens sich kümmerlich durchzubringen.
Die Wirtschaft führte seine Tochter Silk, die, auf Java geboren, wo ihre Mutter am Fieber gestorben, schon als Kind mit ihm hatte auf allen Meeren herumfahren müssen. Als er vor acht Jahren sein Geld eingebüßt, hatte Silk das sechzehnte Jahr erreicht. Seit der Zeit führte sie den Vorsitz in der kleinen Schenke.
Eine eigentümliche Schönheit war Silk. Viele behaupteten, sie wäre nicht die Tochter der Frau Frerk Tadema Frerksens, sondern das Kind einer Javaneserin, die der Kapitän längere Zeit an Bord gehabt. Und wunderbar war allerdings das Gemisch von Friesin und mongolischer Rasse in dem Mädchen. Von reizender, schlanker Gestalt, zeigten sich in dem blassen, schmalen Gesichtchen zwei ein wenig nach der graden Nase schief liegende, dunkelbraune Augen, die wie zwei schwarze Monde zwischen den weißen Liderwolken lagen; aber nur ein Streifen war von den Monden zu sehen. Das Haar hatte die echt flachsköpfig friesische Farbe und lag glatt zu beiden Seiten.
Ein eigentümlich Ding! Alle die zahlreich ihr gemachten Anträge hatte sie abgeschlagen. Stumm, lautlos die Gäste bedienend, saß sie die übrige Zeit[181] und strickte und nähte den ganzen Tag. Die Wirtschaft war wenig besucht, und so wurde es einsamer und einsamer um sie her. Umgang hatte sie nicht. Von den jungen Mädchen der Insel wurde sie gemieden, wie sie diese mied. Glitt sie mit ihren stillen Schritten an den Werften vorüber, ohne rechts und ohne links zu schauen, dann folgten ihr die Augen der Männer und in Haß die Blicke aller Weiber. Diese, ohne Ausnahme, waren einig, daß Silk eine schlechte Person sei, die ihre Männer behexe, und daß es ja auch von der »Heidin« nicht anders zu erwarten sei.
Und nun saß die schöne Silk dem allmächtigen Staller gegenüber. Dieser hatte in einem geschnitzten Sessel mit dunkelroten samtnen Kissen (sie waren Strandgut) Platz genommen. Silk hatte ihm warmes Getränk gebracht, hatte ihm in ihrer ruhigen Weise den Schemel zurecht geschoben, und dann, sich mit ihrer Arbeit ihm gegenübersetzend, auf die sie züchtig die Augen senkte, ihm gelassen auf seine Fragen geantwortet. Ihre Antworten aber begleitete sie mit dem Aufheben der oberen weißen Wolken, daß die schwarzen kleinen Vollmonde sekundenlang ihn mit ihrer Nachtpracht beschienen.
Und die schöne, blasse, stille Silk saß dem allmächtigen, riesigen, breitschultrigen Staller Greggert Meinstorff gegenüber.
Der Staller blieb nicht lange. Er gab dem Mädchen für die Zehrung ein Goldstück, das sie, ohne Dank, als selbstverständlich von einem so hohen Herrn, annahm. Als Greggert, aus der Haustür tretend, seinen Heimweg antrat, sah ihm Silk nach, bis er verschwunden war.
Und es waren seltsame Gedanken, mit denen sie ihn begleitete. Er, den sie seit Jahren im tiefsten Herzen trug, den sie nicht hoffen durfte zu sprechen, hatte ihr gegenüber gesessen, mit ihr gesprochen. Sie hatte eigentlich nur Sonntags in der alten Kirche »Zu unserer lieben Frauen auf dem Pferde« ihn beobachten können. Nicht aus Überzeugung, sondern um »denen Untertanen« ein gutes Beispiel zu geben, ging der Staller fast jeden Sonntag zum Gottesdienst. Dann stand Silk, nach friesischer Sitte, vor der Kirchtür. Sie wartete dort, bis er kam. Im Sommer, wenn die Wege gut waren, fuhr er mit sechs Pferden, Läufer voraus, Lakaien stehend auf der Rückseite, in schneller Gangart heran. Nur er, neben dem Könige, hatte im ganzen Lande das Recht, mit Sechsen zu fahren. Im Gotteshause hatte sie ihren Platz dem wappenreichen Gestühle des Stallers gegenüber. Sie konnte ihn genau beobachten. Über dem Eingange der reich geschnitzten Loge war das Allianzwappen angebracht. Der Meinstorffsche aufrecht schreitende Panther mit dem güldnen Krönlein,[183] und der Pogwischsche Wolf, der mit weit heraushängender Zunge gierig die Vorderpfoten auf einen Bauernzaun legt. Echt feudale Wappen!
Aber Silk hörte nicht auf die Worte des Seelsorgers, sie träumte und verzehrte sich in unbewußten, heißen Gluten. In ihrer kindlichen Einfalt bat sie den lieben Gott, er möge es bewerkstelligen, daß der ihr gegenübersitzende Staller einmal vor ihr zu Füßen falle, einmal ihr, wie sie wußte, daß es in der hochstehenden Gesellschaft üblich sei, die Hand küsse.
Allmählich schlichen sich in die kindlich-törichten Gedanken andre, herzliche. Silk wußte, wie jeder auf der Insel, wie unglücklich der Staller und seine Frau miteinander lebten: wenn sie dem ernsten, so trübe ausschauenden Manne etwas Liebes tun könnte, ihm irgend eine Freude bereiten! Aber Greggert war nicht gekommen, um ihr die Hände zu küssen. Er hatte sie nie bemerkt, auch in der Kirche nicht.
Und nun war er doch bei ihr gewesen. Ob er wieder kommen würde? –
Wie trug es sich doch zu, daß Greggert, als er auf dem Heimweg war aus der kleinen Schenke, den Kopf noch tiefer sinken ließ als gewöhnlich; wie kam es, daß er, im Schlosse eingetroffen, sofort befahl, die Dogge, das im Osterhafen liegende[184] Privatschiff, solle diese Nacht (die Flut trat um drei Uhr dreiundvierzig Minuten morgens ein) nach dem Westerdeiche fahren, und für ihn bereit liegen. Er fügte hinzu, daß er nach dem Wrack des Drachen hinaus wolle. Gründe pflegte sonst der hohe Beamte nicht anzugeben.
Am andern Mittag ging er nach dem Westerdeich, und Silk sah ihn kommen. Und wie er graden Weges auf die kleine Schenke zusteuerte, da lachte ihr Herz: er kommt um meinetwegen.
Der Staller war in Silks Zimmer getreten; in die Schenkstube … nun, das paßte sich auch nicht für ihn.
Er bat Silk, ans Fenster zu treten, und erzählte ihr, auf die See weisend, von dem gestrigen Unfall; dann mußte sie ihm über die Gegend, über die Werften, die er doch alle genau kannte, Auskunft geben.
Greggert Meinstorff hatte eine unruhige Nacht, unablässig schritt er in seinem Zimmer auf und ab und murmelte leidenschaftlich Silks Namen. Die Liebe hatte ihn mit aller Gewalt gepackt. Noch kämpfte er, ob er wieder das Wirtshaus mit seiner schönen Insassin besuchen wollte, und schon am nächsten Tage war er auf dem Wege nach dem Westerdeich. Silk hatte ihn erwartet. Als sie seine Schritte hörte, ging sie in die Küche. Er trat in[185] ihr Zimmer, und gleich darauf erschien auch sie in dem Gemache, als sei plötzlich eine weiße stille Rose aus der Knospe gesprungen. Der Staller zog sie an sich und küßte sie. Sie wehrte ihm nicht, aber erwiderte auch nicht seine Liebkosungen.
Schon rauschte die Sense über der zarten Blume: von Mund zu Mund ging es auf der Insel: der Staller hält es mit Silk Frerksen.
Arme Silk! Was hatte sie nun zu leiden. Aber sie ertrug alles, ertrug es seinetwegen. Sie wußte, daß auf allen Straßen Aufpasserinnen standen, daß, wenn Greggert bei ihr war, Lauscher überall wie Schatten an den Fenstern und Türen standen. Arme Silk!
Auch Greggert fühlte es. Aber wie in einem verzauberten Turm kam er sich vor, ohne Ausgang mehr in die Welt. Er überschüttete sie mit Geschenken.
Wie zum Hohn hatte er eines Tages seine Frau mit zu Silk genommen. Er wollte mit ihr eine Fahrt in See machen. Wie immer, war die eigne Frau die einzige, die nichts ahnte. Als sie die verwunderten Augen Silks auf sich gerichtet sah, kam ihr eine Ahnung; aber sie schob sie zurück als eine Unmöglichkeit.
Als am Abend dieses Tages der Staller Silk besuchte, trat wie eine heiße Sonne aus weißgeballten Sommerwolken zum erstenmal ihre Leidenschaft[186] hervor. Hatte sie nie gewagt, seine Liebkosungen zu erwidern, hatte sie, wenn er sie an sich zog, still den Kopf gesenkt – heute legte sie wie Schlangen ihre Arme um seinen breiten Nacken und küßte ihm die Lippen.

Ehebruch war und ist bis auf den heutigen Tag bei den Nordfriesen etwas Unerhörtes. Und nun sah die ganze Insel, wußten es die Halligen und das Festland den Eilanden gegenüber, der Küstenklatsch, daß der Staller in offnem Ehebruch lebte.
Greggert selbst litt am schwersten darunter – um seiner schönen Geliebten willen. Er liebte sie nur um so mehr. Das stille, geheimnisvolle Mädchen hatte sein ganzes Herz. Ihr öffnete er seine Seele, bei ihr vergaß er die Sorgen des Tages; zu ihr flüchtete er in aller Qual des Lebens. Wenn sie neben ihm saß in ihrer ruhigen Weise, strickend, auf einen Scherz von ihm kurz und eigentümlich lachend; wenn sie, ohne zu sprechen, an seiner Brust lag, ganz ihm mit aller Seele ergeben – das war sein Glück, ein Glück, das er nie gekannt.
Endlich war das Gerücht auch Frau von Meinstorff zu Ohren gekommen. Sie hatte nicht Stolz genug, sich von ihrem Manne zu trennen: in einem[187] furchtbaren Jähzornausbruch wollte sie ihre Rechte behaupten, und erreichte nur das Gegenteil.
Die Stellung des Stallers wurde unhaltbarer mit jedem Tage. Er selbst sah es ein.
Am nächsten Sonntag, als er wie gewöhnlich in seiner Emporloge saß, fühlte sich ein junger eifriger Geistlicher gemüßigt, das sechste Gebot in seiner Predigt auseinander zu setzen. Er ging zu Beispielen über, und nachdem er von David und Bathseba gesprochen, tadelte er scharf, ohne Namen zu nennen, aber doch für jedermann verständlich, das offenkundige Verhältnis.
Er hatte schon nach einer Stunde, nachdem die Rede geendigt, vom Staller den Abschied. Und das war Greggerts Todesstoß.
Am Nachmittage dieses Tages schrieb er einen langen Brief an den König. Aber hier durfte er kaum Verzeihung hoffen. Er schrieb ihm, wenn ihm ein natürlicher Sohn geboren würde, diesem seinen Namen geben zu wollen; er sei der Letzte seines Geschlechtes: es läge eine Art Berechtigung in seiner Bitte.
Am Abend wurde es stürmisch. Der Staller ging nicht zur Ruhe. Wie in tödlicher Angst bestieg er öfter den dicken steinernen Turm seines Hauses. Er fand keine Ruhe, die er sonst gefunden, je stärker der Wind ihn umsauste und zerzauste.
Als er gegen Morgen, es war eine kalte Märznacht gewesen, noch einmal den Turm bestieg, bemerkte er im Norden der Insel einen ungeheuern Feuerschein. Er überzeugte sich bald, daß dieser von der Hallig Buphever, die durch einen breiten Meeresarm von Schmerhörn getrennt war, herüberleuchtete. Es mußten dort mehrere Werften brennen.
Plötzlich zitterte er am ganzen Körper, er legte die Stirn gegen den Wind, er schien zu suchen, und er hatte gefunden. Ruhig stieg er in sein Arbeitszimmer hinab und kleidete sich zum Weggehen an. In diesem Augenblick wurde es im Hofe lebendig: der Feuerschein war auch von der Dienerschaft bemerkt worden.
Beim Weggehen befahl er seinen Leuten, ihn nicht zu begleiten. Der Wind, geradeaus von Norden kommend, packte ihn; doch er, sich ihm entgegenstemmend, kämpfte vorwärts. Sein Ziel war das Fährhaus, wo in einem eingebognen Teil des Steindeiches ein kleiner Hafen lag, in dem die Bote ruhten, die den Verkehr mit Buphever vermittelten.
Nun stand er auf der Krone des Deiches, ein Turm im Wetter. Seine Blicke waren nach Süden gerichtet, wo er das Häuschen sah, in dem Silk wohnte. Eine unbezähmbare Sehnsucht, zu ihr zu eilen, überkam ihn. Aber er bezwang sich. Mit einem[189] tieftraurigen Blick schied er und stieg hinunter, dem Fährhause zu.
Niemals erlaubt die Welt das Glück, das Greggert Meinstorff kurze Zeit besessen hatte.
Am kleinen Hafen war es lebendig. Schiffer, Fischer und alles, was schwielige Fäuste hatte, war damit beschäftigt, die heftig hin und her schaukelnden Bote mit soviel Tauwerk, als sie erlangen konnten, an Ringen und Bohlen zu befestigen. Die wahnsinnig gewordene See erlaubte nicht, daß auch nur der Versuch gemacht werde, den Buphevenern von Schmerhörn zu Hilfe zu kommen.
In diesem Augenblick traf der Staller im Hafen ein. Er rief einige Leute zu sich heran, um mit ihnen über das Feuer zu sprechen. Plötzlich verlangte er ein Bot: er wolle allein hinüber; keiner solle ihn begleiten. Alle beschworen ihn, von dem tollkühnen Gedanken abzulassen. Allein er, den ihn umringenden Kreis durchbrechend, schritt mit hastigen Schritten auf eins der Bote zu. Die Anwesenden halfen ihm beim Einsteigen, beim Segelaufsetzen, und bei allen jenen kleinen Handgriffen, die beim Flottmachen eines Fahrzeuges nötig sind.
Los! schrie der Staller. Und in schiefer Lage, mit Nordnordwest im Segel, schoß das Bot hinaus. Mit vorgebeugten Leibern, mit starren Gesichtern schauten ihm die Zurückgebliebenen nach – nur[190] zwei Minuten. Der Nachen war gekentert, und eine schwarze Masse, die sich mehr und mehr vom Kiel entfernte, bald auftauchend, bald verschwindend, trieb in die See. Doch nicht zu weit. Die Ebbe war im letzten Fallen. Der Körper Seiner Exzellenz lag in Sand und Schlick und Schlamm auf den Watten. Schon umkreiste ihn die Raubmöwe, den Kopf mit dem furchtbaren Schnabel prüfend über ihn gierend.
Der Morgen ahnte herauf. Im Osten zeigte sich ein fahles Rot; vor ihm her flog ein großer Vogel mit blauen Flügeln, wie ein solcher nie auf der Insel gesehen worden war, dem Ozean zu, ein eilender Verkünder der Sonne. Im Westen grollte die Ebbe ab, dumpf, als wenn sie sich in hunderttausend tiefe Abgründe stürze. Das Meer lag noch dunkel. Im Norden brannte in schauerlicher Größe die Hallig Buphever. Die schmutzigen, gelben Triele des in den Rinnen zurückgebliebenen Wassers, die Watten, die Bänke, die Muschelhaufen, alles war von rotgelben Tinten übergossen.
Der nächste Wagen war geholt. Die Leute hatten den Staller von den Watten aufgehoben. Er sah finster aus; Schaum stand ihm vorm Munde. Da er nur ganze kurze Zeit im Wasser gelegen hatte, so entfernte sich bald das Häßliche von seinem Körper, das sonst Wellenversunknen eigen zu sein pflegt.
Auf den Inseln aber und weit im ganzen Lande schwang sich bald von Ohr zu Ohr: der Staller Greggert Meinstorff ist ertrunken.

Schon zwei Tage nach dem Tode Greggerts war die Leiche in einem hölzernen Sarge, nachdem dieser dreimal nach altem friesischen, aus der Heidenzeit stammenden Gebrauch um die Kirche getragen, vor den Altar hingesetzt. Nach dem Gottesdienste hatte sich die Menge entfernt, und nur der Küster und seine Leute ordneten zum andern Morgen Blumen-Girlanden, stellten die großen Lichter in Bereitschaft, die die Nacht brennen sollten. Bei Tagesanbruch sollte der Sarg, getragen von den Angesehensten der Insel, auf ein königliches Schiff gebracht, nach dem Festlande abgehen, um in der Familiengruft, nachdem ein metallner Sarg ihn umschlossen, beigesetzt zu werden.
Frau von Meinstorff war noch immer nicht zu sich gekommen. Sie hatte in wildem Schmerz, als der Staller in die Kirche gefahren werden sollte, den Sarg umklammert. Mit sanfter Gewalt war sie endlich von den schwarzen Brettern entfernt worden.

Die großen Lichter brennen düster; sie knistern durch die Kirchenstille. Der Deckel der Truhe ist geöffnet: der Staller ruht feierlich mit über der Brust gekreuzten Händen, seine Augen sind geschlossen, es ist nichts Finsteres mehr in seinem Antlitz.
Frau von Meinstorff hatte den Küster bestochen, den Deckel zu öffnen: sie wollte in seiner Begleitung noch einmal ihren Mann diese Nacht sehen. Der Küster war ein alter, armer, schwacher Mann: er hatte ihren flehentlichen Bitten nachgegeben.
Die großen Lichter brennen düster; sie knistern. Ein verirrter Sperling, durch den Lichterschein schwer geängstigt, stößt gegen die Scheiben, fliegt durch die Gänge, über die Stühle, ruht sich auf dem Kelche aus. An seine kleine Brust klopft sichtbar das Herzchen.
Aus der Loge des Stallers, in der sie sich versteckt hatte, tritt Silk hervor. Das volle, schöne, lange Haar ist aufgelöst und hängt wirr um das süße, blasse Gesicht. Sie schleppt sich mühsam an den Sarg und fällt an ihm nieder. Die linke Hand versucht sich an seinem Rande aufzuhelfen. Sie sinkt zurück. Ihre schwere Stunde ist gekommen. Sie schenkt dem Toten einen Sohn. Aber das Kind, der letzte Meinstorff, stirbt bei der Geburt … und auch die Mutter schließt die lieben, treuen Augen für immer …
Die großen Lichter brennen düster; sie knistern durch die Kirchenstille. Der Sperling flattert noch immer in Todesangst umher.
Die Haupttür wird aufgeschlossen; und mit weitgeöffneten Augen, mit auf die Brust gepreßten Händen, in tiefe Trauer gekleidet, tritt Frau von Meinstorff ein. Der alte, schwache, grauhaarige Küster nimmt alle seine Kraft zusammen, um die Unglückliche zu stützen.
Es ist noch dunkel. Ferne brennen die Lichter; die großen Messingleuchter sind blank geputzt … Langsam, langsam … nun bleibt das Paar stehen … wieder einen Schritt vorwärts … langsam, langsam …
Da! Mein Gott, mein Gott!
Ein einziger, gellender Schrei klingt durch die schweigenden, hohen Hallen. Frau von Meinstorff stieß ihn aus.
Entsetzt ist der Sperling auf das große, schlechtgeschnitzte Kruzifix geflogen. Der Christus scheint zu leben. Von der stirnumstrickenden Dornenkrone blutet es; und eine liebe, unsäglich liebe Stimme spricht schwer vom Kreuze herunter:
»Wer aber nicht gesündigt, der werfe den ersten Stein auf sie.«
Der alte, schwache, grauhaarige Küster hat die Edelfrau in einen Stuhl gelegt. Dann ist er auf die[194] Kniee gesunken und betet; und dann singt er laut den ersten besten Vers aus dem Gesangbuch, der ihm gerade einfällt. Er ist aus einem Erntedanklied:
Er singt ihn näselnd, als gelte es den Anfang, um die Gemeinde dann mit einfallen zu lassen.

Frau von Meinstorff lebte noch lange Jahre auf dem Gute ihres Bruders. Sie ist bis an ihren Tod verwirrten Sinnes geblieben.



Zu Geschenken empfehlen wir unsere
▣ Zusammengestellten ▣
Geschenk-Bibliotheken:
Bibliothek A. 6 Bücher für zusammen 2 M. für die reifere Jugend: Hausbücherei Bd. 3, Volksbücher Heft 3, 10, 16, 21, 22 geheftet.
Bibliothek B. 8 Bücher für zusammen 5 M. (besonders für Knaben): Hausbücherei Bd. 1, 3, 15, 27, Volksbücher Heft 2, 13, 21, 23 geh.
Bibliothek C. 9 Bücher für zusammen 5 M. (besonders für Mädchen): Hausbücherei Bd. 2, 5, 16, 31, Volksbücher Heft 1, 3, 11, 16, 22 geh.
Bibliothek D. 8 Bücher für Erwachsene im Preise von zusammen 5 M.: Hausbücherei Bd. 4, 6/7, 14, Volksbücher Heft 7, 15, 19, 25 geh.
Bibliothek E. 16 Bücher für zusammen 10 M.: Hausbücherei Bd. 9, 17, 20/21, 29/30, Volksbücher Heft 1, 20, 21 gebunden, 7, 15, 17, 18, 22, 25 geheftet, Schillerbuch.
Bibliothek F. 25 Bücher für zusammen 20 M.: Hausbücherei Bd. 3, 6/7, 10, 11, 14, 18/19, 20/21, 22, 23, 24, 25/26, 27, 32, Volksbücher Heft 1, 3, 6, 10, 23 gebunden, 9, 11, 20 geheftet.
Druck von Grimme & Trömel in Leipzig.
Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung.

Die Stiftung ist ein rein gemeinnütziges Unternehmen unter Ausschluß aller privaten Erwerbsinteressen. Ihr Zweck ist, »hervorragenden Dichtern durch Verbreitung ihrer Werke ein Denkmal im Herzen des deutschen Volkes zu setzen« und durch Verbreitung guter Bücher der schlechten Literatur den Boden abzugraben. Seit dem Jahre 1903 verteilt sie alljährlich an eine stetig wachsende Zahl von Volksbibliotheken sorgfältig ausgewählte Zusammenstellungen guter volkstümlicher Bücher. Bis Ende 1909 wurden 245.954 Bücher an Volksbibliotheken verteilt.
Die Auflage der von der Stiftung herausgegebenen Sammlungen »Hausbücherei« und »Volksbücher« betrug bis Oktober 1910: 1.220.000 Exemplare.
Abzüge des Werbeblatts, des letzten Jahresberichts, auch des Aufrufs und der Satzungen usw. werden von der Kanzlei der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung in Hamburg-Großborstel gern unentgeltlich übersandt.
Die Stiftung erbittet jährliche oder einmalige Beiträge. Für Beiträge von 2 Mk. an gewährt die Stiftung durch Übersendung eines Einzelbandes ihrer »Hausbücherei« oder »Volksbücher« Gegenleistung.
Gute und billige Bücher
Unter den mancherlei billigen Sammlungen, die in den letzten Jahren zur Verbreitung guter Literatur geschaffen wurden, zeichnen sich die Bücher der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung durch sorgfältige literarische Auswahl und ausgezeichnete Ausstattung aus: holzfreies Papier, schönen und großen Druck, abwaschbaren, geschmackvollen Einband. Diese Eigenschaften haben in Verbindung mit dem äußerst billigen Preise den beiden Sammlungen der Stiftung schnell große Verbreitung verschafft.
Bisher sind erschienen:
Hausbücherei
(gebunden, jeder Band 1 Mark)
Bd. 1. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas. Mit Bild Kleists. 7 Vollbilder von Ernst Liebermann. Einleitung von Dr. Ernst Schultze. 11.–20. Taus. 170 S.
Bd. 2. Goethe: Götz von Berlichingen. Mit Bild Goethes. Einleitung v. Dr. W. Bode. 6.–10. Taus. 178 S.
Bd. 3. Deutsche Humoristen. 1. Bd.: Ausgew. humor. Erzählungen v. P. Rosegger, W. Raabe, Fr. Reuter und A. Roderich. 40.–45. Taus. 221 S.
Bd. 4. Deutsche Humoristen. 2. Bd.: Cl. Brentano, E. Th. A. Hoffmann, H. Zschokke. 20.–25. Taus. 222 S.
Bd. 5. Deutsche Humoristen. 3. Bd.: Hans Hoffmann, Otto Ernst, Max Eyth, Helene Böhlau. 30.–35. T. 196 S.
Bd. 6/7. Balladenbuch. 1. Bd.: Neuere Dichter. 16.–20. T. 498 S. 2 Mark.
Bd. 8. Herm. Kurz: Der Weihnachtsfund. Eine Volkserzählung. Mit Bild Kurz'. Einleitung v. Prof. Sulger-Gebing. 6.–10. Taus. 209 S.
Bd. 9. Novellenbuch. 1. Bd.: C. F. Meyer, E. v. Wildenbruch, Fr. Spielhagen, Detl. v. Liliencron. 26.–35. Taus. 194 S.
Bd. 10. Novellenbuch. 2. Bd. (Dorfgeschichten): E. Wichert, H.Sohnrey, W. v. Polenz, R. Greinz. 16.–20. T. 199 S.
Bd. 11. Schiller: Philosophische Gedichte. Ausgew. u. eingel. v. Prof. E. Kühnemann. Mit Bild Schillers. 6.–10. T. 230 S.
Bd. 12/13. Schiller: Briefe. Ausgew. und eingel. von Prof. E. Kühnemann. Mit 2 Bildern Schillers. 2 Bände in 1 Bande. 6.–10. Taus. 226 u. 302 S. 2 Mark.
Bd. 14. Novellenbuch. 3. Bd. (Geschichten aus deutscher Vorzeit): A. Schmitthenner, J. J. David, W. Hauff. 11.–20. Taus. 246 S.
Bd. 15. Novellenbuch. 4. Bd. (Seegeschichten): Joachim Nettelbeck, W. Hauff, Hans Hoffmann, W. Jensen, Wilh. Poeck, Johs. Wilda. 16.–20. Taus. 179 S.
Bd. 16. Auswahl aus den Dichtungen Eduard Mörikes. Herausgeg. u. eingel. v. Dr. J. Loewenberg-Hamburg. Mit Bild u. Silhouette Mörikes. 11.–20. Taus. 235 S.
Bd. 17. Heine-Buch. Eine Auswahl aus Heinrich Heines Dichtungen. Herausgeg. und eingel. von Otto Ernst-Hamburg. Mit Bild Heines. 6.–10. Taus. 203 S.
Bd. 18 u. 19. Goethes ausgewählte Briefe. Herausgeg. u. eingel. v. Dr. Wilh. Bode-Weimar. Mit Bildern Goethes. 2 Bände. 11.–15. Taus. 169 u. 197 S.
Bd. 20/21. Deutsches Weihnachtsbuch. Eine Sammlung der schönsten u. beliebtesten Weihnachtsdichtungen in Poesie u. Prosa. 16.–20. Taus. 413 S. 2 Mark.
Bd. 22. Novellenbuch. 5. Bd. (Frauennovellen): Cl. Viebig, L. v. Strauß u. Torney, Lou Andreas-Salomé, M. R. Fischer. 11.–20. Taus. 198 Seiten.
Bd. 23. Novellenbuch. 6. Band. (Kindheitsgeschichten): A. Schmitthenner, H. Aeckerle, M. Lienert, M. v. Rentz, Hans Land, A. Bayersdorfer, Ch. Niese, Th. Mann. 11.–20. Taus. 199 S.
Bd. 24. Novellenbuch. 7. Bd. (Kriegsgeschichten): Carl Beyer, H. v. Kleist, W. v. Conrady, M. v. La Roche, D. v. Liliencron, Th. Fontane. 11.–20. Taus. 177 S.
Bd. 25/26. Balladenbuch. 2. Bd.: Ältere Dichter. 6.–10. T. 518 S. 2 Mark.
Bd. 27. Karl Immermann: Preußische Jugend zur Zeit Napoleons. Herausgeg. u. eingeleitet von Dr. Wilhelm Bode-Weimar. Mit Bild Immermanns und 3 Bildern Magdeburgs. 6.–10. Taus. 171 Seiten.
Bd. 28. Martin Luther als deutscher Klassiker, nebst einer Einführung von Dr. Eugen Lessing. Mit Bild Luthers. 176 Seiten. 6.–10. Taus.
Bd. 29/30. Deutsche Humoristen. 4. und 5. Bd. (Humoristische Gedichte.) 351 Seiten. 2 Mark. 6.–10. Taus.
Bd. 31. Deutsche Humoristen. 6. Bd.: E. Th. A. Hoffmann, B. v. Arnim, Fr. Th. Vischer, A. Bayersdorfer, Henry F. Urban, Ludw. Thoma. 160 S. 11.–20. Taus.
Bd. 32. Max Eyth: Geld und Erfahrung (humoristische Erzählung). Mit Original-Illustrationen von Th. Herrmann und Einleitung von Dr. C. Müller-Rastatt, Hamburg. 176 Seiten. 6.–10. Taus.
Bd. 33. Ludwig Uhland: Ausgewählte Balladen und Romanzen. Mit Einleitung von K. Küchler, Altona, und Illustrationen von H. Schroedter, Karlsruhe. 160 S.
Bd. 34. J. J. David: Ruzena Capek. Cyrill Wallenta. Mit Einleitung von A. v. Weilen und Bild Davids. 146 S.
Bd. 35. Ludwig Finckh: Rapunzel. Mit Bild L. Finckhs und Einleitung von M. Lang. 159 S.
Bd. 36. Grethe Auer: Marraksch. Mit Bild Gr. Auers und Einleitung von Dr. H. Bloesch. 192 S.
Geschenkausgaben
in prächtigem, biegsamem Einband mit Goldschnitt sind zum Preise von je 4 Mark hergestellt von:
Schillerbuch, enth. Einltg. über Schillers Leben, die Glocke, Balladen, Tell. Mit Bild Schillers. 346 S. 21.–30. T. Geb. 1 M.
Volksbücher.
Heft 1. 50 Gedichte v. Goethe. 95 S. Geh. 20, geb. 50 Pf. 11.–20. T.
Heft 2. Schiller: Tell. 11.–20. T. 19 S. Geh. 30, geb. 60 Pf.
Heft 3. Schiller: Balladen. 31.–40. T. 108 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 4. Schiller: Wallensteins Lager. Die Piccolomini. 215 S. Geh. 30, geb. 60 Pf. 11.–20. T.
Heft 5. Schiller: Wallensteins Tod. 222 S. Geh. 30, geb. 60 Pf. 11.–20. T.
Heft 4 und 5 in einen Band gebunden 1 Mark. 11.–20. T.
Heft 6. Brentano: Die Geschichte vom braven Kasperl u. dem schönen Annerl. Ill. v. W. Schulz. 59 S. Geh. 15, geb. 40 Pf. 11.–20. T.
Heft 7. E. Th. A. Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi. 113 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 8. Fr. Halm: Die Marzipanliese. Die Freundinnen. Ill. v. H. Amberg. 124 S. Geh. 20, geb. 50 Pf. 11.–20. T.
Heft 9. Fritz Reuter: Woans ick tau 'ne Fru kamm. 61 S. Geh. 15, geb. 40 Pf. 11.–20. T.
Heft 10. Max Eyth: Der blinde Passagier. Ill. v. Th. Herrmann. 21.–30. T. 68 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 11. Marie von Ebner-Eschenbach: Die Freiherren von Gemperlein. 11.–20. T. 82 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 12. Wilhelm Jensen: Über der Heide. 11.–20. T. 127 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 13. Ernst Wichert: Der Wilddieb. 144 S. Geh. 30, geb. 60 Pf. 11.–20. T.
Heft 14. Levin Schücking: Die drei Großmächte. Illustr. v. H. Schroedter. 96 S. Geh. 25, geb. 55 Pf. 11.–20. T.
Heft 15. Ludwig Anzengruber: Der Erbonkel u. andere Geschichten. 11.–20. T. 86 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 16. Helene Böhlau: Kußwirkungen. 11.–20. T. 68 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 17. Ilse Frapan-Akunian: Die Last. 11.–20.T. 87 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 18. H. v. Kleist: Die Verlobung in St. Domingo. Das Erdbeben in Chili. Der Zweikampf. 142 S. Geh. 30, geb. 60 Pf.
Heft 19. Peter Rosegger: Der Adlerwirt von Kirchbrunn. 139 S. Geh. 30, geb. 60 Pf. 11.–20. T.
Heft 20. Ernst Zahn: Die Mutter. 11.–20. T. 66 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 21. E. J. Groth: Die Kuhhaut (Humoreske). Mit Illustr. v. Gg. O. Erler. 40 S. Geh. 15, geb. 40 Pf. 11.–20. T.
Heft 22. A. Schmitthenner: Die Frühglocke. Mit Illustr. v. Wilh. Schulz. 11.–20. T. 64 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 23. G. Freytag: Karl d. Große. – Friedrich Barbarossa. Minnesang und Minnedienst zur Hohenstaufenzeit. 80 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 24. Fr. Spielhagen: Hans u. Grete. Mit Illustr. v. Th. Herrmann. 11.–20. T. 174 S. Geh. 40, geb. 75 Pf.
Heft 25. St. v. Kotze: Geschichten aus Australien. 88 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 26. Paul Heyse: Andrea Delfin. 136 S. Geh. 30, geb. 60 Pf.
Heft 27. H. Villinger: Leodegar, der Hirtenschüler. Mit Ill. v. H. Eichrodt. 72 S. Geh. 20, geb. 50 Pf.
Heft 28. Otto Ludwig: Aus dem Regen in die Traufe. Ill. v. H. Schroedter. 123 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Heft 29. Richard Huldschiner: Fegefeuer. Mit Buchschmuck v. H. Amberg. 250 S. Geh. 70 Pf., geb. 1 Mark.
Heft 30. Franz Grillparzer: Weh dem, der lügt. 132 S. Geh. 25, geb. 55 Pf.
Druck von Grimme & Trömel in Leipzig.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht. Wiederholte Anführungszeichen an neuen Absätzen innerhalb der wörtlichen Rede wurden entfernt.
End of the Project Gutenberg EBook of Novellenbuch 1. Band, by
Conrad Ferdinand Meyer, Ernst von Wildenbruch, Friedrich Spielhagen & Detlev von Liliencron
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOVELLENBUCH 1. BAND ***
***** This file should be named 58306-h.htm or 58306-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/8/3/0/58306/
Produced by The Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.