
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Der Übersichtlichkeit halber wurden die Fußnoten an das Ende der jeweiligen Kapitel verschoben.
Friedrich von Lucanus
Im Zauber des Tierlebens
Dieses Buch
wurde als vierter Band der
siebenten Jahresreihe für die Mitglieder
des Volksverbandes der Bücherfreunde
hergestellt und wird nur an diese abgegeben.
Den Einband entwarf August Becker.
Das echte Ziegenleder wurde von der
Lederfabrik Carl Simon Söhne G. m. b. H.
in Kirn an der Nahe
geliefert
Nachdruck verboten
Copyright 1926 by Volksverband der Bücherfreunde
Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin

von
Friedrich von Lucanus
*
Mit einem Bildnis
des Verfassers und 32 Abbildungen
*
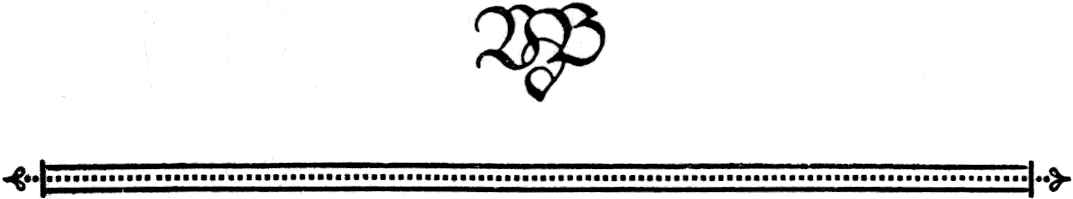
Volksverband der Bücherfreunde
Wegweiser-Verlag G. m. b. H.
Berlin 1926
[S. 5]
|
Tiere der Vorwelt
|
|
| Zeitalter der Erdgeschichte, ihre Tierwelt. Morgenrötetier. Brückenechse. Lanzettfisch. Saurier der Sekundärzeit. Das Mammut und andere Altelefanten. Der Urvogel Archäopteryx. Die Tierwelt des Tertiär. Entstehung des Pferdes. Die Eiszeit. Riesenhirsch. Moschusochse. Abstammung des Haushundes. Riesenalk und Dronte. Stammesgeschichte des Menschen, Neandertalrasse, Pithecanthropus, Rhodesiamensch, Australopithecus. | |
|
Fortpflanzung und Liebesleben
|
|
| Einzeller. Fortpflanzung durch Teilung und Knospung. Vielzeller. Haeckels Biogenetisches Grundgesetz. Blastula und Gastrulation. Schwämme, Hohltiere und Strahlentiere. Fortpflanzung der Würmer. Trichine, Bandwurm. Naturgesetze der Fruchtbarkeit. Liebesleben der Schnecken. Fortpflanzung und Liebesleben der Insekten. Parthenogenesis. Bienen, Ameisen, Ibisfliege, Gallwespe, Schlupfwespen. Polyembryonie. Eineiige und zweieiige Zwillinge. Fortpflanzung, Brutpflege und Liebesleben der Fische, Amphibien und Reptilien. Der künstliche Brutofen der Wallnister oder Großfußhühner. Perverses Liebesleben der Laufhühnchen. Winterbrut des Kreuzschnabels. Herbstbrunft des Rothirsches. Rauschzeit des Schwarzwildes im Winter. Fortpflanzung des Rehes und der Fledermäuse. Eierlegende Säugetiere. Beuteltiere. Der Dingo, ein Wildhund Australiens. | |
|
Biotechnik
|
|
| Die Schwimmblase des Fisches und ihre Bedeutung. Darmatmung. Hauptsinnesorgane der Fische. Ohr der Fische, seine [S. 6]Bedeutung als Gleichgewichtssinn und Geschwindigkeitsmesser. Das Schwimmen der Fische, Säugetiere und Vögel. Schwimmen der Quallen. Nesselorgane der Quallen als Dynamitbomben. Kletterbewegungen der Affen. Der Affenschwanz als Klammerorgan. Das Fliegen der Lurche, Kriechtiere, Fische, Säugetiere, Insekten und Vögel. Die Technik des Fliegens. Fluggeschwindigkeit und Flugdauer der Vögel. Stimme und Gesang der Vögel. Instrumentallaute des Storches, der Spechte, der Bekassine und der Enten. Instrumentallaute der Fische. Stimme der Lurche. Instrumentallaute der Reptilien. Klapperschlange, Klappschildkröte, Wundergecko. Das Zirpen der Heuschrecken, Grillen und Zikaden. Totenuhr. Kraftleistungen der Insekten. Holzwespen zerstören Stahlmantelgeschosse. Schnellapparat der Schnellkäfer. Pfeilschwanzkrebse. Elektrische Tiere. Zitterwels, Zitteraal, Zitterrochen. Besondere Instrumente: Eckzähne des Walrosses, Stoßzähne des Elefanten, Horn des Nashorns. Schwertfisch, Sägefisch, Hammerfisch. Seihapparat des Walfischmauls und der Wasservögel. Der Vogelschnabel als technisches Werkzeug. Die Saugzunge der Honigsauger, die Pinselzunge der Loris, die Löffelzunge des Ararakakadus. | |
|
Wanderungen
|
|
| Wanderungen der Zugvögel: Entfernung der Winterherberge, Schnelligkeit des Wanderfluges, Zugstraßen und Zug in breiter Front. Entstehung und Ursachen des Zuges. Tag- und Nachtwanderer. Geselliger und einsamer Zug. Fluganordnungen auf dem Zuge. Zugrichtungen, Höhe des Zuges. Orientierung. Wanderungen des Tannenhähers und Steppenhuhnes. Wandertaube und Karolinasittich. Wanderungen des Bisons. Bison, Wisent und Auerochse. Maßnahmen zur Erhaltung des Wisents in Europa. Rentier und Moschusochse. Wanderungen der Lemminge, Eichhörnchen, Ratten und Mäuse. Wanderungen des Aals und Lachses. Wanderungen der Schollen, anderer Flachfische und der Heringe. Heringsberge. Heringsfischerei. Orientierung der Fische und Vögel auf den Wanderungen. Heuschreckenplagen. Raupen der Prozessionsspinner. | |
|
[S. 7]
In Nacht und Finsternis
|
|
| Maulwurf und Goldmull. Guacharo. Ziegenmelker, Eulen und Kiwi. Koboldmaki. Olm, Blindwühlen, Ringelechsen, Blindschlangen, Geckos. Tierleben der Tiefsee. Leuchtorgane der Tiefseetiere. Tiefseeexpeditionen. Leuchtkäfer. Leuchtorgane der Prachtfinken. Bedeutung buntfarbiger Schnabelränder junger Sperlingsvögel. Winterschlaf und Sommerschlaf der Amphibien, Reptilien und Fische. Winterschlaf der Säugetiere: Haselmaus, Gartenschläfer, Siebenschläfer, Murmeltier, Fledermäuse, Hamster, Ziesel. Abnormer Sommerschlaf des Siebenschläfers. Dachs und Bär. | |
|
Kunst und Handwerk im Leben der Tiere
|
|
| Kunstbauten des Bibers. Leben des Maulwurfs, sein Brunnenbau. Nest der Zwergmaus. Der Ringelschwanzphalanger. Nest- und Fallenbau des Eichhorns. Netze der Spinnen. Erdbau der Minierspinne. Fallgrube des Ameisenlöwen. Kunst der Pillendreher. Leichenbestattung der Totengräber. Bauten der Bienen, Wespen, Ameisen. Gartenbau, Pilzkulturen und Ackerbau der Ameisen. Burgen der Termiten. Vogelnester. Die Vögel als Erdarbeiter, Zimmerleute, Töpfer, Korbflechter, Weber, Pfahlbauer und Schneider. Webeameisen. Sammelkörbchen der Bienen. Stachelkleid des Igels. Nestbau der Fische. Beruhen die Kunstbauten der Tiere auf Intelligenz? Bedeutung der angeborenen Triebe. Das Fliegen und Schwimmen der Vögel, die Art ihres Nahrungserwerbs und Nestbaues. Die Kunstbauten des Bibers als Triebhandlungen. Affekte, Verwertung von Erfahrungen. Assoziation. Artliche und individuelle Unterschiede in der geistigen Begabung. Gehirn der Vögel. Intelligenz der Menschenaffen. Anthropoidenstation auf Teneriffa. Gebrauch von Werkzeugen durch Affen. Gedächtnis des Schimpansen und anderer Tiere. Begriff des Zeitunterschieds und das Ichbewußtsein beim Tier. Soziales Leben des Schimpansen. Geselligkeitstrieb. Verteidigung bedrängter Artgenossen. Kunst- und Schönheitssinn der Tiere. | |
|
[S. 8]
Schutzfarben und Nutztrachten
|
|
| Mimikry. Stabheuschrecke. Wandelndes Blatt. Mimikry der Schmetterlinge, der Teufelsblume und Gottesanbeterin. Der Fetzenfisch. Schutzfärbung des Laubfrosches, der Wüstenspringmaus, des Schneehuhnes und anderer Tiere. Bodenfarbiges Gefieder der Erdbrüter. Sommerkleid der Erpel. Schutzfarbe der Fische. Farbenveränderung der Fische, des Laubfrosches und einiger Reptilien. Das Stachelkleid des Molochs, Riesengürtelschweifs und der Krötenechse. Blutspritzen der Krötenechse. Warnfarbe giftiger Tiere. Somalyse. Entstehung der Schutzfarben. Darwinismus. Entwicklungslehre und Religion. Unsterblichkeit. Neue Forschungen über die Entstehung der Färbung der Tiere. Wert der Schutzfarbe. Mimikry des Kuckuckseies. | |
|
Verstellungskünste
|
|
| Vorgetäuschte Flügellahmheit der Vögel. Schutz- und Schreckstellungen. Giftige Fische. Tarnkappe des Tintenfisches. Sichtotstellen der Insekten. | |
|
Soziales Leben und Staatenbildung
|
|
| Vergesellschaftung der Schmetterlinge, Eidechsen und Salamander. Massenauftreten der Raupen, ihre Orientierung durch den Tastsinn. Schwarmbildung der Fische. Rudel der Hirsche, Antilopen, Zebras und Büffel. Gemeinsame Verteidigung der Moschusochsen. Wachposten der Gemsen und Steinböcke. Soziales Leben der Affen. Horden- und Familienleben der Menschenaffen. Angriffe des Gorillas auf den Menschen. Raubtiere. Jagden der Wölfe und des Hyänenhundes. Gemeinsamer Fischfang des Schuhschnabels und der Schlangenhalsvögel. Geselligkeitstrieb der Vögel. Symbiose. Krokodil und Krokodilwächter. Madenhacker. Symbiose eines Fisches und einer Aktinie. Parökie der Korallenfische. Synökie des Nadelfisches mit der Seegurke. Schiffshalter. Parasitismus der Fische. Tierkolonien der Blumentiere. Korallenriffe. Seefedern. Staatsquallen.[S. 9] Staatenbildung der Bienen und Ameisen. Arbeitsteilung, Sklaverei, Kriegführung, Viehhaltung der Ameisen. Narkotische Genußsucht. Treibjagden der Treiberameisen. Staatsleben der Termiten. Verständigung der Termiten und Ameisen. Farbensinn der Insekten. Sprache der Bienen. |
[S. 10]
|
1.
|
Diplodocus
|
|
|
2.
|
Flugsaurier
|
|
|
3.
|
Ameisenigel (eierlegendes Säugetier)
|
|
|
4.
|
Schnabeltier (eierlegendes Säugetier)
|
|
|
5.
|
Eichhörnchen-Flugbeutler
|
|
|
6.
|
Mondfisch
|
|
|
7.
|
Königspinguin
|
|
|
8.
|
Fliegender Fisch
|
|
|
9.
|
Schwertfisch
|
|
|
10.
|
Tukan
|
|
|
11.
|
Bison
|
|
|
12.
|
Rentier
|
|
|
13.
|
Rentierherde
|
|
|
14.
|
Uhu
|
|
|
15.
|
Kiwi
|
|
|
16.
|
Blattschwanzgecko
|
|
|
17.
|
Zwergmäuse mit ihren Nestern
|
|
|
18.
|
Kreuzspinne bei der Anfertigung des Netzes
|
|
|
19.
|
Stabheuschrecken
|
|
|
20.
|
Wandelndes Blatt
|
|
|
21.
|
Chamäleon mit vorgestreckter Zunge
|
|
|
22.
|
Riesengürtelschweif
|
|
|
23.
|
Krötenechse
|
|
|
24.
|
Anoli
|
|
|
25.
|
Kragenechse
|
|
|
26.
|
Kugelfisch
|
|
|
27.
|
Harzhirsch in der Suhle
|
|
|
28.
|
Gorilla
|
|
|
29.
|
Junge Schimpansen
|
|
|
30.
|
Schimpanse
|
|
|
31.
|
Junger Orang-Utan
|
|
|
32.
|
Orang-Utan „Sandy“
|
[S. 11]
Die Fauna, die heute die Erde belebt, ist nicht das Werk eines einmaligen Schöpfungsaktes. Sie ist aus bescheidenen Anfängen hervorgegangen und hat sich allmählich zu jenen Formen ausgewachsen, die heute die jeweiligen Endglieder in der Stufe der stetig fortschreitenden Entwicklung und Umwandlung bilden.
Ebenso wie die Erde selbst vielfachen Umformungen unterworfen war, und unter dem Wechsel des Klimas die Vegetation eine wiederholte Umbildung erfuhr, war auch der Charakter der Tierwelt in den verschiedenen Erdperioden ein ganz anderer.
Die Paläontologie unterscheidet fünf Zeitalter der organischen Erdgeschichte: Das Archozoische Zeitalter oder Primordialzeit, das Paläozoische Zeitalter oder Primärzeit, das Mesozoische Zeitalter oder Sekundärzeit, das Känozoische Zeitalter oder Tertiärzeit und das Anthropozoische Zeitalter oder Quartärzeit, jene Zeit, in der der Mensch in die Welt tritt.
Innerhalb dieser Zeitabschnitte lassen sich verschiedene Unterabschnitte erkennen. Während die Primordialzeit nur eine Formation, die Laurentische, aufweist, setzen sich die übrigen Zeitalter aus mehreren Formationen zusammen. Es würde zu weit führen, sie alle einzeln zu nennen. Hervorgehoben sei nur, daß die Steinkohlenformation der oberen Primärzeit angehört, daß die Sekundärzeit sich in drei Formationen, Trias, Jura und Kreide, die Tertiärzeit ebenfalls in drei Formationen, Eozän, Miozän und Pliozän, und die Quartärzeit in zwei Unterabschnitte,[S. 12] Diluvium und Alluvium, das die heutige Zeitepoche ist, gliedert.
Diese Zeitperioden sind eine mehr oder weniger willkürliche Einteilung, ein System der paläontologischen Wissenschaft. In Wirklichkeit gibt es keine scharfen Trennungsstriche, sondern allmähliche, über Jahrtausende sich erstreckende Übergänge reihen die Erdperioden unmerklich aneinander und verschmelzen sie zu einem einheitlichen Ganzen. Langsam und allmählich entstand das Tier- und Pflanzenleben. Jahrtausende und Jahrmillionen waren notwendig, um eine Veränderung der Formen hervorzurufen, Altes vergehen und Neues entstehen zu lassen. „πάντα ῥεῖ“, wie Heraklit so treffend sagte, „Alles dauernd im Fluß“. —
Das älteste Gestein der Laurentinischen Formation ist der kristallinische Schiefer. Da er Kohlensubstanz, Graphit und Anthrazit sowie Kalk enthält, so ist die Annahme eines organischen Lebens in dieser Zeit durchaus berechtigt; denn Kohle ist der Rückstand einer ehemaligen Vegetation und Kalk der Rest von Muschelschalen und anderen tierischen Gehäusen. Von anderer Seite wird freilich gegen die Annahme eines organischen Lebens in jener Zeitperiode Einspruch erhoben, weil im kristallinischen Schiefer Versteinerungen nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können. Dann müßte man freilich annehmen, daß Kalk und Kohle in diesem Falle ihren Ursprung nicht aus der organischen Welt herleiten, sondern auf eine andere Weise entstanden sind. Dies widerspricht jedoch unserer Auffassung von dem Wesen dieser Stoffe.
Im Laurentinischen Gestein in Kanada fand man eigentümliche Gebilde, die ein Netzwerk von Verästelungen darstellten. Namhafte Forscher sehen hierin die Versteinerungen von einzelligen Tieren aus der Ordnung der Wurzelfüßer oder Rhizopoden, die[S. 13] aus einem Protoplasmakörper mit einem kalkartigen Gehäuse bestanden haben. Trifft diese Erklärung zu, dann würde dies einzellige Wesen der Primordialzeit das älteste Tier der Erdgeschichte sein, jenes Wesen, auf das sich die spätere Entwicklung der ganzen Tierwelt aufbaut und das gewissermaßen die Morgenröte in der Tierwelt darstellt. Man hat es daher das „Morgenrötetier“ genannt.
Von anderen Forschern wird freilich der organische Ursprung dieser Zeichen in dem ältesten kanadischen Gestein geleugnet. Sie meinen vielmehr, daß es sich nur um eine anorganische Bildung im Gestein selbst handelt. Die Frage ist heute noch ungelöst, und infolgedessen sind organische Versteinerungen in der Primordialzeit noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen.
In der Primärzeit, dem Altertum der Erdgeschichte, gab es in den ersten Perioden bereits Würmer, Krebse, Schnecken und andere Weichtiere, wie uns Abdrücke ihrer Fußspuren und Versteinerungen erkennen lassen. Sogar die ersten Wirbeltiere traten auf in Gestalt eigentümlicher Fische mit gepanzertem Körper und einer einheitlichen Augenöffnung auf der Mitte der Stirn, die darauf hindeutet, daß diese Tiere vielleicht einäugig waren; jedoch können in der länglich geschlitzten Augenöffnung auch zwei Augen dicht nebeneinander gelegen haben. Insekten, die an die heutigen Grillen, Skorpione und Eintagsfliegen erinnern, lebten bereits zu jener Zeit. Auch die typische Meeresfauna, Korallen, Stachelhäuter und Quallen, war schon vorhanden. Am Ende dieser Zeitperiode traten die ersten Amphibien und Reptilien auf.
Noch heute lebt auf Neuseeland ein Vertreter jener ältesten Reptilien. Es ist dies die Brückenechse (Sphenodon punctatus), eine etwa 75 cm große Eidechse von plumper Gestalt mit großem, eckigem Kopf. Kopf, Rücken und Schwanz tragen einen Kamm[S. 14] aus Stacheln. Die Farbe des Tiers ist olivgrün mit kleinen hellen Flecken. In ihrem inneren Bau, dem Skelett und den Organen vereinigt die sonderbare Echse Merkmale der Lurche, Schildkröten und Schlangen. So bildet die Brückenechse eine Mittelform, eine „Brücke“, zwischen diesen Tieren. Der heutigen Brückenechse sehr nahe verwandte Formen, die Urbrückenechse und der Protorosaurus, sind bereits aus den Versteinerungen der oberen Primärzeit bekannt. Die Brückenechse ist daher eins der ältesten Wirbeltiere, das sich aus den Anfängen der Erdgeschichte bis auf den heutigen Tag in fast unveränderter Form erhalten hat.
Ein würdiges Seitenstück zur Brückenechse ist der Lanzettfisch, ein kleines, nur wenige Zentimeter langes fischähnliches Wesen, das an den flachen Meeresküsten lebt. „Ein Schauer der Ehrfurcht“, sagt Otto Steche in der neuen Ausgabe von Brehms Tierleben, „müßte den Beobachter, dem unsere Vorstellungen über die Entwicklung der Tierreihe nicht bloße Worte sind, beim Anblick dieses unscheinbaren Tieres erfüllen. Gilt es doch für den Urahnen unseres Stammes, das älteste Tier, von dem wir mit einiger Sicherheit die Reihe der Wirbeltiere ableiten können, als deren höchste Blüte wir Menschen uns zu betrachten gewohnt sind.“
Der Lanzettfisch (Amphioxus) bildet mit wenigen Verwandten den besonderen Unterkreis der schädellosen Wirbeltiere (Acrania), denen, wie schon der Name verrät, ein Schädel fehlt. In seiner langgestreckten, flachen Gestalt ähnelt Amphioxus einem dünnen Weidenblatt. Ein Kopf ist nicht vorhanden, sondern das vordere Leibesende läuft ebenso wie das hintere Ende in eine Spitze aus, die eine runde Öffnung besitzt.
Äußere Gliedmaßen fehlen, nur ein schmaler Flossensaum steht auf dem Rücken und verbreitert sich hinten zu einer lanzettförmigen[S. 15] Schwanzflosse. Eine eigentliche Wirbelsäule ist noch nicht vorhanden, sie wird nur durch einen dünnen, knorpeligen Strang angedeutet, der Achsenstab (Chorda dorsalis) genannt wird. Unmittelbar über dem Achsenstab, und mit diesem durch eine Scheide verbunden, läuft ein Markstrang, der dem Rückenmark der höheren Wirbeltiere entspricht. Die vordere Leibesöffnung dient als Mund, die hintere als After. Beide Öffnungen sind durch einen Darm verbunden. Der Darm ist durch eine Einschnürung in zwei Hälften geteilt. Der vordere Teil dient ausschließlich der Atmung. Das zur Atmung durch die Mundöffnung eingezogene Wasser sickert durch die Darmwand in die Leibeshöhle und läuft durch eine besondere Leibesöffnung nach Verbrauch des Sauerstoffs wieder nach außen ab. Der hintere Teil des Darmes besorgt die Verdauung der aus Infusorien bestehenden Nahrung, die mit dem Wasser aufgenommen wird. Ein am hinteren Darmteil befindlicher Sack funktioniert in einfachster Form als Leber. Ein Herz fehlt; der Kreislauf des farblosen Blutes wird durch die Adern selbst verursacht. Der Lanzettfisch ist getrennten Geschlechts. Ei- und Samenzellen befinden sich in kleinen Taschen im Leibe und werden durch die Mundöffnung ausgestoßen.
Amphioxus stellt offenbar den Urtyp des Wirbeltieres dar. Er zeigt uns in seiner wurmähnlichen Gestalt die Umformung des Wurmes zum Wirbeltier. Mit Recht dürfen wir daher den Lanzettfisch als das älteste Wirbeltier betrachten, das jedenfalls noch bedeutend älter sein muß als die Brückenechse mit ihrer schon vollendeten Wirbeltiergestalt und jene Fische, die schon in der oberen Primärzeit die Gewässer bevölkerten. Sein Ursprung liegt viel weiter zurück, er ist eine Schöpfung mindestens der ältesten Primärperiode, der Kambrischen Formation, vielleicht sogar der allerältesten Zeitepoche, des archozoischen Erdalters.
[S. 16]
Die typischen Tiere der Sekundärzeit sind jene gewaltigen Riesenechsen, die Saurier, die zusammen mit riesenhaften froschähnlichen Amphibien die Erde belebten.
Das Gebiß dieser Reptilien erinnert mit seinen mächtigen, spitzen Eckzähnen teils an das Gebiß der heutigen Raubtiere, teils mit seinen gleichförmigen Zahnreihen an das Gebiß der Pflanzenfresser und des Menschen.
In der Jurazeit finden wir die Fischechsen Ichthyosaurus und Plesiosaurus, beides echte Wasserbewohner mit zu Flossen gewordenen vorderen und hinteren Gliedmaßen, die ihr Wesen nach Art der Walfische im Weltmeer trieben. Der kurzhalsige Ichthyosaurus hatte eine lange, schnabelartige, mit zahlreichen Zähnen bewaffnete Schnauze, während der langhalsige Plesiosaurus mit seinem gestreckten, geschmeidigen Körper einen kleinen, schlangenartigen Kopf besaß und in hervorragender Weise dem Leben im Wasser angepaßt war. Der Plesiosaurus übertraf den Ichthyosaurus bedeutend an Größe. Das Tier erreichte eine Länge von etwa 15 m, wovon fast die Hälfte auf den Hals kam, der je nach der Art 40–72 Wirbel besaß. Dieser lange, offenbar sehr bewegliche Hals machte das Tier zu einem gewandten Fischfänger.
Noch gewaltiger waren die Körperdimensionen der Landsaurier jener Zeit. Der aufgefundene Oberschenkelknochen eines Atlantosaurus zeigt bei einer Dicke von 0,63 m eine Länge von nicht weniger als 2 m. Die Gesamtlänge dieses Riesen schätzt man auf etwa 30 m.
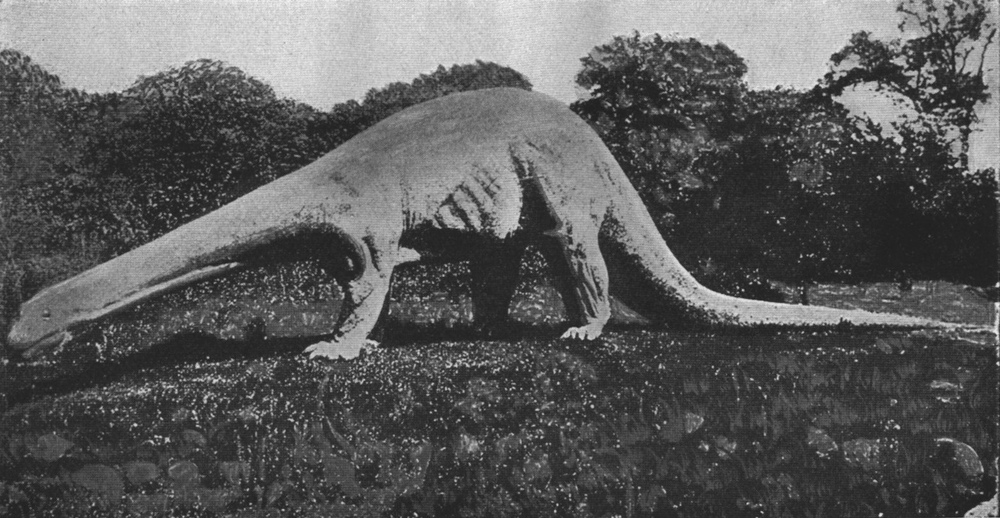
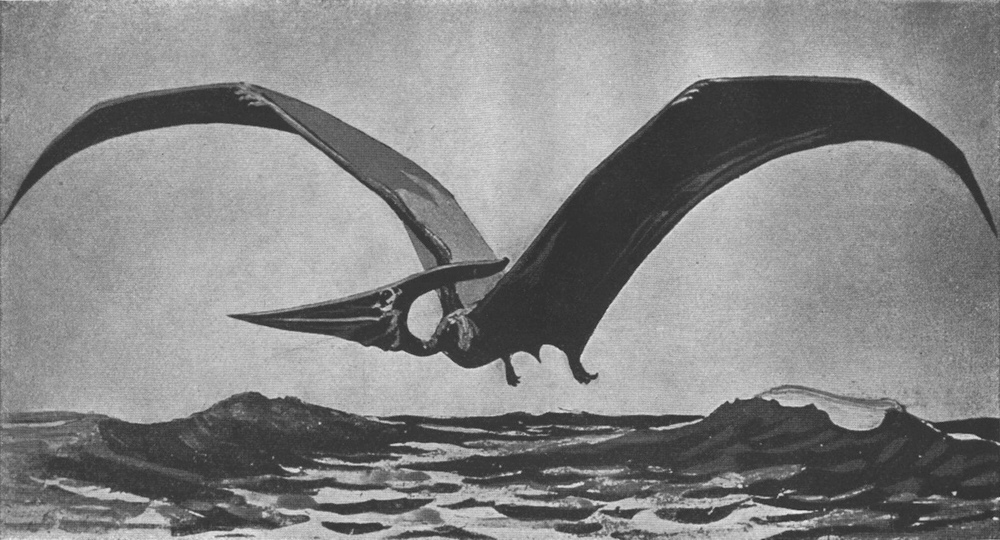
Ein gewaltiges Saurierlager entdeckte vor zwei Jahrzehnten die Berliner Tendaguru-Expedition in unserer einst so stolzen Kolonie Ostafrika. Ihre Ausgrabungsarbeiten, die wertvolles und hochinteressantes Material zutage förderten, werden heute von den Engländern mit Eifer fortgesetzt. Ganz gewaltige Knochen Jahrmillionen[S. 17] alter Drachentiere sind im Tendagurugebiet gefunden worden. Oberarmknochen von mehr als 2 m Länge kamen zum Vorschein. Man hat das Wesen, das diesen massigen Arm getragen hat, Brachiosaurus genannt, das vielleicht das größte Geschöpf war, das jemals auf der Erde als Landtier gelebt hat, und das den berühmten Diplodocus Amerikas, der bei 25 m Gesamtlänge das größte völlig erhaltene Saurierskelett ist, was bisher aufgefunden wurde, wohl noch übertroffen hat.
An dem Skelett des Diplodocus (Abbildung 1), das eine Höhe von 4 m hat, fallen besonders der ungeheuer lange Schwanz und der sehr lange Schwanenhals auf, die beide an Länge den Rumpf ganz erheblich übertreffen. Der lange Hals trägt einen sehr kleinen, flachen, breitschnauzigen Kopf, der zu der Körpergröße des Tieres in gar keinem Verhältnis steht. Der lange Hals wurde wahrscheinlich beim Schreiten in die Höhe gestreckt, so daß das Tier im hohen Farn- und Schachtelhalmwald einen freien Überblick hatte. Die vier Beine sind ungefähr gleich groß und haben den Körper in wagerechter Haltung getragen. Der Diplodocus führte wahrscheinlich eine amphibienartige Lebensweise, d. h. er hielt sich sowohl im Wasser wie auf dem Lande auf. Dem Gebiß nach zu urteilen, das aus langen, dünnen Zähnen im vorderen Teil der Kiefer besteht, ist der Diplodocus ein Pflanzenfresser gewesen. Er hat wohl Algen und Wasserpflanzen vom Wassergrunde aufgenommen, wobei ihm der lange Hals zum Tauchen und Gründeln zustatten kam. Die gewaltigen Knochen des Tieres sind im Verhältnis zu ihrer Größe außerordentlich leicht, da sie nicht massiv sind, sondern große Hohlräume enthalten, worin man eine gute Anpassung an ein Wasserleben erblicken kann. Das trotz seiner Größe sehr leichte Knochengerüst befähigte das Tier zum Schwimmen und Tauchen.
[S. 18]
Das Gewicht eines lebenden Diplodocus kann auf 20000 kg geschätzt werden. Der Diplodocus war also fünfmal so schwer als ein ausgewachsener Elefant, der etwa 4000 kg wiegt.
Einen noch kleineren Kopf hatte der in Größe und Aussehen dem Diplodocus ähnliche Brontosaurus. Sind schon die Halswirbel zum Teil größer als der Schädel, so erreicht das Rückenmark seine größte Ausdehnung in den Lendenwirbeln, wo sein Umfang das Hirn um das Dreifache übertrifft, so daß man geradezu von einem „Beckenhirn“ reden kann.
Die geistigen Fähigkeiten dieser Tiere können nicht groß gewesen sein; sie wirkten lediglich durch die Masse ihres Körpers.
Dasselbe Mißverhältnis zwischen Kopf und Rumpf zeigt auch der Stegosaurus, eins der wunderlichsten Geschöpfe, das jemals die Erde beherbergt hat. Bei diesem Tier ist der Markraum der Lendenwirbel sogar zehnmal so groß als der Hirnraum des winzigen, spitzen Kopfes. Der ganze Körper der 10 m langen Echse war mit einem Panzer aus Knochenplatten bedeckt. Auf dem Rücken und dem hinteren Schwanzende stand ein gewaltiger Kamm aus hohen, breiten und flachen knöchernen Platten. Das Schwanzende war mit langen, spitzen Stacheln bewehrt, die zweifellos eine fürchterliche Waffe bildeten. Das Tier erwehrte sich seines Gegners mit Schwanzschlägen, wobei die Stacheln wie Speere den Angreifer durchdolchten. Die Hinterfüße waren länger als die Vorderfüße, und man darf daher vermuten, daß das Tier sich ähnlich wie ein Frosch hüpfend fortbewegte. Man stelle sich ein solches Ungetüm, mit Panzerplatten und Speeren bewaffnet, vor, wie es langsam dahinkriecht oder hüpfend auf einen zukommt, und man wird die grotesken Tiergestalten der Sekundärzeit bei reicher Phantasie einigermaßen begreifen können.
[S. 19]
Im Gegensatz zu Diplodocus und Brontosaurus hatte Stegosaurus nur einen kurzen Hals.
Kurzhalsig war auch der dreigehörnte Ochsensaurier Triceratops. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Formen hatte er einen sehr großen Schädel von geradezu abenteuerlicher Form. Der hinten sehr breite Kopf verjüngt sich nach vorn auffallend und läuft in eine Schnauze aus, die einem Papageischnabel nicht unähnlich ist. Auf der Stirn stehen zwei lange, nach oben gerichtete Hörner, wie beim Ochsen, und auf der Nase ein drittes kürzeres Horn wie beim Nashorn, die Waffen von Ochse und Nashorn auf einem Tier vereint! Den Abschluß des Hinterkopfes zum kurzen Hals bildet ein breiter Hornkragen. Der große Kopf hat eine nur winzige Hirnhöhle. Die geistige Begabung des Triceratops war also auch nicht größer als bei den kleinköpfigen Verwandten.
Der Körper des wunderlichen Unholds war anscheinend gepanzert.
Außer dem Ochsensaurier sind noch andere gehörnte Reptilien aus dieser Zeit bekannt, die jedoch meist eine geringere Körpergröße hatten.
Wieder andere Formen hatten sehr kurze Vorderfüße, aber sehr lange Hinterfüße, mit denen sie nach Känguruhart in aufrechter Haltung hüpften. Diese Springsaurier, Compsognathus genannt, waren nicht größer als eine Springmaus, also Zwerge neben den Riesenformen.
Eine aufrechte Körperhaltung hatte auch das etwa 10 m lange Iguanodon, das sich mit seinen kurzen Hinterbeinen nicht springend, sondern schreitend oder trabend vorwärts bewegte und dabei auf den langen, kräftigen Schwanz stützte.
Eine andere Form der Saurier waren die Flugsaurier, die wie die Fledermäuse eine Flughaut besaßen, die an den Hinterfüßen[S. 20] begann, sich an den Körperseiten entlangstreckte und an den Händen der vorderen Gliedmaßen sich zu einer weiten Flugfläche entfaltete. Sie hatten eine spitze Schnauze, die an den Vogelschnabel erinnerte. Mit den heutigen Vögeln haben jedoch diese Flugsaurier nichts zu tun. Sie können nicht als ihre Vorfahren betrachtet werden, da ihre Flugwerkzeuge nach einem ganz anderen Prinzip gebaut waren. Die Flugsaurier waren Fallschirmflieger, die nach Art der Fledermäuse im Flatterflug sich durch die Luft bewegten ().
Durch die aufgefundenen Knochenreste und teilweis völlig unversehrten Skelette sind wir über das Aussehen der Saurier der Sekundärepoche ganz vorzüglich unterrichtet. Die Drachen, von denen eine Siegfriedmär und andere Sagen alter Zeit berichten, treten in den gewaltigen Sauriern als lebende Geschöpfe vor unser Auge. Sie sind keine Erfindung dichterischer Phantasie, die Sage wird hier zur Wahrheit!
Im Jahre 1923 machte eine amerikanische Ausgrabungsexpedition in Asien am Fuße des Altai eine neue, hochwichtige Entdeckung. Sie fand die ersten versteinerten Sauriereier, die in ihrer Gestalt und mit der gekörnten Oberfläche den Eiern der heutigen Reptilien sehr ähnlich sind. Sie waren mit erhärtetem Sand gefüllt. In einem Ei ließen sich sogar Knochenreste eines Embryos nachweisen. Die Eier haben eine Länge von 20 cm. Etwa zehn Millionen Jahre sind diese Eier unberührt an dem Platz geblieben, wo sie einst von einem gewaltigen Saurier abgelegt worden sind. Sie wurden viele Hundert Meter tief verschüttet, versteinerten hier und wurden nach langer Zeit durch die Erosion, welche an dem mongolischen Felsen Jahrtausende und aber Jahrtausende nagte, wieder ans Tageslicht befördert.
[S. 21]
Auf welche Weise konnten sich überhaupt die Knochen der Saurier Jahrmillionen erhalten? Die Tiere versanken durch das Gewicht ihres gewaltigen Körpers in den Schlamm und erlitten den Erstickungstod. Der Schlamm schloß die Luft ab und bewahrte den Riesenleib vor Verwesung. Das Fleisch vertrocknete, die Knochen blieben erhalten. Der Schlamm wurde im Laufe der Zeit durch die Umwandlung der Erde zu hartem Gestein, auch die darin geborgenen Knochen versteinerten und wurden zum Fossil. An der Stätte, wo der Forscher heute freudestrahlend den verborgenen Schatz hebt, hat sich ehemals ein grausiges Drama im Kampf ums Dasein abgespielt.
Die Riesensaurier der Sekundärzeit dürfen wir nicht als Stammformen der heutigen Säugetiere betrachten. Jene gewaltigen, ungeschlachten Geschöpfe mußten von der Bühne des Lebens abtreten, als die Erde eine andere Oberflächengestalt erhielt, in die sie nicht hineinpaßten.
Als Ahnen der heutigen Säugetiere kommen kleinere Reptilienformen in Betracht, deren Knochenbau und vor allem Zahnbildung sehr an die heutigen Säugetiere erinnert. So wurde in der Triasformation Afrikas der Schädel eines Reptils gefunden, der ein vollständiges Raubtiergebiß besitzt. Man hat dies Tier, das vielleicht der Urahn der Raubtiere ist, Lycosaurus curvimola benannt. Das Gebiß eines anderen Tieres, Pareiosaurus serridens, hat große Ähnlichkeit mit einem Pferdegebiß. Wieder ein anderer Schädel besitzt das Gebiß des Igels. Das Problem, ob diese vorweltlichen Tiere, die man als Gruppe der „Theromorphen“ zusammengefaßt hat, wirklich als die Stammväter der heutigen Säugetierwelt und damit auch des Menschen anzusehen sind, ist freilich noch nicht gelöst. Die Ansichten der Paläontologen widersprechen sich zum Teil. Soviel ist aber sicher, daß[S. 22] die Theromorphen in der Phylogenie der Säuger eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. —
Die Funde aus der Sekundärzeit zeigen uns, daß es schon damals Säugetiere gegeben hat. Unter den versteinerten Knochen befinden sich Schädelfragmente, die mit Sicherheit als Säugetierreste angesprochen werden können. Überbleibsel dieser Säuger, die etwa die Größe eines Hasen gehabt haben, sind sowohl in Südafrika wie in Europa aufgefunden worden. Die Tiere müssen also bereits eine weite Verbreitung gehabt haben. Man hat dies älteste, bis jetzt bekannte Säugetier Tritylodon longaevus benannt. Welche Rolle dieses Tier in der Phylogenie spielt, läßt sich nach den nur spärlichen Knochenresten vorläufig nicht feststellen.
Auch heute noch trägt die Erde Lebewesen von gewaltiger Größe: den Elefanten als größtes Tier des Festlandes und den Walfisch als größtes Wassertier. Im Diluvium, also in der Zeitepoche, die der Jetztzeit unmittelbar vorangeht, lebten noch Elefanten, die ihre heutigen Nachkommen ganz bedeutend an Größe übertrafen. Hierzu gehört das Mammut, der zottig behaarte Elefant der Eiszeit, der noch mit dem Menschen zusammen gelebt hat. Seine langen Stoßzähne waren nicht, wie man früher annahm, nach außen und oben gewunden, sondern, wie Pfizenmayer neuerdings nachgewiesen hat, nach innen und unten. Mit diesen nach unten gerichteten Stoßzähnen hat das Mammut den Schnee fortgeschaufelt bei der Suche nach Gräsern und Halmen auf der Erde, die seine Nahrung bildeten. Im Unterschied zu den heute lebenden Elefanten besaß das Mammut nur vier Zehen an den Füßen. Es bildet also eine besondere Art und kann nicht zu ihren Ahnen gehören.
Vom Mammut sind nicht allein wohlerhaltene Skelette, sondern sogar ganze Kadaver im Eise des nördlichen Sibiriens[S. 23] aufgefunden worden, deren Fleisch noch völlig frisch war. Die Tiere sind offenbar in der Eiszeit im Morast oder auf großen Schneefeldern versunken, dann eingefroren und im Eise bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben.
Das ausgewachsene Mammut übertraf die heute lebenden Elefanten ganz bedeutend an Körpergröße. Seine Länge betrug 3 m, die Höhe 2 m. Ganz unverhältnismäßig groß waren die Stoßzähne, die bei einer Länge von 4–5 m ein Gewicht von 250 Pfund hatten. Der Schädel eines in Sibirien aufgefundenen großen Mammuts wog mit den Stoßzähnen 200 kg.
Der deutschen Oldoway-Expedition gelang es noch kurz vor dem Weltkriege, Knochenreste ausgestorbener Altelefanten aus Deutsch-Ostafrika heimzubringen, die in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin gelangten. Ein gewaltiges Beckenstück, ein 1,47 m langer Oberschenkel, ein Fuß mit einer Höhe von ½ m und über 3 m lange Stoßzähne deuten darauf hin, daß diese Elefanten, die wohl als die Stammväter des heutigen afrikanischen Elefanten anzusehen sind, im Vergleich zu diesem wahre Riesen gewesen sein müssen.
Unter den heute lebenden Landtieren reicht in der Körpergröße kein einziges auch im entferntesten an die Riesen früherer Zeitepochen heran, und sogar der Elefant mit seinem gewaltigen, massigen Körper verschwindet gegen seine ausgestorbenen Vorfahren und die riesenhaften Saurier der Sekundärzeit. Dennoch birgt unsere Erde noch eine Tiergestalt, die den Kolossen vergangener Zeiten ebenbürtig zur Seite steht, ja diese vielleicht in der Körpergröße übertrifft. Es ist dies der Riesenwal, der größte unter den Walfischen, das größte aller heutigen Tiere, ja vielleicht überhaupt das größte Wesen, das die Natur seit Beginn der Erdgeschichte erschaffen hat. Mit einer Körperlänge von 30 m tritt er in die[S. 24] Reihe der gewaltigen Saurier der Sekundärzeit und übertrifft diese sogar noch, weil bei ihnen ein bedeutender Teil der Körperlänge auf den sehr langen Schwanz abgeht, was bei dem verhältnismäßig kurzschwänzigen Walfisch nicht der Fall ist. Das Gewicht des Riesenwals beträgt 2000–3000 Zentner, der Umfang des Leibes etwa 12 m. Ein so gewaltiges Tier, das unbeschränkten Raumes für seine Bewegung bedarf, ist eben nur in den Fluten des Weltmeeres denkbar. —
Wenn der Besucher eines Zoologischen Gartens vor dem Wasserbecken steht, das mit großen Alligatoren und Schildkröten besetzt ist, so begnügt er sich in der Regel damit, die trägen und nach seinen Begriffen häßlichen Geschöpfe eine Zeitlang lässig zu betrachten, um sich dann mit größerem Interesse den Wasserbehältern zuzuwenden, in denen zierliche, buntfarbige Tropenfische in bizarrer Gestalt sich hurtig tummeln. Er ahnt aber nicht, daß Krokodil und Schildkröte schon vor Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, als die Weltmeere und Erdteile noch ganz andere Gestalt hatten und Gräser, Schachtelhalme und Farnkräuter in baumhohem Wuchs das Land beschatteten. Mit Ehrfurcht soll man daher diese Geschöpfe, die zu den ältesten Bewohnern unserer Erde gehören und schon in der Sekundärzeit lebten, und gegen die die Tradition des Menschengeschlechts verblaßt, betrachten!
Der wichtigste paläontologische Fund stammt aus der Jurazeit, der Mittelperiode der Sekundärzeit. Im Jahre 1861 wurde auf der Langenaltheimer Haardt bei Solnhofen der versteinerte Abdruck eines Geschöpfes gefunden, das halb Vogel, halb Eidechse zu sein schien. Im Jahre 1877 folgte ein zweiter Fund, der ein besser erhaltenes Exemplar dieses interessanten Wesens zutage förderte. Nicht allein das Skelett ist fast völlig erhalten, sondern auch der[S. 25] Abdruck des Federkleides läßt sich gut erkennen. Dieser Urvogel, Archaeopteryx macrura benannt, vereinigt in nicht zu verkennender Weise Merkmale der Echsen und Vögel, und man kann ihn daher mit Recht als „Echsenvogel“ bezeichnen.
Echsenartig ist der lange, aus zahlreichen Wirbeln bestehende Schwanz. Die vorderen Gliedmaßen sind bereits zu Flugwerkzeugen nach Vogelart umgebildet, aber die Finger sind noch nicht wie bei den heutigen Vögeln verkümmert, sondern zum Teil frei und beweglich und mit langen, hervorstehenden Krallen ausgerüstet. Diese Krallen dienten als Kletterorgane, mit denen der Urvogel sich in Zweigen festhakte und kletternd fortbewegte. Die Hand ist also ein Mittelding zwischen der Eidechsenhand und Vogelhand. Echsenartig sind ferner die Rückenwirbel, welche jene eigenartige, doppelgehöhlte Sanduhrform zeigen, die für die Saurier der Sekundärzeit charakteristisch war, und die gewisse Amphibien und die Fische noch heute besitzen. Zum Unterschied von den jetzigen Vögeln besaß Archäopteryx außer den mit dem Brustbein verbundenen Rippen noch Bauchrippen, was ebenfalls an die Reptilien erinnert. Ober- und Unterkiefer sind bereits zu einem Vogelschnabel umgebildet, aber dieser Schnabel trägt wie das Maul des Krokodils oben und unten zwei Reihen Zähne. Kein heutiger Vogel besitzt Zähne, die mit Wurzeln in den Kiefern stecken. Die zahnartigen Ausschnitte am Schnabel der Entenvögel sind keine Zähne, sondern Fortsätze der Schnabelscheide, die als hornartiger Überzug die Schnabelhälften einhüllt.
Der Fuß der Archäopteryx war ein ausgesprochener Vogelfuß und besitzt bereits das typische Kennzeichen des Vogelfußes, den Lauf, jenen zwischen dem Unterschenkel und den Zehen eingeschalteten Knochen, der eine Verlängerung des Mittelfußes darstellt, und den der Laie häufig irrtümlich für den Unterschenkel hält,[S. 26] der bei vielen Vögeln im Gefieder verborgen und nur wenig sichtbar ist.
In höchster Vollendung zeigt sich die Vogelnatur der Archäopteryx im Federkleid, das das typische Wahrzeichen der Vögel ist und in keiner anderen Tierreihe wiederkehrt.
Der versteinerte Flügelabdruck läßt 17 Schwungfedern mit 6 oder 7 Handschwingen erkennen. Es handelt sich also um einen regelrechten Vogelflügel. Einige Lücken in der Reihe der Handschwingen legen die Vermutung nahe, daß der Urvogel bereits 10 solcher Federn getragen hat, wie es die Normalzahl der Handschwingen der heutigen Vögel ist.
Eigenartig ist die Befiederung des langen Schwanzes. Hier sitzen die Federn in zwei gegenüberstehenden Reihen an den Wirbeln. Jeder Wirbel trägt ein Federpaar. Der Schwanz hatte also das Aussehen eines Farnblattes.
Am Körper läßt die Versteinerung nur einige Federn am Halse erkennen. Man darf daher annehmen, daß Archäopteryx wie die heutigen Vögel am ganzen Leibe befiedert war.
Archäopteryx ist also ein Vogel mit teilweiser Eidechsengestalt, eine echte Übergangsform zwischen Vogel und Echse und somit das beste Beweisstück für die Richtigkeit der Entwicklungslehre. Die Abstammung der Vögel von Reptilien, die man auf Grund physiologischer Merkmale und aus der Embryologie der Vögel schon längst vermutet hatte, wird durch Archäopteryx bewiesen.
Es ist das Verdienst des genialen Ingenieurs Werner von Siemens, des um die Verwertung der Elektrizität so hochverdienten Mannes, daß die zweite wohlerhaltene Versteinerung von Archäopteryx nicht wie der erste Fund, den die britische Regierung kaufte, ins Ausland ging, sondern der deutschen Wissenschaft erhalten blieb. Werner von Siemens erwarb sofort den wertvollen[S. 27] Fund für die damals sehr ansehnliche Summe von 20000 Mark. Aus seiner Hand ging dann das bedeutungsvolle Fossil in den Besitz des Museums für Naturkunde in Berlin über, wo es das Glanzstück der paläontologischen Sammlung bildet. Werner von Siemens hat mit dieser hochherzigen Tat einen neuen Zweig in den Lorbeer gewunden, der seinen Namen ziert.
Archäopteryx war mit seinen Kletterflügeln noch kein so vollendeter Flieger wie die heutigen Vögel. Er war wohl nur imstande, im Flatterflug kleine Strecken zu durchmessen. Er lebte hauptsächlich im dichten Gebüsch, wo er sich flatternd und zugleich kletternd fortbewegte.
Auch unter den heutigen Vögeln gibt es noch Formen, die an Archäopteryx erinnern. Trägt doch das junge Schopfhuhn oder Hoatzin noch bewegliche und bekrallte Finger, mit denen es nach Archäopteryx-Art in Zweigen umherklettern kann. Mit dem Wachstum geht dann dies atavistische Merkmal verloren, das nach Häckels Biogenetischem Grundgesetz die Abstammung vom Archäopteryx oder von nahen Urformen bedeutet. Das alte Schopfhuhn hat normale Vogelflügel. —
Die Tertiärzeit ist die Bildnerin der heutigen Tierwelt. Unzählige Fische belebten die Gewässer; Frösche, Salamander und Kröten, von Gestalt und Aussehen ähnlich den heutigen, durchkrochen den Sumpf. Vögel mit vollendetem Flugvermögen, an Familien, Gattungen und Arten nicht minder zahlreich als heute, segelten im blauen Äther; Antilopen, Giraffen, Elefanten, Nashörner, Hirsche und Pferde durchzogen das Land, das ihnen überall geeignete Rastplätze und günstige Lebensbedingungen gab, denn der Mensch, der Störenfried der Natur, dessen Kultur der größte Feind der Tierwelt ist, fehlte noch in dieser Zeit.
[S. 28]
Affen schaukelten sich in den Bäumen, Fledermäuse gaukelten im Schatten der Nacht, Wale und Haie durchzogen den Ozean, Robben sonnten sich auf den Sandbänken des Meeres, und die Nagetiere trieben ihr Wesen wie heute.
Zahlreich vertreten waren die Raubtiere. Löwen, Bären, Wölfe, Tiger und Schakale durchstreiften blutdürstig das Land. Überall fanden sie bei dem großen Tierreichtum damaliger Zeit willkommene Beute, ohne jedoch durch ihren Eingriff Schaden zu stiften und den gewaltigen Tierbestand zu dezimieren. Im Gegenteil, ihr Auftreten war nur nützlich, denn es veranlaßte die Tiere zur Wachsamkeit, weckte ihre geistigen Fähigkeiten, schärfte ihre Sinne und verlieh ihnen so die wichtigste Lebensnotwendigkeit für den Sieg im Kampf ums Dasein und für die Erhaltung der Art.
Auch die Tertiärzeit hat ihre besonderen Tiere gehabt. In Ozeanien lebten gewaltige Beuteltiere von der Größe des Nashorns. Der aufgefundene Schädel eines solchen Beutelriesen mißt nicht weniger als 1 m.
Reich sind die Funde tertiärer Tiere in den Pampas Südamerikas. Hier hausten einst riesige Gürteltiere und ganz gewaltige Faultiere, die dem Elefanten an Größe gleichkamen.
Der ältesten Tertiärschicht Nordamerikas verdanken wir einen Fund, der ein helles Licht auf die Entwicklung der Huftiere wirft. Das Urhuftier (Phenacodus primaevus) hatte noch fünf Zehen, unter denen die dritte Zehe als längste hervortritt. Beim heutigen Pferd ist nur die dritte zum Huf gewordene Zehe erhalten geblieben, während die übrigen Zehen verkümmert sind. So darf man vielleicht Phenacodus mit seiner langen dritten Zehe als die Stammform des Pferdes ansehen, denn der Weg zur Rückbildung der Zehen mit Ausnahme der mittleren Zehe ist hier gewissermaßen[S. 29] schon angedeutet. Die zunehmende Verkümmerung der Zehen läßt sich an anderen Fossilien gut verfolgen. Beim Hyracotherium, einem anderen tertiären Huftier, ist die Zahl der Zehen an den Vorderfüßen bereits auf vier und an den Hinterfüßen sogar schon auf drei zurückgegangen. Die dritte Zehe des Vorderfußes überragt die andern ganz erheblich an Länge, und eine Randzehe trägt unverkennbare Anzeichen der Verkümmerung. Im mittleren Eozän ist dann diese Randzehe bis auf ein kleines Rudiment völlig verschwunden, so daß das Huftier dieser Zeitperiode, Mesohippus genannt, hinten und vorn nur drei Zehen besaß.
Während die Huftiere des unteren und mittleren Tertiär nur kleine Wesen waren, etwa von der mittleren Größe eines Hundes, tritt im Pliozän, am Ende der Tertiärzeit, bereits ein Huftier von der Größe des Esels auf, das Hipparion, das eine weite Verbreitung hatte, da zahlreiche Knochenreste in Amerika, Asien und Europa aufgefunden sind. Von den drei Zehen des Mesohippus kommt als Trittfläche nur noch die zum Huf gewordene Mittelzehe in Betracht, während die beiden anderen Zehen zu Afterklauen geworden sind und den Boden nicht mehr berühren. In der weiteren Entwicklung gingen auch die Afterklauen verloren, und hiermit trat das Pferd als Einhufer auf.
Im Gegensatz zu den früheren Ahnenstufen, die in Körperbau und Gebiß noch katzenähnlich waren, ist das Hipparion schon ein richtiges Pferd gewesen.
Nicht alle Tiere der Tertiärzeit haben sich bis heute erhalten oder weiter fortentwickelt. Viele Formen haben sich überlebt und keine Nachkommen hinterlassen. Hierzu gehören mit Ausnahme des Pferdes alle Unpaarhufer. Ein solches Tier war der elefantengroße Brontops, der im Körperbau dem Nashorn glich und zwei[S. 30] nebeneinanderstehende Hörner auf dem Kopfe trug. Die Füße besaßen vorn vier, hinten drei wohlentwickelte Zehen mit Hufbildung.
Die Hirsche im mittleren Tertiär unterschieden sich von den späteren Hirschen hauptsächlich durch eine reichere Verästelung des Geweihs, das mit seinen vielen Sprossen wie eine entblätterte Baumkrone aussah.
Ein riesengroßes, elefantenartiges Rüsseltier war das Dinotherium, dessen verhältnismäßig kurze, hauerartige Stoßzähne wie beim Walroß nach unten gerichtet waren.
Unter den tertiären Affen finden sich Knochen von Halbaffen oder Makis, von großen Pavianen und Gibbons. Auch der echte Schimpanse lebte damals schon, aber seine Reste sind wunderbarerweise nicht in seiner heutigen Heimat, in Afrika, sondern in Asien aufgefunden worden. Aus Frankreich sind tertiäre Menschenaffen bekannt, die teils dem Schimpansen, teils dem Gorilla nahestehen.
Das Vorkommen von Menschenaffen in Europa zur Tertiärzeit deutet schon darauf hin, daß damals andere klimatische Verhältnisse geherrscht haben müssen. Europa hatte zu jener Zeit ein warmes, tropenartiges Klima, und es lebte hier eine Tierwelt, die der heutigen Tropenfauna glich. Affen und Papageien schaukelten sich in Palmen, wo heute deutsche Eichen und Kiefern wachsen. Gazelle, Giraffe, Nashorn und Elefant zogen ihre Fährte im Lande des späteren Germanentums. Mit leuchtenden Farben geschmückte Vögel erstrahlten im Glanz der Tropensonne, die Europas Palmenwälder und Blütenpracht beschien.
Um die Wende dieser Zeitepoche brach eine gewaltige Katastrophe herein, die alles dies mit einem Schlage vernichtete. Es war die Eiszeit, die wie ein weißes Leichentuch die nördliche Hälfte der[S. 31] Erdkugel überzog, unter dem die Tropenpracht zerrann. Die Tiere, deren Lebensbedingungen an ein gleichmäßig warmes Klima gebunden waren, fluteten zurück vor dieser Vereisung, um in den Äquatorialländern, die sich ihr warmes Klima bewahrten, Zuflucht zu suchen, viele gingen zugrunde, andere, deren Körperbeschaffenheit der Kälte zu trotzen vermochte, harrten aus und paßten sich den neuen Verhältnissen an. Als Nachfolger der tropischen Elefanten trat in Europa das Mammut auf, das mit seinem zottig behaarten Leib eine typische Schöpfung der Eiszeit ist. Ein anderes diluviales Wesen der Eiszeit war der Riesenhirsch, in seinem Aussehen unserem Rothirsch ähnlich, aber mit einem gewaltigen Schaufelgeweih auf dem Kopf, das eine Spannweite von 3,5 m erreichte. Es ist nicht unmöglich, daß der Riesenhirsch noch bis in die historische Zeit hinein gelebt hat. Vielleicht darf der „grimme Schelch“, den Siegfried in der Sage des Nibelungenliedes erschlug, als Riesenhirsch gedeutet werden. Dies ist jedoch nur eine kühne Phantasie, denn eine Urkunde aus alter Zeit über diesen mächtigen Geweihträger ist nicht vorhanden. In keinem Bilde wird er uns gezeigt, nirgends wird er beschrieben. In keiner Reliquienkammer befindet sich ein solches Geweih. Die Annahme, daß unter dem Schelch des Nibelungenliedes der Riesenhirsch zu verstehen ist, liegt nahe, weil mit dem Schelch ein anderes Tier gemeint sein muß als der Elch, der besonders genannt wird.
Andere diluviale Tiere waren Wisent, Bison und Auerochse, von denen nur die beiden ersteren erhalten geblieben sind.
Die Eiszeit brachte auch den Moschusochsen aus Nordamerika zu uns herüber, der dann später wieder aus Europa verschwand und nur in Grönland sich noch erhalten hat.
Das langhaarige Fell gibt dem Moschusochsen einen vortrefflichen Schutz gegen die Kälte. Der Moschusochse erinnert in seiner[S. 32] massigen, plumpen Figur zwar an einen Ochsen, hat aber sonst, besonders in der Kopfbildung, eine große Ähnlichkeit mit dem Schaf. Der sehr kurze, nur wenige Zentimeter lange Schwanz ist in dem dichten, langhaarigen Pelz verborgen.
Die Eiszeit vermochte auch die Raubtiere nicht völlig zu verdrängen. Höhlenbär, Höhlenlöwe und Höhlenhyäne trieben ihr Unwesen. Unter ihnen war der Höhlenbär am häufigsten vertreten, wie die überaus zahlreichen Knochenreste, die man in unterirdischen Höhlen des Diluvium aufgefunden hat, beweisen. Auch Tiger, Panther und Vielfraß lebten noch im Diluvium in unseren Breiten. „Aber zwischen diese reiche Musterkarte wilder Bestien“, sagt Bölsche, „schiebt sich ein mildes Bild: auch aus ihrer Reihe sonderte sich der Mensch damals einen unschätzbaren Freund, den Hund. Seine ersten Reste erscheinen in den uralten Menschensiedlungen der Schweizer Seen, den sogenannten Pfahlbauten und in gewissen Abfallhaufen, die sich ebenfalls als Spuren des vorgeschichtlichen Menschen in Dänemark noch erhalten haben. Aus der Art, wie in diesen Müllgruben aus urgrauer Zeit die weggeworfenen Tierknochen der Mahlzeiten charakteristisch benagt und dezimiert sind, hat man wohl mit Recht geschlossen, daß der Hund hier bereits ein ständiger Gesellschafter des Menschen war.“ Über die Abstammung des Haushundes ist man auch heute noch nicht im klaren. Wahrscheinlich ist er aus verschiedenen Wildhundformen hervorgegangen, wofür in erster Linie Wolf und Schakal in Betracht kommen, während der Fuchs und seine Verwandten wohl auszuscheiden sind. Die ersten Haushundreste, die aus der Steinzeit bekannt sind, zeigen einen spitzartigen Typus. Dieser „Torfspitz“ scheint ebenso wie die altägyptischen Hunde vom Schakal abzustammen. Die zahlreichen Hunderassen, die sich im Laufe der Jahrtausende herausgebildet haben, sind zum Teil anscheinend[S. 33] verschiedenen Ursprungs, zum Teil durch Vermischung der Rassen entstanden. —

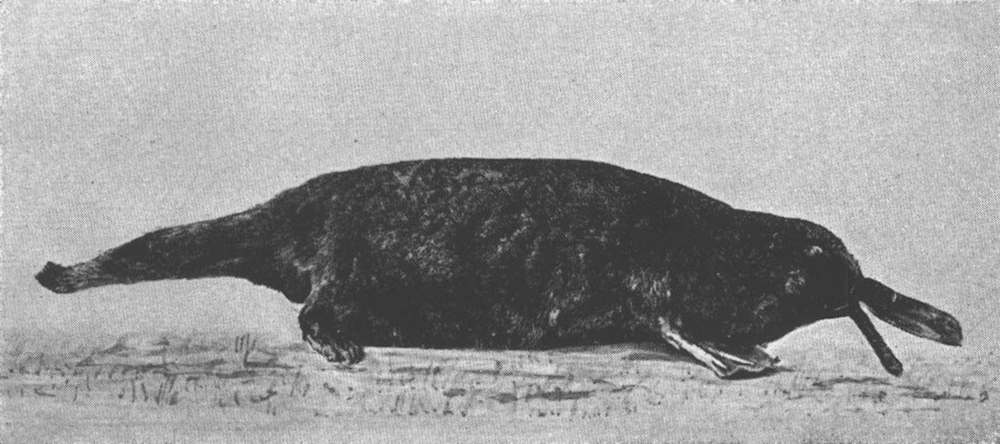

Unter den Vögeln der Eiszeit ist an erster Stelle der Riesenalk zu nennen, ein etwa metergroßer Tauchvogel mit verkümmerten, zum Fliegen unfähigen Flügeln. Er hat sich bis in die Neuzeit hinübergerettet, und erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind die letzten Reste dieses interessanten Naturdenkmals durch den Menschen ausgerottet worden. Ausgestopfte Exemplare und Eier des Riesenalks stehen noch in den Museen als Zeugen verklungener Zeiten.
Eine andere erst in historischer Zeit ausgestorbene, uralte Vogelart ist die Dronte, eine flugunfähige Taube der Insel Mauritius. Dieser gänsegroße, eigentümliche Vogel hatte einen dicken, plumpen Körper nach Art des gemästeten Federviehs heutiger Zeit, sehr kurze, stummelartige Flügel und einen aus gekräuselten Federn bestehenden, hochgerichteten Schwanz. Das Gefieder war hellgrau, Schwanz- und Flügelfedern gelb, der Schnabel gelb mit roter Spitze. Leider ist dieser am Ende des 17. Jahrhunderts ausgerottete Vogel der Nachwelt nicht erhalten geblieben, denn das letzte ausgestopfte Stück vernichtete der Unverstand des Konservators des Museums in Oxford im Jahre 1755, weil der Balg von Motten angefressen war. Sic transit gloria mundi!
Die Eiszeit hat uns hinübergeführt zu dem jüngsten Abschnitt der Erdgeschichte, zur Quartärzeit, die ihre besondere Bedeutung dadurch erhält, daß jetzt auch der Mensch in die Reihe der Lebewesen tritt. Die Spuren des Menschen lassen sich mit Sicherheit nur bis in das Diluvium verfolgen. Der Streit über den tertiären Menschen ist noch keineswegs geschlichtet. Noch immer fehlen sichere Anhaltspunkte für das Vorhandensein des Menschen in der Tertiärzeit.
[S. 34]
Während zahlreiche, versteinerte Knochenreste uns über die Entwicklung vieler Tiere Aufschluß geben, fehlen solche Wahrzeichen früherer Ahnenstufen beim Menschen. „Wahrlich, wenn ein verbriefter Stammbaum“, sagte Branco in seinem Vortrag über den fossilen Menschen auf dem V. Internationalen Zoologen-Kongreß 1901 zu Berlin, „eine lange Ahnenreihe, wie viele meinen, die Berechtigung gewährte, auf andere herabzublicken, die solchen Stammbaum nicht besitzen — die Schweine und Rhinozeronten, das Rindvieh und manch andere Wiederkäuer, Kamele, Pferde, Elefanten, die könnten voll Stolz und voll Hochmut auf den Menschen niederblicken, der als ahnenloser Parvenü plötzlich in ihrer Mitte dasteht.“ —
Der Neandertalmensch kann nach heutiger Anschauung der Anthropologen nicht als Vorläufer der heutigen Menschen betrachtet werden. Zwar zeigt der lange Schädel mit seinen vorspringenden Augenbrauenbögen und der nach rückwärts fliehenden Stirn eine größere Ähnlichkeit mit dem Schädel der Menschenaffen, als es bei den heutigen Menschenschädeln, den Kurzköpfen, der Fall ist, aber er kann trotzdem nicht als frühere Ahnenstufe gelten, da er nicht ausschließlich diluvialer Herkunft ist, sondern gleiche Schädel zusammen mit normalen Kurzschädeln auch im Alluvium gefunden sind. Die Neandertalmenschen haben also mit den Kurzschädeln zusammengelebt. Es handelt sich daher nicht um eine Vorstufe in der Ahnenreihe des Menschen, sondern nur um eine Rasse. Man darf wohl annehmen, daß die Flachköpfe geistig weniger begabt waren als die Rundköpfe mit ihrem größeren Hirnraum und daher im Kampf ums Dasein unterlegen sind.
In großer Zahl sind Flachkopfschädel, die völlig den Typ des Neandertalmenschen tragen, in Krapina in Kroatien ausgegraben worden. Sie stammen alle aus dem Alluvium, aus der jüngsten[S. 35] Zeit der Erdgeschichte. Hier scheint sich also die Flachkopfrasse neben der kurzköpfigen Form am längsten erhalten zu haben.
Nicht viel besser als mit dem Neandertalmenschen steht es mit dem berühmten, heiß umstrittenen Pithecanthropus, jenem Schädelfragment, das der Holländer Dubois 1891 auf Java fand, und das das größte Aufsehen erregte. Das sehnsüchtig gesuchte Mittelding zwischen Mensch und Affe sollte endlich entdeckt sein! Pithecanthropus ist wie der Neandertalschädel ein Flachkopf, aber die Affenmerkmale sind noch ausgeprägter. Er ist flacher, und die Augenbrauenbögen treten noch stärker hervor. Die Höhe des Schädeldachs über der Längsachse beträgt 61 mm gegen 85 mm beim Neandertalschädel und 100–110 mm beim heutigen Menschen. Die Höhe des Schimpansenschädels beträgt 45 bis 50 mm. Pithecanthropus steht also in dieser Beziehung in der Mitte zwischen dem modernen Menschen und den Menschenaffen. Die Gelehrten stritten sich, ob man es mit einem Menschenaffen, einem Menschen oder gar mit einem Übergang zwischen beiden zu tun habe, und noch heute ist dieser Streit nicht endgültig ausgefochten, und er wird kaum jemals ausgetragen werden können, wenn nicht weitere Funde folgen, denn das Schädelfragment genügt nicht, um ein endgültiges Urteil zu fällen.
Außer dem Schädelbruchstück wurde in 15 m Entfernung noch ein Oberschenkelknochen zutage gefördert, der jedoch so menschenähnlich ist, daß er zu dem affenartigen Schädel wenig paßt, sondern vielleicht von einem richtigen Menschen stammt. Beide Knochenreste lassen sich daher kaum miteinander in Beziehung bringen, denn sie scheinen nicht demselben Wesen anzugehören, sondern zwei ganz verschiedenen Geschöpfen. Infolgedessen hat auch der Entdecker dieses rätselhaften Fundes Dubois in seiner neuesten Abhandlung über Pithecanthropus in den Veröffentlichungen[S. 36] der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, den Schenkelknochen bei seinen Ausführungen ganz ausgeschaltet. Dubois sucht in dieser Schrift nachzuweisen, daß Pithecanthropus bereits ein Mensch gewesen sei, jedoch mit sehr flacher Schädelbildung. Hiermit würde Pithecanthropus seine ihm von vielen Seiten bisher zuerkannte Bedeutung als Übergangsform zwischen Mensch und Affe verlieren. Das letzte Wort über diesen interessanten Fund ist jedoch auch hiermit noch nicht gesprochen. —
In jüngster Zeit wurden in Südafrika zwei neue Funde gemacht, die für die Frage nach der Stammesgeschichte der Menschheit von größtem Interesse sind.
Im Jahre 1921 wurde in Broken Hill in Nord-Rhodesia ein Menschenschädel ausgegraben, der durch stark hervortretende Augenbrauenbögen, flache Stirn und weit vorgeschobene Kiefer noch affenähnlicher erscheint als der Neandertalmensch, und nach dem Urteil des französischen Anthropologen Marcellin Boule sogar eine gewisse Übereinstimmung mit dem Gorillaschädel zeigt. Hiernach scheint also der Rhodesiaschädel eine ältere Stufe in der Entwicklung der Menschheit darzustellen als der Neandertaler. Im Widerspruch zu dieser Erscheinung steht jedoch ein anderes sehr merkwürdiges Merkmal. Während am Neandertalschädel das Hinterhauptloch, durch das das Rückenmark in den Schädel tritt, so liegt, daß der Kopf nicht aufrecht, sondern etwas nach vorn geneigt getragen wurde, weist die Stellung des Hinterhauptlochs am Rhodesiaschädel bereits auf eine völlig aufrechte Kopfhaltung hin, wie sie der rezente Mensch hat. Im Gegensatz zu dem stark ausgeprägten Affentyp spricht dies Merkmal für eine höhere Entwicklungsstufe als der Neandertalmensch.
Die jüngste Untersuchung des interessanten Fundes durch den deutschen Anatom Maurer ergab nun eine überraschende Aufklärung[S. 37] über sein Alter. Maurer erkannte nämlich eine Verletzung, die durch den Schuß eines modernen Geschosses hervorgerufen zu sein scheint. Es läßt sich deutlich ein Ein- und ein Ausschuß im Schädel feststellen. Trifft dies Merkmal zu, das von englischen Gelehrten wunderbarerweise bisher nicht beachtet worden ist, dann kann es sich nicht um einen Fund aus prähistorischer Zeit handeln, sondern der Mensch, der den Schädel getragen hat, muß in unserer Zeit gelebt haben. Nicht mit Unrecht hat man daher darauf hingewiesen, daß vielleicht in einer unbekannten Gegend im Innersten Afrikas noch heute Menschen leben, die der Neandertalrasse nahestehen. Eine solche Vermutung ist durchaus nicht unglaubwürdig, wenn man bedenkt, daß erst vor einem Vierteljahrhundert ein neues Säugetier, das Okapi, dessen Vorfahren bereits aus dem Miozän Europas bekannt waren, entdeckt wurde. Das Okapi ist ein etwa 1,5 m hoher, den Giraffen nahverwandter Paarhufer. Ebenso wie die Giraffe trägt das Okapi zwei Hornzapfen auf der Stirn. Von dem rotbraun gefärbten Fell des Körpers heben sich die zebraartig schwarz und weiß gestreiften Läufe und Hinterschenkel eigenartig ab. Das Okapi wurde 1901 im Kongostaate entdeckt.
Dem Rhodesiaschädel folgte im Jahre 1924 ein zweiter, vielleicht noch bedeutungsvollerer Fund. Im Dezember des genannten Jahres wurde in Taungs in Betschuanaland in Südafrika ein Menschenaffenschädel ausgegraben, der mit ziemlicher Gewißheit als tertiär angesprochen werden kann. Es ist der Schädel eines dem Schimpansen nahestehenden großen Affen, dessen Lebensalter nach dem Gebiß auf 3–4 Jahre einzuschätzen ist. Es handelt sich also um den Schädel eines noch im Kindesalter stehenden Menschenaffen. Für die Jugend des Schädels spricht auch sein sehr menschenähnlicher Bau, denn bei allen Affen ist in der Kindheit der Gesichtsteil viel menschenähnlicher als im Alter, wo[S. 38] das Tierische mehr zum Ausdruck kommt. Der Kopf des jungen Affen mit der gewölbten Stirn ist runder und besser proportioniert. Die Augenbrauenbögen treten noch nicht wulstartig hervor, und die Prognathie der Kiefer, die gerade den tierischen Ausdruck erhöht, ist noch weniger ausgeprägt. Erst mit dem zunehmenden Alter schieben sich die Kiefer vor, erscheinen die Wülste über den Augen und flacht sich die Stirn ab, wodurch sich der menschenähnliche Ausdruck des Gesichts mehr verliert und das Tierische stärker betont wird. Der sehr menschenähnliche Typ des Taungsaffen, den der britische Anatom Raymond Dart in Johannesburg „Australopithecus africanus“ benannt hat, darf also nicht stammesgeschichtlich bewertet werden. Es ist nur eine natürliche Folgeerscheinung des sehr jugendlichen Alters des Affen, aber nicht ein Hinweis auf eine höhere Entwicklungsstufe in der Richtung zum Menschen.
Australopithecus zeigt aber ein anderes, sehr auffälliges Merkmal, das ihn zweifellos über die heutigen Menschenaffen erhebt und ihn dem Menschen näherstellt. Der Gehirnraum des Schädels ist nämlich auffallend groß und entspricht etwa dem Hirnraum eines erwachsenen Gorillas. Dart hat nun für den erwachsenen Australopithecus eine Schädelkapazität von 650–700 ccm berechnet. Australopithecus hat also ein größeres und besser entwickeltes Gehirn besessen als die heutigen Menschenaffen, deren Schädelkapazität im Höchstmaß 500 ccm beträgt.
Für den wahrscheinlich diluvialen Pithecanthropus wird eine Schädelkapazität von ca. 900 ccm angegeben. Australopithecus reiht sich also in bezug auf die Hirngröße zwischen Pithecanthropus und die rezenten Menschenaffen ein.
Wie wir sahen, ist Pithecanthropus, bevor keine weiteren, besser erhaltenen Schädel aufgefunden werden, für die Stammesgeschichte des Menschen kaum zu verwerten, da noch nicht einmal[S. 39] aufgeklärt ist, ob es sich um einen Affen oder einen Menschen handelt. Dagegen ist Australopithecus zweifellos ein Affe gewesen, und zwar ein Menschenaffe, mit auffallend hoch entwickeltem Gehirn. Ebenso wie einst Pithecanthropus als Bindeglied zwischen Mensch und Affe betrachtet wurde, trägt auch Dart kein Bedenken, seinen Australopithecus als Übergangsform zwischen Mensch und Tier anzusehen, ob mit Recht oder Unrecht, das wird erst die weitere Forschung zeigen.
Spärlich sind bis heute die Funde, die für die Stammesgeschichte der Menschheit Bedeutung haben. Aber die spärlichen Funde haben doch einen großen, nicht zu unterschätzenden Wert. Sie zeigen uns, daß der Mensch nicht immer so beschaffen war, wie er heute ist, sondern daß auch er sowohl körperlich wie geistig manche Umwandlung erfahren hat. Der Neandertalmensch mit seinem flacheren, mehr tierischen Schädel stand zweifellos auf einer geringeren Stufe der Intelligenz als der heutige Mensch. Dasselbe gilt wohl in noch höherem Maße vom Rhodesiamenschen, von dem vielleicht letzte Überreste noch heute ihr Dasein fristen in unbekannter Gegend Afrikas. In Gegensatz zu diesen primitiven Urmenschen tritt der Überschimpanse Australopithecus mit seinem für einen Affen auffallend hoch entwickelten Gehirn. Die Kreise berühren sich. Hier der Mensch auf niedriger Entwicklungsstufe, dort der Affe in hoher geistiger Vollkommenheit! Überall leuchtet das eine Wort „Entwicklung“ hervor!
Welche Überraschungen haben uns die paläontologischen Funde bereits gebracht, und wieviel Neues dürfen wir bei der rastlosen Forschung der Wissenschaft noch erhoffen. Jeder Tag kann einen neuen Fund bringen, der unerwartetes Licht in den Schatten der Stammesgeschichte der Menschheit wirft, die zweifellos die interessanteste Frage der Wissenschaft bildet.
[S. 40]
Geburt, Aufstieg, Niedergang, Tod. Dies sind die Gesetze, die des Lebens Kreislauf mit eiserner Strenge umschließen, und doch gibt es Lebewesen, die das Angesicht des Todes nicht zu schauen brauchen, denen die Natur ein ewiges Dasein geschenkt hat. Es sind jene kleinsten Organismen, die wir als Infusorien im Wassertropfen unter dem Mikroskop bewundern.
Die Infusorien gehören zu den einzelligen Tieren, Protozoen, die im Wasser, auf dem Lande oder parasitär im Körper anderer Tiere wohnen. Der Körper aller Lebewesen ist aus unzähligen kleinsten Bausteinen, Zellen genannt, zusammengesetzt, die die Grundform, den Urstoff alles Lebens bilden. Jede Zelle besteht aus einer flüssigen Masse, dem Protoplasma mit einem inneren Kern. Solche Zelle, als Einzelwesen gedacht, ist das Urtier oder der Einzeller.
Die einfachste Art der Fortpflanzung geht durch eine Teilung des Urtiers in zwei neue Lebewesen vor sich. Der Körper spaltet sich entweder in der Länge oder in seiner Breite in zwei gleiche Teile, die jeder ein neues Tier darstellen. Das Muttertier stirbt nicht, sondern lebt in veränderter Form weiter.
Häufig erfolgt anstatt der Zweiteilung auch eine Vielteilung. Der Zellkörper löst sich in zahlreiche Sporen oder Gameten auf, welche sich paarweise verschmelzen und zu einem neuen Einzeller werden. Die einzelnen Gameten sind entweder gleichwertig oder[S. 41] aber verschieden in der Größe. Im letzteren Falle vereinigt sich stets eine größere Gamete mit einer kleineren, so daß man die beiden Gametenformen mit der Ei- und Samenzelle höherer Tiere vergleichen kann und ihre Verschmelzung, wissenschaftlich „Kopulation“ genannt, als der Beginn einer geschlechtlichen Fortpflanzung angesehen werden darf.
Bei einigen Infusorien kommt neben der Teilung und der Kopulation sogar eine regelrechte Paarung zweier Elterntiere vor. Zwei Infusorien schwimmen umeinander herum, suchen sich zu berühren, bis eine vorübergehende Vereinigung erfolgt, bei der die Kerne ihres Innenkörpers sich teilen und Kernstücke gegenseitig ausgetauscht werden, die dann wieder in jedem Tier zu einem einheitlichen Kern verschmelzen. Auf diese Weise wird der Zelle neue Kernsubstanz zugeführt, wodurch die Lebensenergie erhöht wird. Diese Paarung, die man „Konjugation“ nennt, scheint für viele Einzeller eine Lebensnotwendigkeit zu sein. Versuche ergaben, daß eine dauernde Fortpflanzung durch Teilung ohne zeitweise Konjugation zur Entartung führt. Die neuen Generationen werden immer kleiner, verlieren die Beweglichkeit und damit auch die Fähigkeit, sich zu ernähren, und gehen schließlich zugrunde. Die fehlende Konjugation wirkt also ähnlich wie eine übertriebene Inzucht bei höheren Tieren.
Wieder andere Urtiere pflanzen sich durch Knospung fort, indem sich vom Muttertier kleine Einzelzellen abschnüren.
Die Zählebigkeit der Urtiere ist außerordentlich groß. Die Infusorien umgeben sich, wenn das Wasser austrocknet, mit einer Hülle (Zyste) und trotzen in diesem Zustande allen Witterungseinflüssen. Sie irren im Staube vom Winde getragen umher, bis sie schließlich wieder ins Wasser gelangen, um zu neuem Leben zu erwachen. Hierauf beruht die Erscheinung, daß reines, destilliertes[S. 42] Wasser, wenn es unbedeckt hingestellt wird, in kurzer Zeit mit Infusorien erfüllt ist. Eine Urzeugung, wie man früher glaubte, findet im Wasser nicht statt, sondern die kleinen Lebewesen gelangen durch die Luft im enzystierten Zustande hinein.
Die Gestalt der Urtiere ist sehr verschieden, sackförmig, becherförmig, rund oder länglich, und wechselt bei der flüssigen Körpermasse außerordentlich leicht. Ferner finden sich formunbeständige Fäden und Anhängsel am Körper, die der Fortbewegung und der Nahrungsaufnahme dienen. Andere haben zahllose kleine Wimpern, mit denen sie im Wasser rudern. Alle diese Anhängsel, die keine eigentlichen Organe sind, sondern Ausstülpungen des Protoplasmas, nennt man „Organellen“. Sogar Sinnesorganellen treten in Form feiner Borsten auf, die ein Tastvermögen ermöglichen. Bei den Strahlentierchen (Radiolaria) finden wir bereits die ersten Anfänge einer Skelettbildung in Form von kleinen, feinen Stäbchen aus Kiesel, Kieselsäure oder Quarz, also aus mineralischer Substanz. Sie liegen entweder lose in dem Protoplasmakörper eingebettet oder bilden ein Gitterwerk von allen möglichen zierlichen und absonderlichen Gestalten, wie Blüten, Reusen, Flaschen, Körbchen, Schalen, Spangen, Kreuze oder mehrarmige Leuchter. Schier unerschöpflich ist die Fülle der eigenartigen Formen, die bisweilen von bezaubernder Schönheit sind, so daß die Begeisterung, mit der ein Haeckel von diesen „Kunstformen der Natur“ spricht, vollauf zu verstehen ist.
Die Urtiere zeigen Reaktionen auf gewisse Reize. Sie schwimmen dem Lichtschein nach, verändern ihre Gestalt bei starker, plötzlicher Belichtung oder bei Erschütterung und werden durch chemische Einflüsse angezogen oder abgestoßen. Man hat geglaubt, hieraus auf ein Seelenleben der Urtiere schließen zu dürfen. Andere Forscher widerlegen nicht mit Unrecht diese Annahme mit dem Hinweise,[S. 43] daß z. B. ein Quecksilbertropfen durch chemische Einwirkung zu einer höchst auffallenden Beweglichkeit und Veränderung seiner Gestalt veranlaßt werden kann. Sie sehen daher in den Bewegungen der Urtiere weiter nichts als mechanische, unbewußte Reaktionen auf äußere Reize, die mit bewußter Empfindung und Seelenleben nichts zu tun haben, ebensowenig wie wir auch bei der Pflanze von einem wirklichen Seelenleben sprechen können.
Welche von beiden Anschauungen die richtige ist, läßt sich freilich schwer entscheiden, doch kann man immerhin vermuten, daß das Urtier mit seinem einzelligen Körper, der die elementarste Stufe des Lebens darstellt, wohl kaum ein seelisches Empfinden besitzt, das ein zielbewußtes Handeln zur Folge hat.
Alle vielzelligen Lebewesen, die Tiere sowohl wie der Mensch, beginnen ihr Dasein als Einzeller. Die Eizelle des weiblichen und die Samenzelle des männlichen Geschlechts sind solche Einzeller.
Der Anfang der Keimesgeschichte führt also stets auf das einzellige Urwesen zurück. Der Aufbau des aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstehenden Körpers läßt sich ebenfalls mit der Entwicklungsgeschichte der Urtiere vergleichen, denn der Prozeß ist ein gleicher. Das Urtier pflanzt sich fort durch Teilung in mehrere Einzelwesen. Ebenso spaltet sich auch die befruchtete Eizelle in verschiedene Produkte, aus denen sich im Laufe der weiteren Entwicklung die Teile des Körpers und seiner Organe bilden. Während bei dem Urtier aus der Teilung selbständige Einzelwesen hervorgehen, die ein individuelles Leben führen, bleiben bei der Teilung der Eizelle die Abschnitte im Zusammenhang, um in engster Gemeinschaft einen Einheitsstaat zu gründen, der in seiner Zusammengehörigkeit einen einheitlichen Körper darstellt. Die einzelnen Zellen des ersten Teilungs- oder Furchungsprozesses[S. 44] hat der um den Ausbau der Entwicklungslehre so verdiente Forscher Ernst Haeckel „Blastula“ genannt. Mit der Blastulabildung beginnt die Embryonalentwicklung aller höheren Lebewesen. Ernst Haeckel sieht in diesen Vorgängen der Ontogenie der Vielzeller einen Beweis für ihre Abstammung von einzelligen Urtieren und begründete hierauf sein „Biogenetisches Grundgesetz“, das besagt, daß die Ontogenie (Keimesgeschichte) eine Wiederholung der Phylogenie (Stammesgeschichte) ist.
Die Richtigkeit dieser vielfach befehdeten Lehre tritt in der weiteren Keimesentwicklung deutlich zutage. Auf das Stadium der Blastula folgt die „Gastrulation“. Gastrulation heißt „Magenbildung“, abgeleitet von dem griechischen Wort „gaster“ Magen. Die Larvenform der Blastula bildet im weiteren Zellenaufbau eine äußere und eine innere Schicht. Aus ersterer, dem Ektoderm, geht in der weiteren Entwicklung die Haut und das Nervensystem hervor. Letztere, das Entoderm, ist die erste Anlage für die Ernährungswerkzeuge. Der Embryo ist jetzt sozusagen ein Magentier, das nur aus einem hohlen Magen und einer äußeren Wand besteht, und gleicht hierin den Schwämmen, die sich den Urtieren unmittelbar anreihen, und zwar der einfachsten Form, den Kalkschwämmen. Der Kalkschwamm ist ein unten festgewachsener Becher, der an seinem oberen Ende eine Öffnung hat. Der ganze Innenraum wird von der Magenhöhle gebildet. Die äußere Hülle ist mit unzähligen feinen Poren durchsetzt. Durch dieses Netz dringt fortwährend ein Wasserstrom in das Innere des Körpers, der aus der oberen Öffnung, Osculum genannt, wieder abfließt. Mit dem Wasser gelangen kleinste Teile pflanzlichen und tierischen Ursprungs in die Magenhöhlung und werden so weit als möglich von den Körperzellen aufgesogen und verwertet. Der Rest wird mit dem Wasser wieder nach außen befördert. So ein Kalkschwamm[S. 45] ist also weiter nichts als ein einzelner, lebender Magen, und ebenso sieht auch der auf der Gastrulationsstufe stehende Embryo des vielzelligen Wesens aus. Also auch hier wieder eine Wiederholung einer niederen Stufe im Tierreich, die nach dem biogenetischen Grundgesetz als Ahnenstufe anzusehen ist.
Auch in der späteren Entwicklung behält das Gesetz seine Gültigkeit. Es bilden sich bei allen Embryonen an den Halsseiten vorübergehend Kiemenbögen, und die äußeren Gliedmaßen erscheinen zuerst als flossenartige Plättchen, beides ein Hinweis auf eine ehemalige Fischnatur vor Millionen von Jahren. Der Vogelembryo trägt anfangs einen wohlentwickelten Schwanz, der dann durch Verwachsung der Knochen wieder zurückgebildet wird. Die Abstammung der Vögel vom langschwänzigen Reptil tritt hier deutlich hervor. Auch der Embryo des Menschen trägt vorübergehend einen Schwanzansatz und einen Haarpelz, was nach Haeckel auf seine tierische Abstammung und seine Verwandtschaft mit dem Affen hindeutet. —
Bei den Schwämmen kommt neben einer Fortpflanzung durch Knospung bereits eine geschlechtliche Fortpflanzung durch Eier und Samen vor. Wie bei den Blüten der Pflanzen sind häufig männliche und weibliche Keimzellen in demselben Organismus vereint, bei anderen Schwämmen sind die Geschlechter individuell getrennt. Die Eier entwickeln sich im Muttertier zu Larven, die nach ihrer Geburt mit Hilfe besonderer Bewegungsorgane, der Geißeln, im Wasser umherschwimmen, um sich bald festzusetzen und zum fertigen Schwamm auszubilden.
Die Schwämme besitzen ein Skelett, das bei den Kalkschwämmen aus Kieselsäure besteht und bei den schon früher erwähnten Glasschwämmen aus einem wunderbaren, formenreichen Kieselnetzwerk, das feinen Glasfäden gleicht.
[S. 46]
Unser allbekannter Badeschwamm, der in keinem Toilettenzimmer fehlt, ist das Hornskelett der „Hornschwämme“, das nicht wie beiden Kieselschwämmen aus Mineralsubstanz, sondern aus Sponginfasern aufgebaut ist. Im lebenden Zustande ist ein Schwamm ein gelblicher, brauner oder schwarzer fleischiger Klumpen. Zum Gebrauch wird von dem Hornskelett das weiche Körpergewebe durch Pressen entfernt. Der Wert eines Schwammes hängt von der Art der Skelettbildung ab. Je feinmaschiger es gebaut ist, je fester und zugleich elastischer die Fasern sind, um so größer ist die Saugfähigkeit und die Haltbarkeit, und um so höher der Wert.
Ebenso wie die Schwämme stehen auch die Hohltiere, zu denen die Quallen, Blumentiere und Polypen gehören, noch auf dem Standpunkt der Gasträa. Sie sind Magentiere, die aus einem magenartigen Hohlraum mit einer Öffnung und einer Außenwand bestehen. Ihre Fortpflanzung geht teils wie bei den Urtieren durch Knospung oder Teilung vor sich, teils geschlechtlich durch Bildung von Ei- und Samenzelle. Neben einer Trennung der Geschlechter kommt auch Zwitterbildung vor. Im ersteren Falle erfolgt die Befruchtung durch Übertragung des Samens durch das Wasser.
Die Hohltiere sind zum Teil mit langen Nesselorganen ausgerüstet. Viele sind von bezaubernder Gestalt und herrlicher Farbenpracht. Die zarten Quallen und die vielfarbigen Seerosen müssen immer wieder von neuem unsere Bewunderung erregen.
Zwischen den festsitzenden Polypen und den frei schwimmenden Quallen oder Medusen besteht ein eigenartiger Zusammenhang, der zur Fortpflanzung in innigster Beziehung steht. Beides sind dieselben Tiere, nur in veränderter Form. Die Quallen entstehen aus Polypen. Durch Einschnürung wird der Körper des Polypen in mehrere scheibenförmige Abschnitte zerlegt, die sich allmählich[S. 47] loslösen und dann als Quallen frei umherschwimmen. Die Medusen sind bei diesen Polypenquallen die eigentlichen Geschlechtstiere, welche Eier ablegen, aus denen Larven hervorgehen, die sich festsetzen, um zum Polyp auszuwachsen. Quallen und Polypen stellen also zwei verschiedene Generationen dar. Der Polyp, der sich durch Knospung fortpflanzt, ist die ungeschlechtliche Generation, die Qualle die geschlechtliche. Dieser Generationswechsel findet aber nicht immer statt. Es gibt auch Quallen, die nicht aus Polypen entstehen, sondern sich unmittelbar aus Eiern fortpflanzen, ebenso bilden nicht alle Polypen Medusen. Auch kann die Qualle am Polyp haftenbleiben und hier Eier ausscheiden, aus denen sich neue Polypen entwickeln. Die Art und Weise der Fortpflanzung ist außerordentlich mannigfaltig. Bei vielen Medusen kennt man noch nicht die zugehörige Polypenform, und ebenso ist auch die Quallenform vieler Polypen noch unbekannt.
Die Stachelhäuter oder Strahlentiere (Echinodermata) sind radiare Tiere, d. h. ihr Körper läßt sich durch eine Anzahl strahlenförmiger Schnitte in gleiche Teile zerlegen. Dem Bau des Körpers liegt in der Regel die Fünfzahl zugrunde. Um einen zentralen Hauptteil gruppieren sich fünf gleiche Körperteile, die bei den Seesternen die Figur eines Sternes bilden, bei den Seelilien wie die Blütenblätter einer Blume aus einem Stiel hervorsprießen. Bei den Sterntieren ist die geschlechtliche Fortpflanzung die Regel. Sie legen Eier, aus denen Larven schlüpfen, die eine vielseitige Umwandlung durchmachen, ehe sie die Gestalt des erwachsenen Tieres annehmen. Bei manchen Arten findet eine Brutpflege statt, indem die Eier und Jungen in besonderen Bruttaschen sich entwickeln. Die Sterntiere, und zwar besonders die Seesterne, haben die Fähigkeit, verstümmelte oder verlorene Organe in kurzer Frist zu ersetzen. Abgeschnittene Arme wachsen sofort wieder[S. 48] neu. Ja sogar ein abgetrennter Arm wächst sich zu einem ganzen Tier aus, indem eine Mittelscheibe mit vier neuen Armen hervorsprießt. So kann also auch eine Vermehrung durch gewaltsame Teilung erfolgen. Bei einigen Seesternen findet diese Fortpflanzung durch Teilung regelmäßig neben der geschlechtlichen Fortpflanzung statt. Ihr Körper schnürt sich in zwei Hälften durch, deren jede durch Regeneration die fehlenden Teile ersetzt und so ein neues Individuum bildet. —
Der große Kreis der Würmer, die sich im allgemeinen durch einen schlauchförmigen oder bandartigen Körper kennzeichnen, zeigt entsprechend der mannigfachen Organisation des Körpers auch eine große Verschiedenheit in bezug auf die Fortpflanzung. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Teilung oder Knospung wechselt mit geschlechtlicher. Viele Würmer machen eine verwickelte Metamorphose durch, mit der oft ein Parasitismus verbunden ist. Andere Würmer führen im Larvenstadium eine freie, im Alter dagegen eine parasitäre Lebensweise, wieder andere bleiben während ihres ganzen Daseins Parasiten. Die fortpflanzungsreife Trichine wohnt niemals im Muskelfleisch, sondern stets nur im Darm. Die legereifen Weibchen bohren sich in den Darm ein und setzen hier ihre Brut ab. Die jungen Trichinen werden durch den Blutkreislauf fortgeführt und gelangen so in andere Körperteile. Sie durchbrechen die Wände der Blutgefäße, um sich schließlich im Muskelfleisch zu verkapseln. In diesem Zustande bleibt die Trichine Jahrzehnte lebensfähig. Es bildet sich mit der Zeit eine Kalkschale um den eingekapselten Körper. Gelangen die eingekapselten Trichinen durch Genuß des Fleisches in den Darm anderer Tiere oder des Menschen, so löst sich die Kalkschale auf, die Trichine wird frei und bildet sich zum fortpflanzungsfähigen Tier aus.
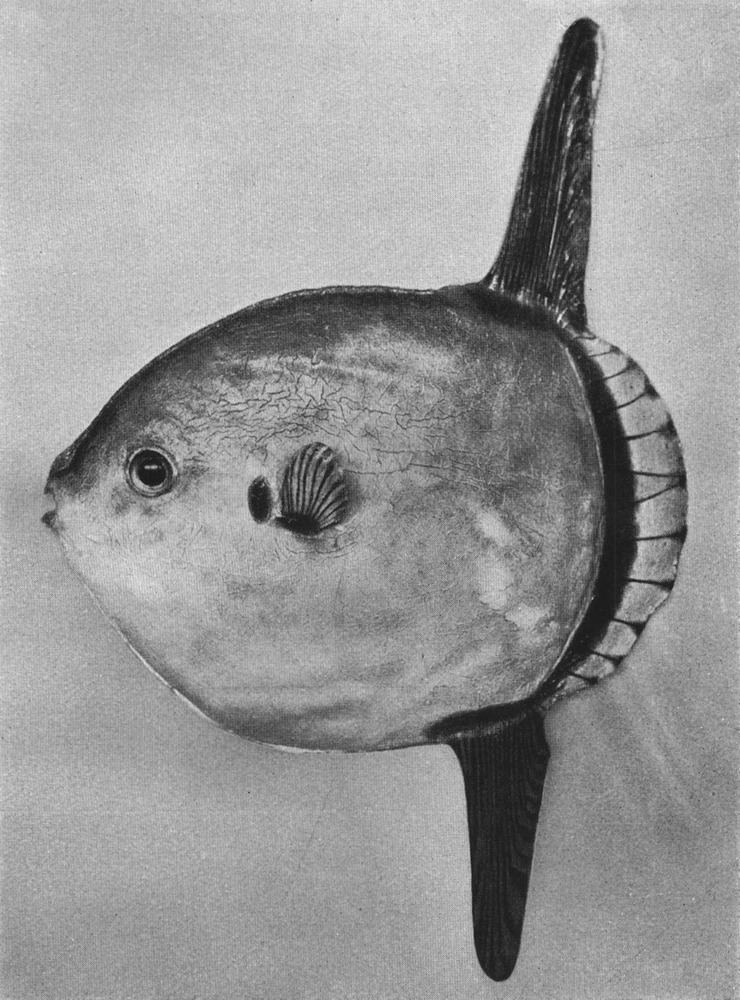
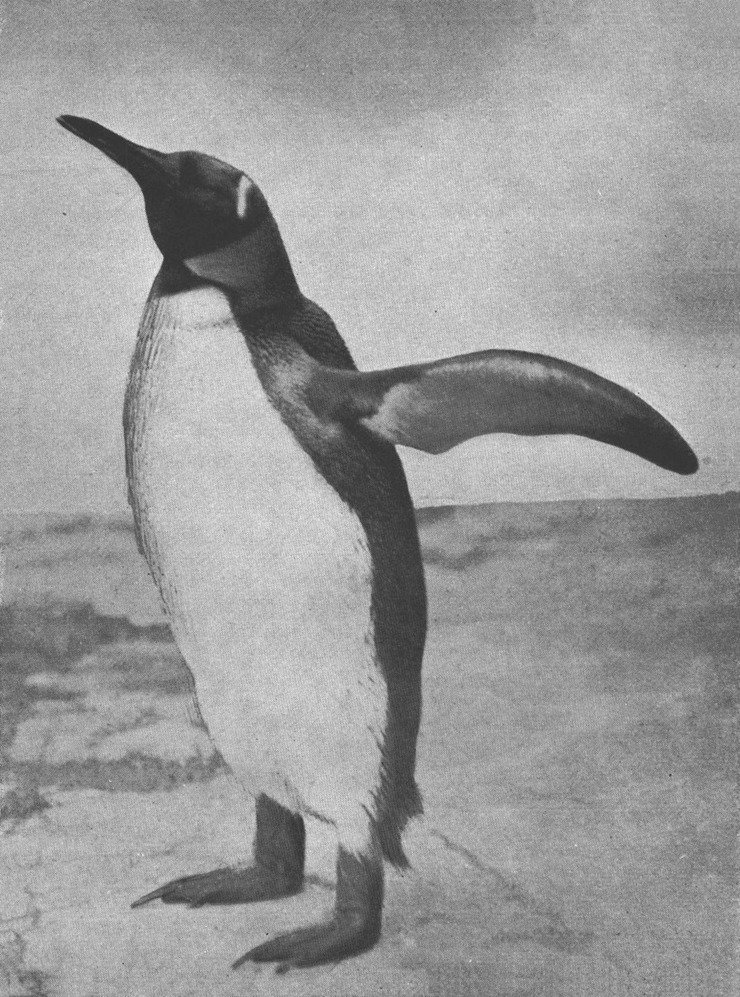
[S. 49]
Noch komplizierter ist die Entwicklung der Bandwürmer, die ein Zwischenstadium als Finne haben und als solche in der Regel nur in ganz bestimmten Wirtstieren leben.
Der gewöhnliche Bandwurm besteht aus einem Kopfteil, der durch einen kurzen Halsansatz mit dem aus einzelnen Gliedern sich zusammensetzenden Körper verbunden ist. Weder besitzt der Kopf eine Mundöffnung, noch der Leib einen Magen und Darm. Die Ernährung erfolgt durch zahlreiche, kleine Poren, die auf der ganzen Oberfläche des Leibes verteilt sind, und die aus dem im Darm liegenden Speisebrei die geeigneten Stoffe aufsaugen. Der Kopf ist ein knopfartiges Gebilde und mit Saugnäpfchen oder Widerhaken versehen, die sich im Darm anheften. Jedes Glied besitzt seine eigenen Fortpflanzungsorgane in Gestalt von männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen. Jedes Glied des Bandwurms ist also ein Geschlechtstier für sich, in dem sich durch Zwitterbildung das Geschlechtsleben abspielt. Man kann daher den Bandwurm als eine Tierkolonie auffassen.
Die Glieder mit legereifen Eiern stoßen sich ab und gelangen mit dem Kot des Wirtstieres ins Freie. Die Eier enthalten einen kugelförmigen Embryo, der mit sechs Haken versehen ist, und haben eine feste, zähe Umhüllung, die allen Witterungseinflüssen trotzt. Sie befinden sich vorzugsweise in Dunghaufen, werden aber auch vom Winde überallhin verschleppt. Gelangen sie später in den Magen eines Tieres, z. B. einer Maus, einer Ratte oder eines Kaninchens, so schlüpft der Embryo aus, bohrt sich vermittels seiner Haken durch die Magenwand und wandert in ein Organ oder auch in das Muskelfleisch. Hier legt sich der Embryo fest und wird zur Finne, die eine mit wäßriger Flüssigkeit angefüllte Blase darstellt, in derem Innern die Anlage des späteren Bandwurmkopfes eingebettet ist. Die Finne, auch Blasenwurm genannt, bleibt in diesem verkapselten[S. 50] Zustande lange Zeit, unter Umständen bis zu 20 Jahren lebensfähig. Wird mit Finnen behaftetes Fleisch von einem Tier oder vom Menschen in rohem Zustande genossen, so verwandelt sich die Finne im Darm zum Bandwurmkopf, an den dann allmählich die Glieder heranwachsen. Die abgestoßenen, legereifen Glieder werden vom Kopf aus durch neue Glieder ersetzt. Der größte Bandwurm ist der Grubenkopf (Dibothriocephalus latus), der mit 3000–4000 Gliedern eine Länge von 9 m erreichen kann. Die Finne lebt in Fischen, besonders im Hecht und in der Quappe.
Die Eierproduktion der einzelnen Glieder ist ungeheuer groß. Ein Glied des gewöhnlichen Menschenbandwurms (Taenia solium) enthält etwa 50000 Eier. Wenn täglich nur drei Glieder legereif werden, so würden im Jahre 90 Millionen Eier erzeugt werden, von denen freilich nur ein geringer Teil zur weiteren Entwicklung gelangt, etwa von fünf bis zehn Millionen nur eins. Die gewaltige Eiproduktion ist also notwendig, um ein Aussterben des Bandwurms zu verhindern. Die Natur verfolgt überhaupt das Prinzip, Tiere, die großen Gefahren ausgesetzt sind, durch eine reiche Fortpflanzung vor dem Untergang zu schützen. Die Vermehrung der Maus, die überall, wo sie sich sehen läßt, bedroht wird, ist sehr groß. Die jungen Tiere werden früh geschlechtsreif, die Würfe sind sehr zahlreich und folgen sich sehr schnell. Die Hausmaus wird bereits im Alter von sechs Wochen fortpflanzungsfähig und bringt im Laufe eines Jahres fünf- bis sechsmal Junge zur Welt. Bekannt ist die große Fruchtbarkeit des Kaninchens. Ebenso wie die Mäuse ist das Kaninchen unmittelbar nach dem Werfen wieder begattungsfähig und bringt im Laufe des Sommers 5–6 Würfe mit 4–12 Jungen zur Welt.
Die großen Raubvögel, Adler und Geier, die keinen Gefahren ausgesetzt sind, legen nur 1–2 Eier und machen jährlich nur eine[S. 51] Brut, die kleinen Singvögel, die viel Feinde haben, und deren Bestand außerdem durch die im Frühjahr und Herbst stattfindenden Wanderungen erheblich gelichtet wird, machen meist zwei, bisweilen sogar drei Bruten mit Gelegen von 4–6 Eiern. Überall also das Prinzip der schnellen und reichlichen Vermehrung, wenn die Art sehr gefährdet ist, und im Gegenteil dazu das Prinzip der Sparsamkeit, wenn eine natürliche Bedrohung fehlt. Auf diese Weise bleibt das Gleichgewicht in dem Tierbestande der Natur erhalten. Die Tiere, die keiner Gefahr preisgegeben sind und meist ein Räuberleben führen, nehmen infolge spärlicher Vermehrung nicht überhand, während arg verfolgte Tiere, die anderen Geschöpfen zur Nahrung dienen, ihren gelichteten Bestand durch eine reiche Vermehrung genügend ergänzen.
Die Bandwürmer leben als Finnen und im fertig entwickelten Zustande nur in ganz bestimmten Tieren, und zwar die Finne stets in einem anderen Tier als der Bandwurm. Die Finne des Schweines und des Rindes wird im Darm des Menschen zum Bandwurm, die Finne der Maus im Darm der Katze oder des Hundes. Die Finne des Quesenbandwurmes (Taenia coenurus), der im Darm des Hundes lebt, haust im Gehirn der Wiederkäuer, besonders der Schafe, und erzeugt hier die gefährliche Drehkrankheit. Die befallenen Tiere verlieren die Orientierung, drehen sich im Kreise herum, verweigern die Nahrung und gehen zugrunde. Auf Schäfereien soll man daher streng vermeiden, das Gehirn solcher Schafe an Hütehunde zu verfüttern, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern.
Die den Bandwürmern nahestehenden Rundwürmer machen eine ähnliche Metamorphose durch.
Im Unterschied von den Bandwürmern sind bei den Rundwürmern die Geschlechter getrennt. Die Befruchtung der stets[S. 52] erheblich größeren Weibchen erfolgt durch Begattung. Die Rundwürmer oder Kratzer haben vorn einen mit Widerhaken besetzten Rüssel, der sich tief in den Darm des Wirtstieres einbohrt und hier schwere Entzündungen, die häufig zum Tode führen, erzeugen kann. Besonders gefürchtet ist der Riesenkratzer (Echinorhynchus hirudinaceus). Seine Eier werden von Engerlingen der Mai- und Rosenkäfer gefressen, in deren Leiber die Larven ausschlüpfen und heranwachsen. Da die Schweine mit Vorliebe Engerlinge verzehren, so werden sie sehr leicht von dem gefährlichen Schmarotzer befallen, indem sich die Larve in dem Darm des Schweines zum Wurm umbildet. Eine gründliche Vertilgung der Maikäfer ist auch in dieser Beziehung für den Landwirt außerordentlich wichtig.
Unter den niederen Tieren bieten die Schnecken viel Interessantes in ihrem Liebesleben. Die große Schlammschnecke (Limnaea stagnalis), die in unseren stehenden Gewässern überall vorkommt, ist ein Zwitter. Jedes Tier hat sowohl männliche wie weibliche Geschlechtsteile. Trotzdem ist eine gegenseitige Begattung die Regel, bei der das eine Tier als Weibchen, das andere als Männchen sich betätigt. Dasselbe Tier ist also imstande, einmal die Liebe als Frau, ein anderes Mal als Mann zu genießen. Dagegen kommt eine gleichzeitige Betätigung der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane zweier Partner nicht vor. Wohl aber kann sich ein drittes Tier zu dem Liebesakt zweier Schnecken zugesellen. Es besteigt das obere Tier, welches sich als Männchen betätigt, und führt in dessen freiliegende weibliche Geschlechtsöffnung sein Zeugungsorgan ein. Diese dritte Schnecke wird häufig von einer vierten und diese wieder von einer fünften vergewaltigt. So entsteht eine Kette von Schnecken im Liebesrausch. Das unterste Tier tritt nur als Weibchen, das oberste Tier nur als[S. 53] Männchen in Tätigkeit, alle anderen Tiere genießen die Freuden der Liebe doppelt. Verurteilt man die Schnecke zur Einzelhaft, so begattet das liebesdürstige Tier sich selbst, indem es das lang vorstreckbare Zeugungsglied in seine eigne Scheide einführt.
Bei den Landschnecken finden wir ebenfalls ein sehr ausgeprägtes Liebesleben, in dem die Tiere durch allerlei grausame Mittel, die geradezu sadistisch genannt werden können, sich gegenseitig reizen. Die Landschnecken sind gleichfalls Zwitter. Die liebesbedürftigen Tiere leiten die Begattung durch ein seltsames und lange dauerndes Vorspiel ein. Die Schnecken richten sich in heftiger Erregung aneinander hoch, sinken darauf wieder zurück, um eine Ruhepause von 15–30 Minuten zu machen. Dann beginnt das Spiel von neuem, das aber jetzt sehr lange, bisweilen bis zu zwei Stunden anhält, wobei die Tiere ihre Körper mit den Unterseiten aneinander reiben. Der Vorgang endet damit, daß das stärker erregte Tier seinen „Liebespfeil“, ein dolchartiges Kalkstück seines Geschlechtsteils, mit aller Gewalt tief in den Leib des Partners stößt. Das verwundete Tier zuckt vor Schmerz zusammen. Das Schmerzgefühl erhöht die Geilheit, und nun erfolgt die gegenseitige Begattung, bei der jedes Tier gibt und empfängt. Die gegenseitige Befruchtung dauert bei einigen Schneckenarten fast eine Stunde. Die afrikanischen Nachtschnecken besitzen ein ganzes Bündel solcher Liebespfeile, mit denen sie den Partner durchbohren. Andere Arten haben anstatt eines Pfeiles einen mit scharfen Dornen besetzten Lappen, mit denen die Tiere sich reiben.
Während der Paarung erfolgt eine starke Schleimabsonderung des Körpers, der noch lange die Spuren eines solchen Liebesdramas verrät, besonders wenn der Schleim mit rotem Farbstoff gemischt ist, wie bei einigen italienischen Schneckenformen.
[S. 54]
Das komplizierte Liebesleben der Schnecken ist jedenfalls das Eigenartigste und Wundersamste, was die Natur, die unerschöpflich ist in ihrem Schaffen, auf diesem Gebiet ersonnen hat. —
Auch bei den Insekten zeigen Fortpflanzung und Liebesleben manch fesselnde und eigenartige Erscheinung.
Die Insekten oder Sechsfüßler bilden die artenreichste Klasse im ganzen Tierreich. Die Dreizahl beherrscht die Gliederung des Körpers, der in drei Abschnitte, Kopf, Brust und Leib zerfällt, die deutlich voneinander abgesetzt sind. Die scharfe Abschnürung des Leibes der Wespe von ihrer Brust ist ja als „Wespentaille“ sprichwörtlich geworden. Auch die Brust gliedert sich wieder in drei Teile: Vorderbrust, Mittelbrust und Hinterbrust. Der Körper ist mit einer Chitinhaut bekleidet, die aus einer höchst eigentümlichen stickstoffhaltigen Holzmasse besteht. Das Chitin ist außerordentlich widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, was am besten daraus hervorgeht, daß sich ausgetrocknete Insektenleiber ohne besondere Konservierung Jahrhunderte in Sammlungen aufbewahren lassen, ohne daß sie ihre Gestalt verlieren oder irgendeine Einbuße erleiden. Bei den Käfern bildet die sehr harte Chitinhülle einen festen Panzer, bei den Heuschrecken ist sie eine lederartige Haut und bei den Fliegen und Schmetterlingen dünn und weich.
Sehr wichtige Organe für das Leben der Insekten sind die am Kopf sitzenden Fühler, die in erster Linie dem Tastsinn dienen, aber auch das Gehör und den Geruch zu vermitteln scheinen. Die Fühler sind von außerordentlich verschiedener Gestalt, so daß sich eine allgemeine Angabe überhaupt nicht machen läßt. Sie sind bald kolbenförmig, bald borstenförmig, becherartig oder fadenartig dünn und lang und bestehen aus zahlreichen Gliedern, deren Anordnung ebenso mannigfaltig ist, so daß man von gezähnten, geblätterten oder geschuppten Fühlern sprechen kann.
[S. 55]
Bei den Bockkäfern erreichen die Fühler eine außerordentliche Länge, die bei manchen Arten die Leibeslänge um ein Vielfaches übertrifft. Die Bockkäfer gebrauchen ihre langen Fühler als Balancierstangen beim Klettern, indem sie dieselben seitwärts ausstrecken.
Die Insekten atmen nicht durch den Mund, sondern durch Öffnungen (Stigmen) am Leibe und der Brust, die mit einem den Körper durchziehenden Röhrensystem, Tracheen genannt, in Verbindung stehen.
Fast alle Insekten machen in ihrer Entwicklung eine Metamorphose durch. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich verpuppen. Aus der Puppe entsteht dann erst das fertige Insekt, Imago genannt. Larve und Imago sehen ganz verschieden aus, wie es ja unverkennbar in der Raupe und dem Schmetterling sich ausprägt. Die Puppen sind „freie Puppen“, wenn die Gliedmaßen des Insekts bereits frei liegen, man nennt sie „Mumienpuppen“, wenn sie ein geschlossenes Ganzes bilden, an dem die Leibesteile des fertigen Insekts nur durch Furchen oder geringe Erhöhungen angedeutet sind, und „Tönnchenpuppen“, wenn die Puppe mit einer besonderen Hülle, dem Kokon, umgeben ist.
Bisweilen fehlt das Puppenstadium. So bildet sich in der im Wasser lebenden Larve der Libelle allmählich das fertige Insekt aus. Die verwandlungsfähige Larve kriecht an einem Pflanzenstengel aus dem Wasser heraus, ihre Haut platzt auf dem Rücken auf und die fertige, geflügelte Libelle steigt heraus wie ein Phönix aus der Asche.
Die Dauer des Larvenzustandes und der Puppenruhe wie die Lebenszeit des fertigen Insekts sind sehr verschieden. Meist spielt sich der ganze Vorgang im Laufe des Sommers ab, und das Insekt stirbt gleich nach der Fortpflanzung noch vor dem Winter.[S. 56] Die Lebenszeit der Insekten ist also eine recht kurze. Häufig folgen sich sogar zwei oder mehrere Generationen im Laufe des Sommers. Nach ihrer kurzen, bisweilen nur nach Stunden zählenden Lebensdauer führt die Eintagsfliege ihren Namen. Die Eintagsfliegen entwickeln sich wie die Libellen ohne Puppenstadium unmittelbar aus der ans Land steigenden Wasserlarve, um sofort ihren luftigen Hochzeitsreigen zu beginnen. Ihr kurzes Dasein, das jedoch nicht immer nur auf einen Tag beschränkt ist, sondern bisweilen auch 2–3 Tage währen kann, ist einzig und allein dem Liebesleben gewidmet. Die zarten Tiere haben nur verkümmerte, unbrauchbare Mundteile und nehmen keine Nahrung zu sich. Alles ist auf das Geschlechtsleben eingestellt. Die Männchen vereinigen sich zu Tausenden und Millionen, um über dem Wasserspiegel ihre gemeinsamen Tänze aufzuführen, an denen die Weibchen nicht teilnehmen. Erscheint ein Weibchen in der Nähe des Tanzplatzes, so stürzen sich mehrere Männchen auf den begehrten Schatz. Eins von ihnen vereinigt sich mit dem Weibchen, während die übrigen sich wieder der tanzenden Schar zugesellen, um vielleicht das nächste Mal mehr Glück zu haben.
Das Männchen besiegelt die Freuden der Liebe mit dem Tode, und auch das Weibchen geht den Weg allen Fleisches, sobald es die Eier im Wasser abgelegt hat. Die Weibchen einiger Arten verbringen 10–14 Tage nach der Begattung regungslos an einem ruhigen Ort, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. In dieser Zeit entwickeln sich die im Leibe befindlichen Eier zu Embryonen, die von dem Weibchen lebendig am Wasser zur Welt gebracht werden. Die größte europäische Eintagsfliege, in Ungarn „Theißblüte“ genannt, erscheint stets an gewissen Tagen in gewaltiger Menge, so daß Land und Wasser unter den Tanzplätzen der Männchen mit den Leibern der ermatteten Insekten dicht besät sind. Das Platzen[S. 57] der Larvenhüllen und das Ausschlüpfen der Fliegen, was stundenlang unaufhörlich vonstatten geht, erzeugt ein rieselndes Geräusch, wie ein leiser Regen. An der Lippe, besonders bei Hamm in Westfalen, an der Maas in Belgien, an der Donau und Theiß in Ungarn wiederholen sich jedes Jahr die gewaltigen Schwärme dieser Eintagsfliege.
Beim Maikäfer dauert das Larvenstadium 3–4 Jahre. Der erwachsene Engerling verpuppt sich im August. Im November kriecht der Käfer aus und verharrt unter der Erde, bis die Frühjahrssonne im Mai ihn aus seinem dunkeln Versteck herauslockt. Das Männchen stirbt während der lange währenden Begattung ab, wird dann vom Weibchen abgestreift, welches sich in die Erde verkriecht, um seine Eier abzulegen und dann ebenfalls zu sterben. Bei den Insekten sind Fortpflanzung und Tod auf das innigste miteinander verknüpft. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bei den Läusen findet eine wiederholte Fortpflanzung statt. Eine Kopflaus bringt es in 2 Monaten auf etwa 5000 Nachkommen. Die jungen Läuse, die keine Metamorphose durchlaufen, sondern gleich fertig dem Ei entschlüpfen, sind bereits in 2–3 Wochen fortpflanzungsfähig. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Bettwanze, die den ganzen Sommer hindurch eine reiche Nachkommenschaft erzeugt und dann überwintert, um im nächsten Jahre ihre fruchtreiche Tätigkeit fortzusetzen. Die Wanzen sind überaus lebenskräftig, vertragen Kälte und langes Fasten. Ein Forscher hielt eine lebende Wanze ein halbes Jahr in Einzelhaft ohne Nahrung.
Ebenso wie das Puppenstadium oder Larvenstadium kann unter Umständen auch das Eistadium in der Entwicklung der Insekten fortfallen. Wir sahen schon, daß es lebendiggebärende Eintagsfliegen gibt. Auch die Schmeißfliegen legen keine Eier, sondern die Maden schlüpfen bereits im Mutterleibe aus.
[S. 58]
Während bei vielen Insekten entweder die Eier oder Larven überwintern und dadurch die Art erhalten bleibt, überwintern bei den Wespen die Weibchen der letzten Sommergeneration, um im folgenden Frühjahr ein neues Staatenwesen zu gründen.
Bei den Bienen hat die Königin, welche bekanntlich die einzige fortpflanzungsfähige weibliche Biene im Bienenstaat ist, ein Leben von 4–5 Jahren und legt jährlich 50000–60000 Eier. Eine so lange Lebenszeit eines Insekts im Imago-Zustande ist aber eine Ausnahme. Die meisten Insekten verbringen den größten Teil ihres Daseins als Larve, und die Umwandlung zum fertigen Insekt dient lediglich der Fortpflanzung und bildet den Abschluß des Lebens.
Bei den Bienen haben wir drei Geschlechter zu unterscheiden: die Königin, welche allein Eier legt, die männlichen Drohnen und die Arbeiter als unfortpflanzungsfähige weibliche Bienen. Die Königin wird zu Beginn ihres Lebens nur einmal von einer Drohne befruchtet. Sie unternimmt zu diesem Zweck einen Ausflug im Gefolge zahlreicher Drohnen, unter denen nur einer das Glück des Liebhabers zuteil wird. Dann kehrt sie als „Frau“ in den Stock zurück, in dem sie als „Gefangene“ unter sorgsamer Pflege der Arbeiterinnen lebt, bis sie von einer neuen, jungen Königin vertrieben wird. Ihre ganze Tätigkeit besteht einzig und allein darin, Eier zu legen. Der männliche Same wird in besonderen Samentaschen aufbewahrt und bleibt hier während der ganzen Lebenszeit der Königin „gebrauchsfähig“. Die Königin hat es nämlich ganz in der Gewalt, ob das Ei, welches sie legt, befruchtet werden soll oder nicht. Im ersteren Fall wird das Ei einen Augenblick an die Öffnung der Samentaschen angepreßt, wodurch einige Samenfäden austreten und mit dem Ei verschmelzen. Soll die Befruchtung verhindert werden, so gleitet das Ei[S. 59] schnell an den Samentaschen vorbei. Aus den befruchteten Eiern gehen die Arbeiter hervor, aus den unbefruchteten Eiern die männlichen Drohnen. Ist der Inhalt der Samentaschen erschöpft, was bei zu langer Lebensdauer der Königin eintreten kann, dann werden nur noch Drohnen erzeugt, und da die Arbeiter fehlen, so geht ein solcher „drohnenbrütiger“ Stock zugrunde.
Bei den Bienen haben wir also eine doppelte Art der Fortpflanzung, einmal eine geschlechtliche durch Zeugung, und zweitens eine „parthenogenetische“, d. h. jungfräuliche (Párthenos, griechische Bezeichnung für Jungfrau).
Die Parthenogenesis kommt bei vielen Insekten vor, jedoch immer in Verbindung oder Abwechslung mit geschlechtlicher Fortpflanzung. Den Wechsel beider Arten der Fortpflanzung nennt man „Heterogonie“. So spielt bei den durch ihre vorzügliche Mimikry ausgezeichneten Stabheuschrecken die Jungfernzeugung eine besondere Rolle. Die meisten Tiere sind weiblichen Geschlechts; die viel kleineren Männchen sind sehr selten. Die Fortpflanzung erfolgt fast immer ungeschlechtlich, und zwar gehen hier aus den parthenogenetischen Eiern stets Weibchen hervor. Die Jungfernzeugung setzt sich durch viele Generationen hindurch fort, hat man doch von gefangenen Stabheuschrecken schon mehr als 20 Generationen auf diesem Wege entstehen sehen. Eine ausschließliche Jungfernzeugung scheint jedoch nicht möglich zu sein, denn sonst brauchte es überhaupt keine Männchen zu geben. Zur Erhaltung der Art ist, wenn auch selten, so doch hin und wieder eine geschlechtliche Fortpflanzung notwendig. Aus den befruchteten Eiern werden anscheinend nur Männchen erzeugt.
Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur Honigbiene zurück. Wenn die Königin nur einmal in ihrem Leben begattet wird, wozu, kann man fragen, sind dann im Bienenvolk die vielen[S. 60] Drohnen notwendig? Im Bienenvolk entstehen im Laufe des Sommers junge Königinnen aus befruchteten Eiern, indem die Larven von den Arbeitsbienen mit einem besonders eiweißhaltigen Futterstoff, dem „Königinnenfutter“, versorgt werden. Durch bessere Ernährung wird also aus der weiblichen Larve anstatt einer unfruchtbaren Arbeitsbiene eine fortpflanzungsfähige Königin auf künstlichem Wege ausgebildet. Ist diese herangewachsen, dann verläßt die alte Königin ihr Heim, gefolgt von einer großen Anzahl Bienen. Die Bienen „schwärmen“, wie der Imker sagt, um an anderer Stelle mit der alten Königin einen neuen Staat zu gründen. Die junge Königin des alten Stockes übernimmt dort die Regentschaft und macht im Verlaufe der ersten 14 Tage ihren Hochzeitsflug in Begleitung zahlreicher Drohnen. Wenn auch nur eine männliche Biene zur Befruchtung notwendig ist, so hat die Masse der Drohnen doch ihre Bedeutung. Die Königin wird bei ihrem Fluge durch die Drohnen, die sie von allen Seiten umschwärmen, gegen die Nachstellungen insektenfressender Vögel geschützt, und hierin ist wohl der Grund für die zahlreiche Drohnenansammlung im Bienenstock zu erblicken. Die meisten Drohnen kommen niemals in ihrem Leben zu einer geschlechtlichen Betätigung. Ihre Lebensaufgabe besteht einzig und allein darin, die junge Königin auf ihrem Hochzeitsfluge zu beschützen. Die Drohne, die von der Königin zum Liebhaber auserkoren wurde, besiegelt ihr Glück mit dem Tode. Aber nicht besser ergeht es den übrigen Drohnen, die die Königin begleiteten. Ihre Lebensaufgabe, den Hochzeitsreigen der jungen Herrscherin zu schützen, ist erfüllt, und ihr Dasein hat keine Berechtigung mehr. Bei ihrer Rückkehr in den Stock harrt ihrer ein trauriges Los. Die Arbeiterinnen, die sie früher sorglich fütterten und pflegten, fallen über sie her und töten die elenden Ritter, die sich wehrlos in ihr Schicksal ergeben.[S. 61] Einige ängstliche Gemüter suchen sich dem Blutgericht zu entziehen und verbergen sich in Schlupfwinkeln, wo sie elend verhungern.
Sind im Sommer keine weiteren Königinnen mehr zu erwarten, dann beginnt ein neues Blutgericht. Die Drohnen werden von den Arbeiterinnen abgeschlachtet, da sie als unnütze Fresser und Faulenzer überflüssig sind. Das Prinzip der Unterstützung für Nichtstun, das ein Volk zur Bequemlichkeit und Faulheit erzieht, kennt die strenge Zucht und Ordnung des Bienenstaates nicht!
Die erste Arbeit, welche die junge Königin in ihrem neuen Heim verrichtet, geht darauf aus, sich die Alleinherrschaft zu sichern. Sie tötet sämtliche noch vorhandenen Königinnenlarven in ihren Zellen. Nicht immer gelingt ihr das grausame Werk. Bisweilen wird wieder eine junge Königin flügge, der dann die Vorgängerin das Feld räumt, indem sie mit einem neuen Schwarm auswandert. Das Auswandern der Königin erfolgt, bevor die neue Königin ihre Wiege verlassen hat. Die Arbeitsbienen bewachen die Königinnenzelle mit größter Sorgfalt und lassen die junge Herrscherin nicht eher frei, bis die alte Königin das Feld geräumt hat. Befindet diese sich ausnahmsweise noch im Stock, wenn ihre Nachfolgerin ausschlüpft, dann entspinnt sich sofort ein heftiger Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden Rivalinnen. Niemals dulden sich zwei Königinnen nebeneinander im Bienenstaat.
Verliert ein Stock durch Zufall seine Königin, dann ist er nicht dem Untergang preisgegeben, da die Arbeitsbienen jederzeit in der Lage sind, Larven ihresgleichen durch geeignete Fütterung zur Königin heranzubilden.
Ebenso wie Königin- und Arbeiterlarven wachsen auch die Drohnen in besonderen Zellen heran und werden mit einem eigenen Futter versorgt.
[S. 62]
Die Lebensdauer der Arbeiterbienen währt im Sommer nicht länger als 6 Wochen. Nur die letzte Generation überwintert, um im Frühjahr, wenn das Bienenleben wieder beginnt, die erforderlichen Arbeiten verrichten zu können.
Bei den staatenbildenden Ameisen ist ebenso wie bei den Bienen die Königin nur Eiermaschine, die die Fortpflanzung besorgt. Die Arbeiter sind verkümmerte Weibchen, zu denen sich noch eine andere Kaste, die „Soldaten“, gesellt, welche ebenfalls unfruchtbare Weibchen sind. Über ihre Lebensaufgabe wie über die Arbeitsteilung im Bienen- und Ameisenvolk wird uns das spätere Kapitel „Soziales Leben und Staatenbildung“ eingehende Aufklärung geben.
Arbeiter und Soldaten sind ungeflügelt, die Königin und die Männchen der Ameisen tragen Flügel. Die Königin legt jedoch, sobald sie ihre Geburtsstätte verlassen und ein eigenes Heim gegründet hat, die Flügel ab. Sie wird zum unflugfähigen Insekt und führt bis an ihr Lebensende die Herrschaft im Ameisenstaat, während die jungen, anfangs geflügelten Königinnen auswandern. Der Vorgang ist also gerade umgekehrt wie bei den Bienen. Der erste und einzige Flug, den die junge Königin unternimmt, ist der Hochzeitsreigen, bei dem die einmalige Begattung erfolgt.
Die Königinnen der Ameisen kennen nicht die Eifersucht, die die Bienenköniginnen erfüllt. Dank ihrer verträglichen Natur dulden sich mehrere Weibchen nebeneinander.
Bei den Ameisen gibt es zwischen der Königin und den Arbeiterinnen noch Übergangsformen, d. h. Arbeiterinnen, die der Königin ähnlich sind und parthogenetische Eier legen, aus denen Arbeiter hervorgehen. Auch die Arbeiterinnen unterscheiden sich durch ein verschiedenartiges Aussehen, es gibt Formen mit sehr großem Kopf (Makroergaten)! und ganz kleine Tiere (Mikroergaten).[S. 63] Die letzteren sind gewöhnlich die ersten Nachkommen einer jungen Königin. Für die Geschlechtsbestimmung der Ameisen ist jedenfalls wie bei den Bienen die Nahrung, welche die Larve erhält, von Einfluß. —
In sehr eigenartiger Weise verläuft das Fortpflanzungsgeschäft der zu den Zweiflüglern gehörenden Ibisfliege (Atherix ibis), die am Wasser lebt. Zur Ablage der Eier bilden die Weibchen große Gesellschaften. Ein Weibchen klammert sich an einem über dem Wasser hängenden Zweig an, heftet den Eiklumpen fest und stirbt sofort. Auf den toten Körper läßt sich ein zweites Weibchen nieder, benutzt diesen als Brutstätte und bleibt als Leiche daran hängen. So geht es unaufhörlich fort, bis sich schließlich ein großer Klumpen toter Fliegen gebildet hat, der wie eine Traube herunterhängt. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven ernähren sich zunächst von den toten Leibern ihrer Mütter und lassen sich dann ins Wasser herabfallen, um ihre weitere Entwicklung fortzusetzen. Die schwarze Ibisfliege mit glashellen Flügeln lebt in Mitteleuropa, ist aber nirgends häufig.
An den Blättern der Bäume sehen wir häufig eigentümliche, kugelförmige Gebilde. Sie rühren von einem Insekt her, der Gallwespe. Die Gallwespen bringen ihre Eier durch einen Stich in das Fleisch eines Blattes. Hier schlüpfen die Larven aus. Es bildet sich dann die Galle, die die Larve völlig umschließt. Ihre Entstehung wird also nicht allein durch den Stich der Wespe hervorgerufen, sondern auch durch Einwirkung der Larve auf die Zellen des Blattes. Der Vorgang selbst ist jedoch unbekannt. In der Galle macht dann die Larve ihre ganze Entwicklung bis zum fertigen Insekt durch. Häufig enthält eine Galle mehrere Larven in besonderen Zellen. Bei den Gallwespen wechselt geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung ab.
[S. 64]
Die Schlupfwespen oder Ichneumoniden legen ihre Eier in die Leiber anderer Insekten, deren Raupen und Puppen, oder in die Eier. Die Larven wachsen im Innern des Wirtstieres heran, verpuppen sich hier, um schließlich als fertige Schlupfwespe zum Vorschein zu kommen. Bei einigen Arten verlassen die Larven vor der Verpuppung ihre lebende Behausung. Das Schmarotzertum hat in den meisten Fällen den Tod des Wirtstieres zur Folge. Da die Ichneumoniden mit Vorliebe die forstschädlichen Insekten zu ihrem Brutschmarotzertum auswählen, so sind sie außerordentlich nützlich und tragen in erster Linie zur Bekämpfung von Insektenkalamitäten bei, vielleicht ebenso gut oder noch besser als die insektenfressenden Vögel, die durch Vertilgung von Schlupfwespen ihren sonst so großen Nutzen, den sie als Insektenfresser stiften, teilweise wieder aufheben. Man hat infolgedessen versucht, die wirtschaftliche Bedeutung der Vögel herabzusetzen und den Vogelschutz aus diesem Grunde für unnötig zu erklären, eine Auffassung, die aber mit den wertvollen Versuchen unseres ersten Vogelschützers, des Freiherrn von Berlepsch, nicht im Einklang steht. Dieser verdienstvolle Ornithologe hat durch jahrelange Versuche in seiner Vogelschutzstation Seebach nachgewiesen, daß der Nutzen der Vögel zur Bekämpfung einer Insektenkalamität gewaltig groß ist. Während in seiner Forst, die durch Nistkästen und Vogelschutzgehölze ein wahres Vogelparadies ist, seit langen Jahren keine Raupenplage auftrat, wurde die angrenzende Staatsforst, in der kein organisierter Vogelschutz betrieben wird, zu gleicher Zeit wiederholt von schwerem Raupenfraß heimgesucht, der stets an der Grenze des vogelreichen Berlepschschen Reviers haltmachte — ein deutlicher Beweis, daß die Tätigkeit der Vögel bei weitem höher eingeschätzt werden muß als der Nutzen der Schlupfwespen. —
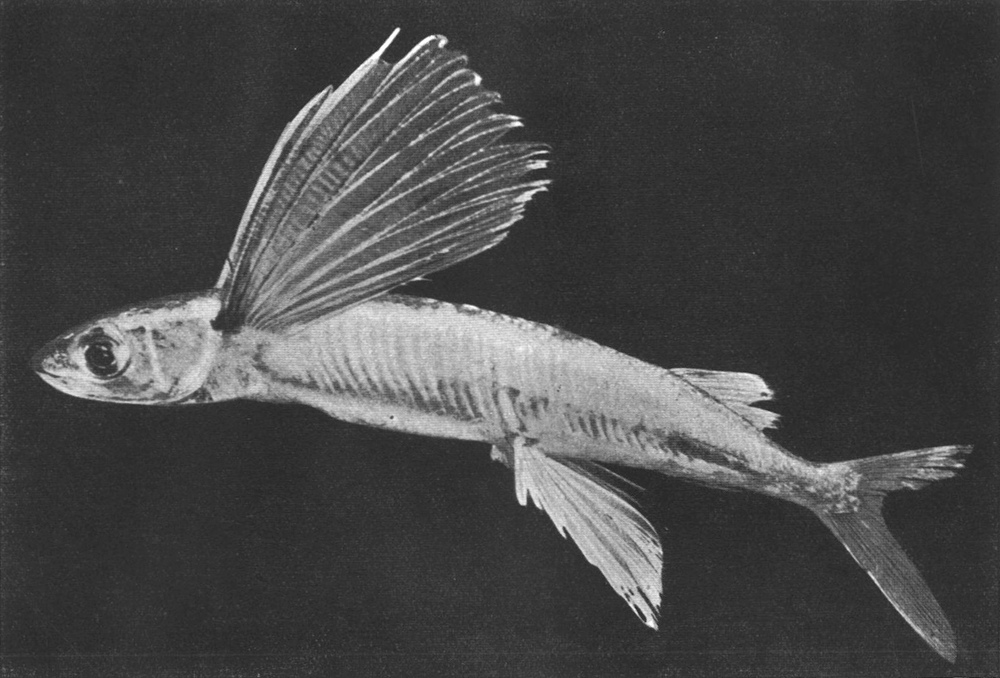
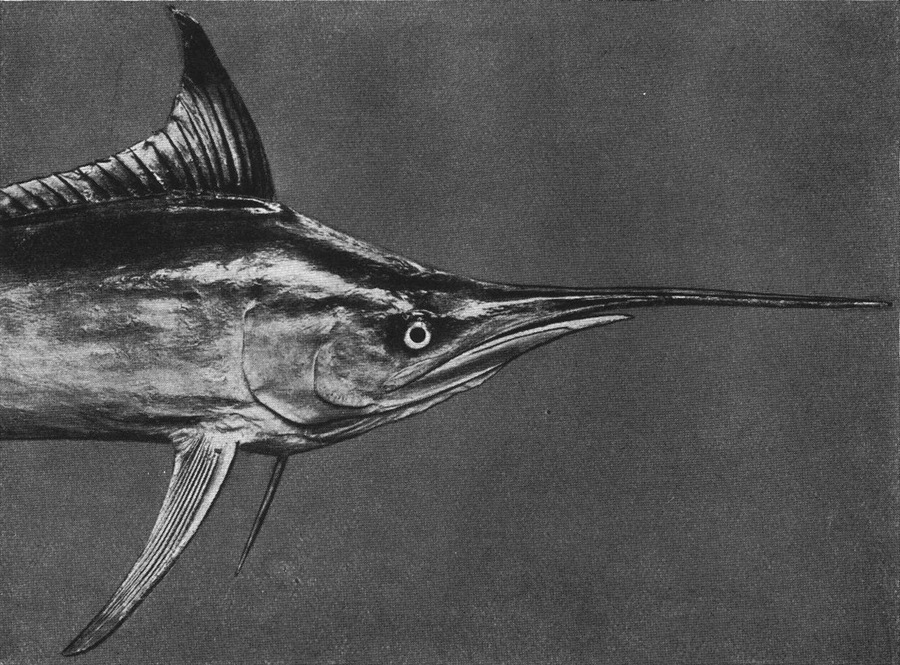
[S. 65]
Die Fortpflanzung der Schlupfwespen zeigt noch eine andere Eigentümlichkeit. Bei einigen Arten kommt aus einem Ei nicht eine einzelne Larve heraus, sondern es schlüpfen aus demselben Ei eine ganze Anzahl von Larven, die nach Hunderten zählen können. Diesen eigenartigen Vorgang, die Entwicklung vieler Individuen aus einem einzigen Ei, hat man „Polyembryonie“ genannt. Alle aus demselben Ei hervorgegangenen Wespen haben stets das gleiche Geschlecht.
Ein ähnlicher Vorgang wurde sogar bei den Säugetieren festgestellt. Bei einem südamerikanischen Gürteltier spaltet sich das Ei in vier Teile, aus denen sich je ein Individuum entwickelt. Auch die Zwillingsgeburten des Menschen entstammen nicht immer zwei Eiern, sondern bisweilen nur einem Ei, das zwei Zellkerne enthält. Die Wissenschaft unterscheidet daher „eineiige“ und „zweieiige“ Zwillinge. —
Unter den Fischen gibt es einige Arten, die man als lebendiggebärend bezeichnen kann, da der Laich bereits im Mutterleibe auskommt und die jungen Fischchen also lebend geboren werden. Hierzu gehören Haifische, Rochen, einige Zahnkarpfen und mehrere andere Arten. Bei den lebendiggebärenden Fischen findet eine regelrechte Kopulation der Geschlechter statt, wobei häufig eigenartige Stellungen eingenommen werden. So schlingt bei den Haien sich das Männchen kreisartig um den Körper des Weibchens herum, um die zu einem Begattungsorgan umgebildete Bauchflosse in die weibliche Geschlechtsöffnung einzuführen. Die Vereinigung währt etwa 20 Minuten.
Bei den meisten Fischen ist eine äußere Befruchtung die Regel, indem beide dicht nebeneinander stehenden Geschlechter ihre Zeugungsprodukte ins Wasser entleeren, wo das Sperma sich mit den Eiern vermischt. Dem Laichakt gehen häufig erregte[S. 66] Liebesspiele voraus. Die Fische „reiben sich“, d. h. Männchen und Weibchen schwimmen dicht aneinander vorbei und berühren sich mit dem Bauch oder den Seiten. Schmerlen und Schleie reiben mit den verdickten Strahlen ihrer Bauchflossen die Weibchen, um sie geschlechtlich zu reizen.
Einen sehr erregten Liebestanz führt eine kleine Barbe (Danio rerio H.) auf, die ein beliebter Zierfisch in der Aquarienliebhaberei ist. Männchen und Weibchen wirbeln umeinander herum, wobei das Männchen das Weibchen fortwährend mit dem Maule stößt und pufft. Schließlich hebt das Männchen von unten mit dem Kopf das Weibchen bis zur Oberfläche des Wassers empor, wo sich beide im Sinnenrausch mit zappelnden Bewegungen umeinander herumschleudern.
Die meisten Fische leben polygam, und zwar verkehrt entweder ein Weibchen mit mehreren Männchen (Polyandrie), oder es besitzt ein Männchen mehrere Weibchen (Polygynie). Die Haie und wenige andere Fische leben monogam. Die Haifische sollen sogar eine lebenslängliche Ehe schließen.
Die Fruchtbarkeit der Fische ist ungeheuer groß. Die Scholle legt je nach ihrer Größe 9000–500000 Eier. Der Dorsch produziert sogar mehrere Millionen Eier in einer Laichperiode. Im Gegensatz dazu legt der Stichling jährlich nur 80–100 Eier, was wohl die geringste bei den Fischen vorkommende Eizahl ist.
Die Eier werden entweder einzeln abgelegt, oder sie bilden Schnüre und Klumpen.
Der Laich wird teils an Pflanzen oder Steinen angeheftet, oder er sinkt vermittels seiner natürlichen Schwere zu Boden, oder schwimmt frei im Wasser in einer bestimmten Tiefe. Die letztere Art der Eier besitzen dann besondere Öltropfen, welche[S. 67] das spezifische Gewicht verringern, oder auch Schwebevorrichtungen in Gestalt von Fäden und Borsten.
Manche Seefische laichen in großen Tiefen, der Aal z. B. in 1000 m Tiefe.
Die Entwicklung des Laiches ist hauptsächlich von der Temperatur des Wassers abhängig. Forellenlaich entwickelt sich bei 2 °C in 205 Tagen, bei 10 °C dagegen in 41 Tagen.
Die Entwicklungsdauer der Eier unter normaler Temperatur schwankt je nach der Fischart zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten. Beim Karpfen beträgt sie etwa eine Woche, bei den Lachsen 2–3 Monate.
Nicht alle jungen Fische haben bei der Geburt gleich ihre richtige Fischgestalt, sondern besitzen bisweilen anfangs eine Larvenform, aus der sich erst allmählich der vollendete Fisch herausbildet. Dies ist bei den Neunaugen, dem Aal und den Plattfischen der Fall, worüber in dem Kapitel „Wanderungen der Tiere“ noch näher berichtet werden soll.
Die meisten Fische kümmern sich nicht um den Laich und ihre Nachkommenschaft, einige machen jedoch eine Ausnahme und betätigen sich in einer mehr oder weniger ausgeprägten Brutpflege, die in höchster Weise bei den nestbauenden Fischarten hervortritt.
Andere Fische bauen zwar keine Nester, aber sie wissen in anderer Weise sehr geschickt, man könnte fast sagen sinnig, für eine geeignete Kinderstube zu sorgen. Das Weibchen des Bitterlings (Rhodeus amarus) bringt den Laich vermittels seiner langen, wurmartigen Legeröhre in die Kiemen der Malermuschel. Da die Schalen dieser Muschel in der Kiemengegend etwas klaffen, so kann die Legeröhre des Fisches nicht beschädigt werden, wenn die Muschel ihre Schalen schließt. Während des Laichaktes hält sich das Männchen in der Nähe auf, um seinen Samen in den Atemschlitz[S. 68] der Muschel zu ergießen, sobald das Weibchen abgelaicht hat. Die Befruchtung des Laiches erfolgt also innerhalb der Muschel. Die in den Kiemen der Muschel ausgeschlüpfte Fischbrut gelangt durch die Kloakenöffnung ins Freie. Die Muschel erleidet durch den eigentümlichen Ammendienst keinen Schaden. Das Vorhandensein von Fischlaich in der Malermuschel wurde zuerst im Jahre 1787 bekannt, und 1869 entdeckte Noll, daß der Bitterling der Urheber dieser eigentümlichen Erscheinung ist.
Der Bitterling ist ein zu der Familie der Karpfen gehörender, kleiner europäischer Flußfisch, mit grünem Rücken und silberglänzenden Seiten. In der Fortpflanzungszeit legt das Männchen ein farbenprächtiges Kleid an. Der ganze Körper enthält einen schönen Schillerglanz, in dem Stahlblau und Violett besonders hervortreten. Die Körperseiten sind durch einen smaragdgrünen Längsstreifen geziert. Brust und Bauch sind orangegelb, Rücken- und Afterflosse hochrot.
Das Weibchen des Butterfisches (Pholix gunellus) wählt als Brutofen das Bohrloch einer Muschel, rollt sich in Schlangenwindungen um die Eier und verharrt in dieser Stellung, bis die Jungen ausschlüpfen. Hier findet also eine regelrechte Brutpflege statt. Der Butterfisch hat aalähnliche Gestalt und glatte Haut. Er lebt in den Küstengewässern Nordeuropas und im Nördlichen Eismeer.
Die Cichliden, welche Flüsse und Seen der Tropen bewohnen, brüten den Laich in ihrem Maule aus und führen daher auch den Namen „Maulbrüter“. Im Maule der Mutter verbleiben auch die embryonenhaften Jungen so lange, bis sie Fischgestalt erhalten haben, was etwa 14 Tage währt. Während dieser Zeit erweitert sich beim alten Fisch die Haut des Unterkiefers zu einem Sack, in dem die junge Brut heranwächst. Die Jungen werden nach Verlassen[S. 69] der sonderbaren Kinderstube noch längere Zeit von dem alten Fisch geführt. Bei Gefahr sammeln sie sich vor dem Kopf der Mutter. Diese öffnet das Maul und die Jungen schlüpfen hurtig hinein. Ist die Gefahr vorüber, so gibt die Alte ihre Kinder wieder frei.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen üben bei den Maulbrütern nicht die Männchen, sondern meist die Weibchen die Brutpflege aus.
Das Fortpflanzungsgeschäft der Fische hat so viel Interessantes und Eigenartiges, daß wir auch noch einen Blick auf die absonderliche Brutpflege der Seepferdchen und Seenadeln werfen wollen. Das Männchen dieser sonderbaren Fische besitzt eine Bruttasche, in die das Weibchen den Laich legt. Nach Empfang der Eier wird die Bruttasche wasserdicht geschlossen. Die Eier werden in der Bruttasche befruchtet, betten sich in die Haut ein und werden hier durch eine eiweißhaltige Flüssigkeit, die aus der Haut kommt, ernährt. Wir sehen also bei diesen Fischen eine Einrichtung, die an die Placenta, den Mutterkuchen der Säugetiere, erinnert, der ja bekanntlich den Embryo ernährt. —
So finden wir bereits bei den Fischen die erste Anlage zur Entwicklung des Säugetiers — ein vortrefflicher Hinweis für die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen. Umgekehrt zeigt die Ontogenie der Säugetiere den einstigen Fischahnen. Der Embryo aller Säugetiere erhält auf einer gewissen Stufe seines Wachstums am Halse Kiemenbögen, wie sie nur die Fische haben, die sich später wieder zurückbilden, und die Gliedmaßen sprießen zuerst als flossenartige Plättchen aus dem Körper hervor, um sich dann zu Füßen und Händen umzubilden. Die ehemalige Fischnatur flackerte also noch einmal in der Keimesentwicklung auf.
[S. 70]
Bei den Amphibien findet ähnlich wie bei den Insekten eine Metamorphose statt. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die im Wasser leben und sich erst allmählich zum fertigen Tier umwandeln, indem die Kiemen einschrumpfen, Lungenatmung eintritt und gleichzeitig die äußeren Gliedmaßen am Körper herauswachsen. Auf diese Weise entsteht aus der Kaulquappe der Frosch.
Einige Frösche zeichnen sich durch eine absonderliche Brutpflege aus. Bei dem in Chile lebenden Nasenfrosch (Rhinoderma darwini) bildet die Brust- und Bauchhaut einen weiten Sack, der mit der Mundhöhle in Verbindung steht. In diese Bruttasche steckt das Männchen die vom Weibchen in seiner Gegenwart abgelegten und von ihm befruchteten Eier. Der Frosch lebt monogam, und das Weibchen legt die Eier einzeln oder paarweise innerhalb mehrerer Tage. Auch die Kaulquappen machen die ganze Metamorphose in dem Kehlsack des Vaters durch und werden erst als wohlentwickelte Frösche gewissermaßen aus dem Maule des Vaters geboren. Der Nasenfrosch führt seinen Namen nach dem langen, spitzen Fortsatz seines Maules, der wie eine spitze Nase aussieht. Der sehr kleine, nur 3 cm lange Frosch ist grün, gelb oder auch rotbraun gefärbt mit dunkler Linienzeichnung auf der Oberseite.
Das Männchen der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) wickelt sich den Laich des Weibchens, der in langen Schnüren abgelegt wird, um die Schenkel der Hinterfüße und schleppt die Last mit sich umher, bis die Eier gereift sind. Dann begibt es sich ins Wasser, wo die Krötenlarven auskriechen, um hier ihre 2–3 Jahre währende Umwandlung durchzumachen.
Die amerikanische Wabenkröte oder Pipa (Pipa americana) besitzt im weiblichen Geschlecht auf dem Rücken eine große Anzahl wabenähnlicher Bruttaschen. Bei der Paarung umfaßt das Männchen, wie es bei den Fröschen üblich ist, den Bauch des Weibchens[S. 71] mit den Vorderfüßen. Das Weibchen stülpt seine Kloake weit nach oben heraus; die Eier werden durch den Druck des Männchens herausgepreßt und von dem ausfließenden Sperma befruchtet. Durch den Druck des Männchens werden die Eier über den Rücken des Weibchens gleichmäßig verteilt, so daß in jede Bruttasche ein Ei eingebettet wird. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven bleiben in den Bruttaschen der Mutter, bis sich die Umwandlung zur fertigen Kröte vollzogen hat.
Ein brasilianischer Laubfrosch (Phyllomedusa hypochondrialis) legt seine Eier auf Blättern, die über dem Wasser hängen, ab und klebt dabei mit der Gallerte des Laiches das Blatt zu einer Tüte zusammen, in der die Eier auskommen. Der Schaum, der die Eier umgibt, wird flüssig, und in dieser in der Blattfalte stehenden Flüssigkeit fristen die Larven die erste Zeit ihres Lebens. Allmählich löst sich die Tüte auf, und die Jungen fallen ins Wasser, wo sie ihre Entwicklung vollenden.
Ein anderer Frosch, Arthroleptis seychellensis, der, wie der Name sagt, auf den Seychellen vorkommt, brütet seine Eier in feuchtem Laub aus. Die Larven heften sich mit dem Bauch auf dem Rücken des alten Frosches fest, werden durch dessen Haut ernährt und machen hier ihre Umwandlung durch. —
Im Gegensatz zu den Lurchen entschlüpfen die Reptilien im fertig ausgebildeten Zustande dem Ei. Eine Brutpflege tritt nur bei einigen Krokodilen auf, die die Eier bewachen und die Jungen ins Wasser führen, sowie bei einigen Riesenschlangen, welche ihre Eier ausbrüten. Sonst kümmern sich gerade die Reptilien am wenigsten um ihre Nachkommenschaft.
Die Nilkrokodile vergraben ihre Eier in den Sand in der Nähe des Wassers. Die amerikanischen Arten dagegen errichten regelrechte Brutöfen aus feuchtem Laub und Pflanzenteilen, die sie zu[S. 72] einem Haufen zusammenschichten, in dem die Eier geborgen werden. Das vermodernde Laub erzeugt hohe Wärme, die die Eier zeitigt.
Dieser künstliche Brutofen der Krokodile führt uns zu den Vögeln, unter denen die zu den Hühnervögeln gehörenden australischen Wallnister ebenso verfahren. Auch diese stellen aus Laub und Erde einen großen Haufen her, in dem sie die Eier unterbringen. Sie brüten nicht selbst, sondern die Eier kommen in diesem Brutofen durch die hier sich bildende hohe Temperatur zur Entwicklung. Die jungen Wallnister verlassen in einem sehr entwickelten Zustande das Ei. Sie sind die einzigen Vögel, die mit einem fertigen Federkleid zur Welt kommen und schon im Alter von wenigen Tagen flugfähig sind. Sie müssen sich vom ersten Tage ihres Lebens an allein durch die Welt schlagen, da ihre Eltern sich nicht um sie kümmern. Eine Ausnahme machen nur die Taubenwallnister, bei denen eine kurze Brutpflege stattfindet. Das Männchen bewacht die Brutstätte und deckt sogar bei anhaltend trockner Witterung eine neue Laubschicht darauf, um die zur Gärung notwendige Feuchtigkeit darin zu erhalten. In der ersten Zeit bringt es auch die Jungen abends wieder in dem Brutofen unter zum Schutz gegen die Kälte der Nacht. Doch schon nach wenigen Tagen überläßt der Vater seine Kinder ihrem eigenen Schicksal.
Die Nistweise der Wallnister ist offenbar die ursprüngliche Art der Fortpflanzung der Vögel, aus der sich erst im Laufe der Zeit Nestbau und Brutgeschäft entwickelt haben. So treten hier innige Beziehungen zwischen den Vögeln und den Reptilien hervor, die beide auch in bezug auf den Bau ihres Körpers manche Gleichheiten und Ähnlichkeiten zeigen, die darauf hinweisen, daß die Vögel sich aus den Reptilien entwickelt haben. Die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt der Urvogel Archäopteryx aus der Kreidezeit,[S. 73] der, wie wir gesehen haben, den Übergang vom Reptil zum Vogel bildet.
Bei den Vögeln bieten Liebesleben und Fortpflanzung so viel Interessantes, daß es unmöglich ist, all die vielseitigen Erscheinungen erschöpfend zu schildern. Das Liebeswerben der Männchen erfolgt in verschiedenster Art. Die Singvögel lassen in der Brunst ihre Stimme zur vollsten Entfaltung gelangen. Der Schlag der Nachtigall in lauer Maiennacht mit den tiefen, so zu Herzen dringenden Flötentönen ist ihr Liebeslied. Andere Vögel, wie die Raubvögel, machen ihrem Weibchen durch prachtvolle Flugspiele den Hof, wieder andere führen liebestrunkene Tänze aus, wie es der Birkhahn tut, der sich mit gefächertem Spiel im Kreis herumdreht und hohe Luftsprünge macht, um sich den liebesbedürftigen Hennen bemerkbar zu machen. Die Paradiesvögel entfalten in der Balz ihre prachtvollen, buntfarbigen Schmuckfedern zu einem wallenden Schleier. Der verliebte Pfau schlägt mit seinen verlängerten, farbenprächtigen Rückenfedern ein Rad.
Bei den Vögeln sind die Männchen vor den Weibchen besonders von der Natur ausgezeichnet worden. Sie allein besitzen ein buntfarbiges Hochzeitskleid, während das weibliche Geschlecht mit wenigen Ausnahmen ein unscheinbares Gewand trägt, das das Tier beim Brutgeschäft und bei der Führung der Kinderschar vor den Nachstellungen der Feinde schützt.
Eine Ausnahme machen die in Südeuropa und Asien heimischen Laufhühnchen, kleine etwa stargroße Hühner. Bei ihnen ist das Männchen schlicht erdfarben gezeichnet, während das Weibchen mit einem buntfarbigen Brustschild geschmückt ist. Mit diesem eigentümlichen Geschlechtsdimorphismus steht auch das Liebesleben, das geradezu pervers verläuft, im Einklang. Nicht die Männchen, sondern die buntfarbigen Weibchen balzen und fordern[S. 74] ihre unscheinbar gekleideten Liebhaber zur Paarung auf. Nicht das Weibchen, sondern das Männchen baut das Nest und brütet die vom Weibchen hineingelegten Eier aus, das sich um seine Nachkommenschaft überhaupt nicht kümmert. Unter Führung des Vaters wachsen die Jungen heran. Bei den Laufhühnchen sind also die Rollen im Fortpflanzungsgeschäft vertauscht. Die Männchen übernehmen alle Pflichten der Weibchen, die sich völlig emanzipiert haben und die Rolle des männlichen Geschlechts spielen. —
Ein sonderbarer Gesell in Sachen der Liebe ist auch unser Kreuzschnabel, eine der charakteristischsten Erscheinungen unserer Nadelwälder. Dieser Zigeunervogel, der keine feste Wohnstätte kennt, sondern im Lande umherschweift, tritt bald hier, bald da in kleineren oder größeren Trupps auf. So unstet wie sein Leben, sind auch seine Liebesgelüste. Während alle anderen Vögel bei uns im Frühjahr und Sommer zur Fortpflanzung schreiten, hält er sich an keine bestimmte Jahreszeit. Er brütet ebensogut wie im Sommer auch im Herbst und Winter. Tragen die Nadelhölzer reiche Zapfen, dann erwacht in dem bunten Schelm die Sehnsucht der Liebe. Vom schneebedeckten Tannenzweig singt er fröhlich sein bescheidenes Lied der Liebsten ins Herz, baut sein Nest in rauhreifumsponnenen Zweigen und brütet in der Winterkälte sein Gelege aus. Während alle anderen Vögel in Schnee und Eis darben, zieht er sorglos seine Kinderschar auf, denn der reiche Samen der Nadelhölzer deckt ihm den Tisch.
Eine besondere Eigentümlichkeit des Kreuzschnabels ist der Farbenwechsel seines Gefieders. Nach dem Ablegen des grauen, dunkel gefleckten Jugendkleides erhält das Männchen zunächst ein gelbes oder auch grünes Gefieder, das im zweiten Jahre mit einem roten Federkleid vertauscht wird und im Alter an Schönheit und Reinheit der Farbe immer mehr zunimmt.
[S. 75]
Die Zeit der Liebe ist in der Tierwelt keineswegs immer an den Wonnemonat Mai oder den Sommer gebunden. Im Herbst, wenn die Natur abstirbt, der Laubwald sich gelb und rot färbt, dann erwacht im König unserer Wälder, dem edlen Hirsch, die Macht der Liebe. Mit orgelndem Schrei durchzieht der Brunfthirsch den Wald und treibt sich sein Rudel Wild zusammen, um ein Haremsleben zu führen. Aber nicht in Ruhe kann er die Freuden der Liebe genießen. Geringe Hirsche begleiten ständig den alten Pascha und seinen Harem in der Hoffnung, daß ein günstiger Augenblick auch ihnen einen kurzen Liebesrausch gewährt. Ständig umkreist der Platzhirsch sein Rudel und vertreibt mit dröhnendem Schrei die Beihirsche, die seine Schönen zu verführen drohen und sich gewandt den ernsten Angriffen des Starken zu entziehen wissen.
Eines Morgens schallt aus der Ferne der Brunftschrei eines Rivalen herüber. Der Platzhirsch antwortet mit kräftiger Stimme — eine Warnung für den Nebenbuhler. Doch dieser fühlt sich ebenbürtig. Näher und näher dringt sein Kampfruf herüber. Der Platzhirsch zieht ihm laut schreiend entgegen. Gesenkten Hauptes stehen sich die Recken gegenüber, dann ein lautes Krachen der Geweihe, und es beginnt ein heißer Kampf auf Leben und Tod. Mit fest ineinandergelegten Geweihen sucht jeder den anderen zu Fall zu bringen. Der Kampf wogt hin und her. Da gelingt es dem einen Kämpen, seine starke Augsprosse in die Weichen des Gegners zu bohren. Der Platzhirsch, der rechtmäßige Inhaber des Rudels, bricht zusammen. Er ist von seinem Gegner abgekämpft und zu Tode geforkelt. Noch ein lauter, weithin schallender Siegesschrei, und der Gegner trollt zu dem Mutterwild, um sogleich die Herrschaft zu übernehmen. Die Tiere, wie der Weidmann das weibliche Wild nennt, haben dem Kampf teilnahmlos zugesehen und erkennen ohne weiteres das Recht des Stärkeren an. Sie folgen unbewußt[S. 76] einem Naturgesetz, das durch die Auslese im Kampf ums Dasein dem Stärkeren das Vorrecht gibt, ein hartes und rücksichtsloses Geschick, aber doch ein sehr zweckmäßiges Mittel, um die Art in ihrer Kraft und Ursprünglichkeit zu erhalten und sie vor Degeneration zu bewahren. Darum gilt es als weidmännisches Gesetz, die stärksten Hirsche und stärksten Rehböcke niemals frühzeitig im Jahre abzuschießen, sondern bis zur Brunft leben zu lassen. Nur hierdurch ist eine gute Geweih- und Gehörnbildung gewährleistet. Leider wird gegen diese Regel noch immer sehr gesündigt, wozu der Jagdneid und die Furcht, daß die gute Trophäe von einem anderen Schützen erbeutet werden könnte, meist die Veranlassung geben.
Nicht immer wird von den Hirschen ein Kampf auf Leben und Tod ausgefochten. Dies gehört sogar zu den Ausnahmen, da meist der Schwächere beizeiten freiwillig das Feld räumt.
In der Brunft des Rothirsches liegt eine tiefe Poesie des deutschen Waldes. Die Jagd auf den Brunfthirsch ist die Krone edlen Weidwerks, und nicht mit Unrecht bilden der schreiende Hirsch und sein Kampf mit dem Rivalen das bevorzugte Motiv für den Jagdmaler. Wer den Zauber der hohen Jagd kennt, der weiß die herrlichen Gemälde, die die Künstlerhand eines Kröner, Deiker, Friese, Drathmann oder Wagner schuf, in ihrer Größe und Gewalt zu würdigen.
Noch später als beim Rotwild erwacht die Liebe in dem ritterlichen Schwarzwild, das erst im Winter in die Rauschzeit eintritt. Auch unter den stärkeren Keilern wird bisweilen ein Liebesduell ausgefochten. Doch vermögen sich die Tiere mit ihren „Gewehren“ oder „Gewaff“, wie der Jäger die Hauer des Wildschweins nennt, keinen besonderen Schaden zuzufügen, da die dicke, mit Borsten bekleidete Schwarte einen vorzüglichen Schutz bildet.
[S. 77]
Im Gegensatz zum Rot- und Schwarzwild brunftet das Reh schon im Sommer. Das Kitz wird im Mai gesetzt. Die Tragzeit beträgt 9–10 Monate. Das ist für ein so kleines Tier im Vergleich zu anderen Säugetieren eine auffallend lange Zeit. Infolgedessen glaubte man früher, daß die Brunft im Juli und August nur eine Scheinbrunft sei, ein Vorspiel der Liebe ohne ernstliche Folgen, und daß die Befruchtung erst später im November erfolge, da dann die Böcke bisweilen die Ricken wieder treiben.
Diese Auffassung beruht jedoch auf einem Irrtum. Durch anatomische Untersuchung wurde nachgewiesen, daß die Befruchtung bereits im Sommer stattfindet, und daß die Nachbrunft im Winter nur ein aufflackerndes Liebesspiel einiger Böcke ist, bei dem kein Beschlag erfolgt. Das im Sommer befruchtete Ei macht zunächst nur den ersten Furchungsprozeß durch, wandert dann in den Uterus und ruht hier lange Zeit ohne weitere Entwicklung, die erst im Dezember einsetzt und dann in der normalen Weise verläuft. Dieser eigenartige Vorgang in der Fortpflanzungsgeschichte des Rehes ist eine vorzügliche Anpassung an die klimatischen Verhältnisse. Im Sommer, wo bei reicher Äsung Bock und Ricke auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Kraft stehen, erfolgt die Paarung, und das Kitz wird erst zu Beginn des nächsten Sommers gesetzt, wo das frische Grün der säugenden Ricke wieder kräftige Nahrung spendet.
Ähnlich verhält es sich mit der Fortpflanzung der Fledermäuse. Die Paarung findet im Herbst vor Beginn des Winterschlafes statt. Der Same des Männchens ruht in der Gebärmutter des Weibchens während des Winters und befruchtet erst im Frühjahr die am Eierstock sich bildenden Eier. Im Mai und Juni werden die Jungen geboren, also in einer für ihre Entwicklung sehr günstigen Jahreszeit. Während des Gebäraktes hängt sich die Mutter[S. 78] nicht wie bei der üblichen Ruhestellung mit den Hinterfüßen auf, sondern mit den Händen, so daß also nicht der Kopf, sondern der Leib nach unten gerichtet ist. Dann krümmt sie den Schwanz nach oben, so daß das Ende der Flughaut einen Sack bildet, in den das Junge hineinfällt. Einige Arten legen während der Geburt den Schwanz auf den Rücken, so daß sich keine Geburtstasche bilden kann. Sie haben am Ausgang der Schamteile zwei Drüsen, an die sich das Junge noch während der Geburt ansaugt, um nicht herabzufallen. Später kriechen die Jungen von den Drüsen oder aus der Geburtstasche zur Brust der Alten herauf und saugen sich an den Zitzen fest. Sie verharren aber nicht dauernd in dieser Stellung, sondern haken sich auch mit den Krallen im Pelz der Mutter ein, die sie ständig mit sich umherträgt.
Das zoologisch interessanteste Gebiet der ganzen Erde ist Australien. Mit Ausnahme eines Wildhundes, des Dingos, einiger Fledermäuse und Ratten stehen alle Säugetiere Australiens noch auf einer primitiven Stufe der Entwicklung, die in der Art der Fortpflanzung zum Ausdruck kommt und sie von allen anderen Säugetieren scharf trennt.
Im Jahre 1884 machte der Jenenser Zoologe Wilhelm Haacke während seines Aufenthalts in Australien eine aufsehenerregende Entdeckung. Er zog aus der Hautfalte am Leibe eines Ameisenigels (Abbildung 3) ein Ei hervor. Ein eierlegendes Säugetier! Wohl hatte man schon in früherer Zeit die Behauptung aufgestellt, daß die Schnabeltiere, zu denen der Ameisenigel gehört, Eier legen. Aber die Nachricht klang doch zu märchenhaft, um ernst genommen zu werden, bis es schließlich Haacke gelang, ihre Wahrheit nachzuweisen.
Die Schnabeltiere tragen einen Hornüberzug über die Kiefer, die hierdurch wie beim Vogel zu einem Schnabel werden. Bei[S. 79] den aus mehreren Arten bestehenden Ameisenigeln ist der zahnlose Schnabel lang und dünn, beim eigentlichen Schnabeltier dagegen flach und breit wie ein Entenschnabel (Abbildung 4). Letzteres ist ein ausgesprochenes Wassertier, das nach Art der Enten mit dem breiten Schnabel auf dem Grunde des Wassers seine aus Insekten und Würmern bestehende Nahrung aufschnabelt. Das Schnabeltier ist ein vortrefflicher Schwimmer, da seine Zehen mit Schwimmhäuten ausgerüstet sind. Es baut sich unterirdische Wohnungen am Ufer, in denen es den Tag schlafend verbringt.
Im Gegensatz zum Schnabeltier sind die Ameisenigel Landtiere. Ihre Hauptnahrung bilden Ameisen, die sie mit ihrer langen Zunge aus Ameisenhaufen herausholen. Der Rücken des Ameisenigels ist mit Stacheln bedeckt, während das Schnabeltier einen dunkelbraunen Pelz trägt.
Das eigenartige Fortpflanzungsgeschäft dieser absonderlichen Tierformen verläuft in folgender Weise. Das Weibchen legt ein oder auch zwei Eier und schiebt sie mit dem Schnabel in die am Leibe befindliche Bruttasche. Die Schale des Eies ist lederartig wie die Schale der Reptilieneier. Im Brutbeutel nimmt das Ei mit der Entwicklung des Keimlings ganz beträchtlich an Größe zu, indem es sich ausdehnt. Während die Länge eines dem Uterus entnommenen Eies im Durchmesser nur 4,5 mm beträgt, hat das reife Beutelei eine Länge von 15 mm. Dieses Wachstum des Eies steht also ganz im Gegensatz zum Vogelei, das seine Größe nicht verändert, und entspricht dem Vorgang des Säugetiereies und Embryos im Mutterleibe, nur daß die Entwicklung sich nicht im Uterus, sondern außerhalb des Körpers vollzieht. Es ist daher möglich, daß eine Ernährung des Eies im Beutel durch Drüsenausscheidung aus dem Körper der Mutter stattfindet, indem das Sekret durch die weiche Schale aufgesogen wird.
[S. 80]
Das gänzlich hilflose, embryonenhafte Junge, das beim Ameisenigel nur eine Körperlänge von 5,5 mm hat, macht seine weitere Entwicklung im Beutel durch, den es erst verläßt, wenn es behaart ist und die Stacheln durchbrechen. Es wird dann von der Mutter in einer Erdhöhle untergebracht und nur zum Nähren wieder in den Beutel genommen.
Der alte Ameisenigel hat kein Gesäuge, sondern es wird ein Sekret aus Drüsen abgesondert, das von dem Jungen im Beutel aufgeleckt wird. So sehen wir beim Ameisenigel und Schnabeltier die ersten Anfänge des Säugetiers, aus denen sich erst später das vollkommene Säugetier, das lebendige Junge zur Welt bringt und diese säugt, entwickelt hat.
Auch sonst zeigt der Körperbau der Schnabeltiere noch manche Eigenarten, die im Vergleich zu anderen Säugetieren eine viel primitivere Entwicklung erkennen lassen. Ebenso, wie bei den Reptilien und Vögeln, münden Darm, Harnleiter und Fortpflanzungsorgane in einem einheitlichen Ausgang, der Kloake. Man bezeichnet daher Ameisenigel und Schnabeltier als „Kloakentiere“. Von den Eierstöcken des Weibchens bringt nur der linke reife Eier hervor, während der rechte zwar Eier bildet, die aber niemals zur Entwicklung gelangen. Die Tätigkeit des weiblichen Geschlechtsapparats ist also ganz auf die linke Hälfte beschränkt. Hierin tritt eine nahe Beziehung zu den Vögeln hervor, deren Weibchen nur einen Eierstock auf der linken Seite haben. Bei den männlichen Kloakentieren liegen die Hoden nicht außen, sondern im Innern der Leibeshöhle, was durchaus dem Geschlechtsapparat der männlichen Vögel und Reptilien entspricht. Das an der hinteren Kloakenwand liegende Zeugungsglied dient lediglich der Samenentleerung, aber nicht wie bei anderen Säugetieren der gleichzeitigen Urinentleerung. Dasselbe ist auch[S. 81] bei jenen Vögeln der Fall, welche, wie Strauße und Enten, einen Penis besitzen.


Das Gehirn der Kloakentiere unterscheidet sich wesentlich von dem Gehirn aller anderen Säuger und zeigt nahe Beziehungen zum Reptiliengehirn.
Die übrigen Säugetiere Australiens haben im Vergleich zu den Schnabeltieren schon eine höhere Entwicklungsstufe erreicht, die aber noch immer gering ist gegenüber allen anderen Säugetieren. Wohl gibt es in Australien die verschiedenartigsten Formen von Säugetieren, die unverkennbar den Charakter des Raubtiers, Nagetiers, Insekten- und Pflanzenfressers tragen, aber dennoch durch eine weite Kluft von diesen getrennt sind. Ihre Jungen kommen in einem ganz unentwickelten, völlig embryonenhaften Zustande zur Welt und werden wie bei den Kloakentieren noch längere Zeit in einem Brutbeutel getragen, in dem sie erst heranreifen. In dem Brutbeutel saugt sich das winzig kleine Junge, das beim Riesenkänguruh nur wenige Zentimeter lang ist, an die Zitze der Mutter fest. Die Mundränder des Jungen verwachsen um die Zitze, welche anschwillt und das ganze Maul des Jungen ausfüllt. Das Junge hängt dann dauernd fest an der Zitze. Um eine ausreichende Atmung zu ermöglichen, schiebt sich der Kehlkopf des Jungen in die innere Nasenöffnung hinein. Diese besonderen Vorrichtungen am Maul und an den Atmungsorganen verlieren sich später, wenn sie infolge des vorgeschrittenen Wachstums des Jungen nicht mehr erforderlich sind. Man kann also geradezu von einem „Larvenstadium“ bei den Beuteltieren sprechen, das der Larvenform der Amphibien und niederen Tiere ähnlich ist. Die Jungen verlassen den Beutel erst, wenn sie völlig entwickelt sind, was beim Riesenkänguruh etwa 8 Monate dauert, kehren aber zum Saugen noch einige Zeit lang regelmäßig wieder[S. 82] in den Beutel zurück. Das junge Beuteltier wird gewissermaßen zweimal geboren, das erstemal, wenn es dem Mutterleibe entsteigt, und das zweitemal, wenn es den Brutbeutel verläßt.
Das bekannteste Beuteltier ist das Känguruh, und jeder aufmerksame Besucher eines Zoologischen Gartens hat wohl schon einmal die Freude gehabt, ein junges Känguruh aus dem Beutel der umherspringenden Mutter herausschauen zu sehen. Außerdem gibt es Beutelwölfe, Beutelmarder, Beuteldachse, Beutelratten, Beutelspitzmäuse, Beuteleichhörnchen und Flugbeutler (Abbildung 5). Wir sehen also, daß ein großer Teil der Säugetiere in Australien in Form des Beuteltiers vorkommt, d. h. in einer ursprünglicheren Gestalt, in einer primitiveren Stufe der Entwicklung. Daß tatsächlich eine gewisse Beziehung zwischen den Beuteltieren Australiens und den entsprechenden Tierformen anderer Erdteile besteht, beweist die Feststellung des Gelehrten Hans Friedenthal, daß der Bau der Haare beider Tierformen der gleiche ist. Eine Beutelspitzmaus hat Spitzmaushaar, und der Beutelmaulwurf trägt Maulwurfsfell. Wohl nicht mit Unrecht hat man daher angenommen, daß die Säugetierwelt Australiens mit ihren eierlegenden Arten und mit den Beuteltieren in dem abgeschlossenen Erdteil auf einer früheren Entwicklungsstufe stehengeblieben ist. Australien ist das Land der „lebenden Fossilien“.
Die einzigen Tiere, die als vollwertige Säuger aus der Reihe der Beuteltiere heraustreten, sind der Dingo, einige Fledermäuse und Ratten. Der Dingo ist zugleich die einzige in der Wildnis vorkommende Hunderasse. Er ist nicht wie Wolf, Schakal oder Fuchs ein naher Verwandter des Hundes, sondern ein echter Hund. Seine Farbe ist rot oder rot mit Schwarz und Weiß gemischt. Der Schwanz ist buschig und hat eine helle Spitze. Ob der Dingo wirklich ein ursprünglicher Wildhund ist, oder ob er, was wahrscheinlicher[S. 83] ist, vom Haushund abstammt, der erst vom Menschen nach Australien verpflanzt wurde und verwilderte, ist heute eine noch ungeklärte Frage. Den Aufschluß hierüber kann uns allein die Paläontologie geben. Freilich glaubt Frederick McCoy in der mittleren Tertiärschicht Australiens Reste des Dingo nachweisen zu können — eine Annahme, die freilich noch der Bestätigung bedarf. Erweist sie sich als richtig, dann ist der Dingo als Wildhund zu betrachten, denn daß er in der Tertiärzeit schon vom Menschen eingeführt sein sollte, ist kaum glaubhaft, zumal der tertiäre Mensch noch nicht nachgewiesen ist und, falls er gelebt hat, wohl noch keine Haustiere besessen hat.
Neben dem Dingo leben in Australien noch einige Fledermäuse und Ratten, die nicht Beuteltiere sind. Letztere sind jedenfalls erst später durch Schiffe eingeschleppt worden, und die Fledermäuse können infolge ihres Flugvermögens sich unschwer verbreiten. Ratten und Fledermäuse sind offenbar keine Schöpfungen der australischen Tierwelt, sondern erst später hierher gelangt.
[S. 84]
Die Organe der Tiere, auch die äußeren Gliedmaßen, sind zum Teil sehr sinnreich konstruierte Apparate, die sich mit wissenschaftlichen Instrumenten, wie sie in der Physik und Technik gebraucht werden, vergleichen lassen, so daß man geradezu von einer Biotechnik, einer Technik des Lebens, im Tierreich reden kann. —
Der Fisch führt im Wasser die verschiedensten Bewegungen aus. Er vermag mit und gegen die Strömung zu schwimmen, steigt in vertikaler Richtung ohne Flossenschlag auf und nieder, senkt sich auf den Boden herab, bleibt in jeder beliebigen Tiefe unbeweglich stehen, oder stellt sich sogar mit dem Kopf gegen den Strom, ohne von ihm fortgerissen zu werden. Eine derartige Anpassung an das Leben im Wasser verlangt eine ganz besondere Ausrüstung des Körpers.
Ein wichtiges Organ für die Schwimmkunst der Fische ist die Schwimmblase, die eine vielseitige Bedeutung hat. Die Schwimmblase liegt unterhalb der Wirbelsäule unter den Nieren. Sie stellt entweder einen länglichen Sack dar oder ist durch Abschnürungen in zwei oder drei Kammern geteilt. Durch einen besonderen Gang steht sie meist mit dem Schlunde in Verbindung, kann aber auch ganz in sich abgeschlossen sein. Sie ist mit einem Gas gefüllt, das aus Sauerstoff (15%), Stickstoff (83%) und Kohlensäure (2%) besteht. Bei Tiefseefischen ist der Sauerstoffgehalt höher und beträgt bis 70%. Die Zusammensetzung des Gases ist also von der Beschaffenheit der Luft verschieden, und infolgedessen[S. 85] kann die Füllung der Schwimmblase, auch wenn diese mit dem Rachen verbunden ist, nicht durch die Außenluft erfolgen. Der in den Rachen führende Luftgang dient nur der Ausscheidung überflüssigen Gases. Fehlt diese Rachenverbindung, so werden die Gase durch ein besonderes Organ resorbiert, durch das „Oval“. Das Oval ist ein Knäuel von Blutgefäßen, die das Gas aufsaugen und in das Blut überführen. Die Blutgefäße können durch eine Muskelvorrichtung willkürlich geöffnet und geschlossen werden, je nachdem ihre Tätigkeit aufgenommen oder unterbrochen werden soll.
Die Gasfüllung der Schwimmblase geschieht durch zahlreiche Blutgefäße, „rote Körper“ genannt, welche vermittels besonderer Drüsen das aus dem Blut ausgeschiedene Gas hineinströmen lassen.
Die Schwimmblase dient zunächst zur vertikalen Bewegung. Durch ihre wechselnde Füllung wird das spezifische Gewicht des Körpers verändert, so daß der Fisch ohne Schwimmbewegungen im Wasser aufsteigen und sich senken kann.
Die Abschnürung der Schwimmblase in mehrere Abteilungen befähigt den Fisch, die Stellung des Körpers im Wasser beliebig zu ändern. Durch eine verschiedene Gasfüllung der Kammern wird der Schwerpunkt des Körpers verlegt, wodurch der vordere Teil, das Kopfende, gehoben oder gesenkt wird. Der Körper steht dann nicht horizontal, sondern schräg aufwärts oder abwärts.
Bei einigen Fischen ist die Schwimmblase mit dem innern Ohr durch eine Knorpelmasse verbunden, die in einer am Labyrinth des Ohrs anliegenden Membran endigt. Hierdurch wird der wechselnde Wasserdruck, welchen die Spannung der Schwimmblase anzeigt, auf das Ohr übertragen. Der Apparat wirkt gewissermaßen wie ein Barometer. Auch bei Fischen, denen diese Vorrichtung[S. 86] fehlt, findet eine Übermittlung des Wasserdrucks auf das Ohr statt, indem sich der Druck des Schwimmblasenumfangs unmittelbar auf das Labyrinth fortpflanzt.
Die Schwimmblase dient ferner zur Unterstützung der Atmung, die beim Fisch durch die Kiemen erfolgt. Sie setzt den Fisch instand, eine gewisse Zeit außerhalb des Wassers durch eine Zufuhr von Sauerstoff fortzuleben und schützt ihn vor einem raschen Erstickungstode, der erst eintritt, wenn der Sauerstoffgehalt der Schwimmblase aufgebraucht ist, was bei manchen Arten ziemlich lange dauert. Auf diese Weise verträgt der Karpfen oder Hecht, der von der Köchin vom Markt in einem Netz nach Hause getragen wird, den trockenen Transport ohne Schaden.
Die respiratorische Bedeutung der Schwimmblase erreicht ihren höchsten Grad bei den Lurchfischen. Hier ist die Schwimmblase zur Lunge umgewandelt, die mit den im hinteren Rachen mündenden Nasenöffnungen verbunden ist und das Tier zur Luftatmung auf dem Lande befähigt. Die australischen Lurchfische haben also eine Doppelatmung, eine Atmung durch Kiemen im Wasser und eine zweite durch Lungen auf dem Lande. Sie sind hierdurch imstande, die Zeit der Dürre, in der die Gewässer austrocknen, lebensfähig zu überstehen.
Vielen Tiefseefischen, ferner den Haifischen, Plattfischen, Makrelen und einigen anderen Arten fehlt die Schwimmblase. Andere Arten, wie Kofferfische und Igelfische, die ebenfalls keine Schwimmblase haben, benutzen ihren Magen als hydrostatischen Apparat, indem sie ihn mit Luft anfüllen. Die im Magen aufgespeicherte Luft schützt diese Fische auf dem Trockenen vor dem Erstickungstode, da der notwendige Sauerstoff durch den Darm zugeführt wird, so daß man geradezu von einer Darmatmung sprechen kann.
Die Natur hat die Fische mit einem besonderen Hautsinnesorgan[S. 87] ausgestattet, das man als „sechsten“ Sinn bezeichnen kann. Am Kopf und an den Seiten des Körpers befinden sich röhrenartige Linien, die durch die Schuppen Verästelungen nach außen senden. Diese „Seitenorgane“ sind Sinnesorgane, mit denen der Fisch die Richtung und die Stärke der Wasserströmung in feinster Weise wahrnimmt. Nähert sich der Fisch einem Stein, einem Wehr oder irgendeinem Gegenstand im Wasser, so prallt das vom schwimmenden Fisch bewegte Wasser an dem in der Nähe befindlichen Hindernis ab und flutet zurück. Diese Rückwärtsbewegung des Wassers, auch wenn sie noch so gering und fein ist, übt auf die Seitenorgane einen Druck aus, der vom Fisch sofort wahrgenommen wird. Die Seitenorgane dienen also der Orientierung beim Schwimmen und sind biologisch von allergrößter Bedeutung. Mit ihrer Hilfe kann der Fisch, wenn im trüben Wasser und im Dunkel der Nacht das Augenlicht versagt, sich sicher und gefahrlos bewegen.
Die Fische besitzen mit Ausnahme der Haie keine äußeren Ohröffnungen. Man nimmt daher an, daß sie taub sind. Nur sehr starke Schallwellen, wie sie die Detonation von Sprengstoffen erzeugt, werden wahrgenommen, aber nicht durch Hören, sondern durch Empfinden des in das Wasser gelangten Drucks der Schallwellen, der an die Seitenorgane und das Ohrlabyrinth dringt.
Eine Ausnahme scheinen die Welse und ein Süßwasserfisch Amerikas, der Killifisch, zu machen. Durch Versuche wurde nachgewiesen, daß sie auf durchdringende Geräusche, wie schrille Pfiffe, reagierten. Es bleibt aber fraglich, ob es sich tatsächlich um ein Hören handelt, oder ob auch hier vielleicht die Seitenorgane im Spiele sind, die den im Wasser sich fortpflanzenden Druck der Schallwellen übermitteln.
[S. 88]
Einige Fischarten sind imstande, mit der Schwimmblase, durch Reibung von Knochenteilen, oder durch Einpressen von Luft in der Mundhöhle und den Kiemen Geräusche hervorzubringen, wie z. B. der Igelfisch, der Killifisch und der knurrende Gurami. Da besonders die Männchen in der Fortpflanzungszeit sich hören lassen, so darf man vermuten, daß ihre Liebestöne den Zweck haben, die Weibchen anzulocken. Diese müssen also die Laute vernehmen, ob mit dem Gehör oder wieder durch Empfindung des Drucks der Schallwellen, bleibt freilich dahingestellt. Genaue Untersuchungen darüber fehlen einstweilen noch.
Die wahre Bedeutung des Fischohres liegt nicht im Hören, sondern in andern Funktionen. Wie schon gesagt wurde, steht bei vielen Fischen die innere Ohröffnung mit der Schwimmblase in Verbindung und nimmt ihre von der Wassertiefe abhängige Spannung wahr. Das Ohr ist ferner der Sitz eines besonderen Gleichgewichtssinnes. Im Ohr liegen halbkreisförmige Kanäle, die eine Flüssigkeit, die Endolymphe, enthalten. Der Sinn für das Gleichgewicht wird durch die Bewegung dieser Flüssigkeit, die je nach der Körperlage wechselt, ausgelöst. Zerstört man die Kanäle, so ist der Fisch nicht mehr fähig, sich im Gleichgewicht zu halten, er führt schraubenförmige Bewegungen aus und schwimmt auf dem Rücken.
Das Ohr unterrichtet schließlich den Fisch über die Geschwindigkeit des Schwimmens. Drei Gehörsteine, Otolithen genannt, werden bei den Bewegungen des Fisches aus ihrer Lage gebracht und drücken auf das Labyrinth. Die Stärke und Art des Drucks zeigt dem Fisch die Geschwindigkeit des Schwimmens an.
Die meisten Fische haben einen spindelförmigen Körper, der sich mit einem Torpedo vergleichen läßt, dessen Bauart der bestmöglichen Wasserverdrängung gerecht wird. Kopf und Schwanz[S. 89] sind mit dem Rumpf fest verbunden. Die Vorwärtsbewegung beim Schwimmen wird allein durch die Schwanzflosse verursacht, die seitwärts ausschlägt und wie ein Propeller wirkt. Rücken- und Afterflosse dienen als Kiel. Sie halten den Körper in gleichmäßiger Lage und Richtung. Wird letztere geändert, so werden Rücken- und Afterflosse angezogen, um die Wendung zu erleichtern, und erst wieder entfaltet, wenn der Kurs geradeaus geht. Die paarweise angeordneten Brust- und Bauchflossen dienen nicht als Ruder, sondern als Höhen- und Seitensteuer sowie zum Balancieren des Körpers.
Fische, deren Leib vom Torpedotyp abweicht, führen andere Schwimmbewegungen aus. Der wurmartige Aal schlängelt beim Schwimmen den Leib, die Schollen und andere Plattfische bewegen den flachen Körper wellenförmig. Die Rochen gebrauchen ihre lappenartig verbreiterten Brustflossen als Flügel. Wie der Vogel mit den Flügeln, so führen sie mit den Brustflossen wellenförmige Schläge von unten nach oben aus. Sie fliegen gewissermaßen im Wasser.
Im Gegensatz zu den Schollen und Rochen, die mit ihrem platten Körper wagerecht schwimmen, gibt es auch Fische, die mit einem flachen, scheibenförmigen Körper senkrecht im Wasser stehen. So hat der im Amazonenstrom heimische Blattfisch (Pterophyllum scalare) einen platt zusammengedrückten, blattartigen Körper. Die Schwanzflosse ist groß und breit, und die Rücken- und Afterflosse sind zu gewaltigen Segeln geworden. Der Fisch, der mit seiner grotesken Körperform kein guter Schwimmer sein kann, hält sich im Pflanzendickicht in möglichst ruhigem Wasser auf.
Der wundersamste Gesell unter den Fischen ist der Mondfisch (Orthagoriscus mola), der im Mittelmeer und im Atlantischen Ozean lebt. Sein platter, vertikal stehender Körper sieht aus wie[S. 90] die Mondscheibe. After- und Rückenflosse sind gleich groß und stehen sich oben und unten gegenüber. Der Fisch hat sonderbarerweise keinen Schwanz und ruft daher den Eindruck eines schwimmenden Fischkopfes hervor. Er wird infolgedessen auch „Schwimmender Kopf“ genannt (Abbildung 6).
Die Seepferdchen, die infolge ihrer höchst sonderbaren Gestalt alles Fischartige verloren haben, aber dennoch zu den Fischen zählen, schwimmen vermittels der sehr kräftig entwickelten Rückenflosse, die sehr schnelle, zitternde Bewegungen ausführt, welche sich von vorn nach hinten fortpflanzen. Hierdurch werden die benachbarten Wasserteile nach rückwärts verdrängt, und durch ihren Widerstand wird der Fischkörper vorwärts geschoben. Beim Schwimmen nach rückwärts geht die Bewegung der Flossenstrahlen in umgekehrter Weise vor sich. Der Schwanz dient beim Schwimmen als Steuer. Er ist außerdem ein Greiforgan, mit dem der Knochenfisch sich an Gegenständen, wie Tang und Pflanzenstengeln, anzuklammern vermag, wie man es in den Aquarien der Zoologischen Gärten jederzeit beobachten kann. Die Seepferdchen, die keiner Schausammlung eines Aquariums fehlen, üben wegen ihres eigenartigen Wesens und ihres sonderbaren Aussehens stets eine besonders große Anziehungskraft auf die Besucher aus. —
Unter den Säugetieren finden wir die Anpassung an das Wasserleben in der höchsten Vollkommenheit bei den Walfischen, die einen fischartigen Körper besitzen, der mit Flossen ausgerüstet ist. Die Vorwärtsbewegung erfolgt wie bei den Fischen durch die Schwanzflosse. Auf dieselbe Weise schwimmen auch die Robben mit ihren zum Gehen untauglichen hinteren Gliedmaßen, die zu Flossen geworden sind. Sie liegen in der Verlängerung der Längsachse des Körpers nach hinten gestreckt. Die[S. 91] Triebkraft erfolgt durch seitliches Zusammenschlagen ihrer senkrecht stehenden Flächen.
Bei den Fischen, Walfischen und Robben, die mit der Schwanzflosse oder den hinteren Gliedmaßen schwimmen, läßt sich die Art der Vorwärtsbewegung mit einem Schraubendampfer vergleichen, der durch die am hinteren Ende des Schiffsrumpfes liegende Schraube getrieben wird.
Andere Wassertiere, wie Biber und Fischotter, schwimmen mit den Füßen, deren Zehen durch Schwimmhäute verbunden sind und als Ruder benutzt werden. Hier kommt das Prinzip des Auslegerbootes zur Geltung.
Unter den Vögeln sind die im südlichen Eismeer heimischen Pinguine die besten Schwimmer. Ihre Flügel sind flossenartig umgebildet, tragen anstatt Federn hornartige Plättchen und werden sowohl beim Schwimmen an der Oberfläche des Wassers wie beim Tauchen als Ruder benutzt. Die nach hinten gestreckten Füße dienen zum Steuern (Abbildung 7).
Alle übrigen Schwimmvögel, wie Gänse, Schwäne, Enten, Kormorane und Taucher, rudern stets mit den Füßen, die durch ihre Schwimmhäute breite Flächen haben. Einige Arten, wie Säger und Lummen, benutzen beim Tauchen und Schwimmen unter Wasser die Flügel als Ruder.
Die Wale, die wie die Fische ganz an ein Wasserleben gebunden sind, haben die Fähigkeit, sehr lange unter Wasser bleiben zu können, ohne Luft schöpfen zu brauchen. Die Finnwale (Balaenoptera) sollen sich mehrere Stunden an der Oberfläche des Wassers aufhalten und etwa alle zehn Minuten Luft holen. Hierdurch wird das Gewebe des Körpers so reichlich mit Sauerstoff durchtränkt, daß das Tier dann stundenlang in der Tiefe des Wassers weilen kann, ohne zu ersticken. Außerdem[S. 92] vermögen die sehr dehnbaren Lungen viel Luft aufzunehmen. —
Als ein Fallschirm im Wasser wirkt der glockenförmige Gallertkörper der Quallen. Die gallertartige Substanz ihres Körpers ist nur wenig schwerer als das Meerwasser, so daß nur eine geringe Kraft erforderlich ist, um ein Untersinken zu verhindern, wobei die schirmartige Gestalt von großem Vorteil ist. Die Fortbewegung erfolgt durch ein Zusammenziehen des weichen Körpers vermittels einer auf der Unterseite liegenden ringförmigen Muskulatur. Beim Zusammenziehen wird das im Körper befindliche Wasser rückwärts herausgepreßt, und der hierbei erfolgende Rückstoß treibt das Tier nach vorn. Die Qualle pumpt sich also gewissermaßen vorwärts.
Die Röhrenquallen oder Siphonophoren, welche nicht ein Einzelwesen, sondern, wie wir später noch sehen werden, eine ganze Kolonie von Tieren darstellen, haben oben eine Gasblase, die durch eine besondere Gasdrüse gefüllt wird. Diese Gasflasche verursacht einen Auftrieb, der die Röhre, um die die einzelnen Tiere gruppiert sind, senkrecht stellt.
Die zu den Röhrenquallen gehörende Segelqualle schwimmt nur an der Oberfläche des Wassers, ohne sich herabzusenken. Oben auf dem scheibenförmigen Körper steht ein großes dreieckiges Segel, das den Wasserspiegel überragt. So wird die Segelqualle wie ein Segelschiff durch den Wind auf dem Meere getrieben. Die Segelqualle besitzt noch eine andere Eigentümlichkeit, sie ist nämlich Luftatmer. Sie hat ein System von Luftkammern, das oben mit feinen Poren durchsetzt ist. Die in den Kammern befindliche Luft wird durch die Poren ausgepreßt und durch Frischluft ersetzt.
Durch zahlreiche Verästlungen dringt die Luft aus den Kammern in alle Teile der Tierkolonie.
[S. 93]
Die Quallen sind ferner mit Nesselorganen ausgerüstet, die als Fangarme auftreten oder als lange Fäden vom Körper herabhängen. Die Nesselorgane besitzen kleine Nesselkapseln, die einen spiralig aufgerollten Faden enthalten, der am vorderen Ende einen Dorn trägt. Bei Berührung wird der Deckel der Kapsel gesprengt, der Faden schnellt heraus, bohrt sich mit dem Dorn in das Opfer ein, und der Nesselsaft ergießt sich in den Körper. Das Gift lähmt oder tötet kleine Tiere sehr schnell.
Diese Nesselorgane, die nach dem Prinzip der Dynamitbombe, die durch Aufschlag explodiert, konstruiert sind, sind bei den Röhrenquallen besonders stark entwickelt. Wie ein Maschinengewehr beschießen die zahlreichen Nesselkapseln ein Tier, das mit den Fangfäden in Berührung kommt. —
Viele Säugetiere sind ausgezeichnete Kletterer. Obenan stehen die Affen als echte Baumtiere. Die kräftige Muskulatur ihrer langen Arme und Beine und die zu Greiforganen gewordnen Füße befähigen sie hierzu in hohem Maße. Bei einigen Affen ist auch der lange Schwanz zum Greiforgan geworden, das die kühnen Turnkünste vortrefflich unterstützt. Die Kapuziner- oder Rollschwanzaffen benutzen beim Klettern ihren Schwanz zum Festhalten, indem sie das Ende um einen Ast ringeln, und können sich sogar am Schwanz aufhängen. In bewundernswerter Weise verstehen die Klammeraffen (Ateles) ihren Schwanz zu gebrauchen. Er ist geradezu eine fünfte Hand. Der Affe springt in weitem Bogen durch die Luft. Im Sprunge erfaßt plötzlich der Wickelschwanz einen Ast, und der Affe schaukelt sich mit nach unten hängendem Körper, um im nächsten Augenblick den Schwung seines Körpers zu einem neuen Weitsprung auszunutzen. Unglaublich ist die Schnelligkeit, mit der der Schwanz als Hand benutzt wird, und mit der er den Bewegungen des Körpers, der[S. 94] Füße und Arme folgt und sich ihnen anpaßt. Die Verwendung des Schwanzes als Hand zeigt sich am besten darin, daß der Affe sogar imstande ist, Gegenstände mit dem Schwanz aufzuheben. Er benutzt ihn auch zum Ergreifen von Nahrung. Die untere Seite des Schwanzes ist nackt und besitzt ein feines Tastgefühl. —
Die Kunst des Fliegens spielt im Tierreich eine große Rolle. Sie erreicht ihre höchste Vollkommenheit bei den Vögeln, die zu Beherrschern der Luft geworden sind.
Die niedrigste Form in der Biotechnik des Fluges ist das Fallschirmfliegen, wie wir es bei Lurchen, Kriechtieren, Fischen und einigen Säugetieren finden. Der Flug ist von Klettertieren erworben worden, indem sich die Kletterorgane allmählich zu Flugwerkzeugen umbildeten, die zunächst den Zweck hatten, in Gestalt eines Fallschirmes den Weitsprung sicherer zu gestalten und seine Leistung zu vergrößern.
Auf Borneo und Java leben eigentümliche Baumfrösche, die sich durch langzehige Füße auszeichnen, deren Zehen durch große Schwimmhäute verbunden sind. Beim Sprung in die Tiefe zieht der Frosch die Beine an den Körper und breitet die Zehen mit den Schwimmhäuten weit aus. Die Füße bilden vier Fallschirme, die den Frosch langsam und sicher in schräger Linie herabgleiten lassen. Der Javaflugfrosch ist oben tiefgrün, auf der Bauchseite gelb gefärbt. Die Schwimmhäute haben blaue Flecken. Er besitzt ebenso wie der etwas kleinere Laubfrosch Saugscheiben an den Zehen.
Eine bessere Flugeinrichtung sehen wir beim Flugdrachen (Draco volans), einer kleinen nur 21 cm langen Echse auf den Sundainseln. Die hinteren falschen Rippen sind über den Körper hinaus verlängert und durch eine Flughaut verbunden. In der Ruhe sind die Flughäute zusammengefaltet, beim Sprung durch[S. 95] die Luft werden sie wie ein Schirm aufgespannt. Der Flugdrache benutzt seine Flugkunst besonders zum Fang fliegender Insekten. Er springt von seinem Sitz herab, gleitet mit Hilfe der beiden Fallschirme im sanften Bogen durch die Luft und landet auf einem tiefer gelegenen Ast. Nach neueren Beobachtungen soll der Flugdrache bis zu 20 m weit fliegen können und sogar imstande sein, im Fliegen Hindernissen auszuweichen. Die Farbe des Körpers und der inneren Hälfte der Fallschirme ist ein metallisch glänzendes Rotbraun mit dunkeln Zeichnungen und Flecken. Die vordere Hälfte der Flughäute ist orangerot. Der Oberkopf und die Bauchseite sind grün.
Auch unter den Geckos finden sich einige Formen mit Flughäuten am Leibe und Spannhäuten zwischen den Zehen, die den Tieren einen kurzen Gleitflug gestatten. —
Wir befinden uns an Bord eines großen Dampfers und durchqueren den Indischen Ozean auf der Fahrt nach Ceylon. Unser Blick streift über die endlose Wasserfläche. Plötzlich taucht vor uns eine Schar kleiner Lebewesen aus dem Wasser auf, ihre Leiber glitzern wie Silber in dem Schein der Tropensonne. Sie schweben eine kurze Strecke über dem Meeresspiegel dahin, um schnell wieder im Wasser, aus dem sie raketenartig auftauchten, zu verschwinden. Es waren fliegende Fische. Diese eigentümlichen Gesellen sind Bewohner der warmen Meere; eine Art, der Schwalbenfisch (Exocoetus volitans), kommt auch im Mittelmeer vor. Die Flugfische besitzen sehr große, lange und breite Brustflossen, welche beim Fliegen als Tragflächen wirken. Der Fisch schnellt sich durch einen kräftigen Schlag mit der Schwanzflosse aus dem Wasser, spreizt die flügelartigen Brustflossen aus und gleitet in einer Kurve mit nur geringer Erhebung und kurzem aufsteigendem, aber langem abfallendem Ast über dem Wasserspiegel dahin. Im Fluge werden[S. 96] die ausgebreiteten Brustflossen nicht aktiv bewegt. Sie werden nicht als Flügel, sondern nur als Fallschirm gebraucht. Dagegen stellen sich die Flossen automatisch nach dem Winde ein, und die kräftigen Brustmuskeln, welche die Flossen halten, wirken dabei wie die Schnur eines Drachens. Der Flug der Fische erfolgt nach dem Prinzip des Drachens. Bei günstigem Aufstieg gegen den Wind können die Fische eine Entfernung bis zu 200 m im Gleitflug zurücklegen. Meist ist die Flugbahn nur 20–30 m lang. Kommt beim Aufsteigen aus dem Wasser der Wind von der Seite, so drehen sich die Flugflossen allmählich gegen den Wind ein, wodurch eine stärkere Krümmung der Flugbahn hervorgerufen wird. Am Tage erheben sich die Fische meist nur 1–2 m über das Wasser, in der Nacht dagegen führen sie höhere Flüge bis zu 6 m aus. In der Nacht werden die Fische häufig durch den Lichtschein der Schiffe angelockt und fallen dann bei ihrem Fluge auf Deck nieder.
Die Flugfische benutzen ihre Flugfertigkeit, um der Verfolgung der Raubfische zu entgehen, wie im Übermut und aus Spielerei, was dem „Springen“ anderer Fische entspricht (Abbildung 8).
Auch unter den Säugetieren finden wir Fallschirmflieger. Die einfachste Form des Fallschirms stellt der zweizeilig behaarte, buschige Schwanz des Eichhörnchens dar. Im Sprung streckt das Eichhörnchen den Schwanz nach hinten und sträubt die langen dichten Haare seitwärts, wodurch eine Tragfläche gebildet wird, die den Sprung des Tiers unterstützt. Schneidet man einem Eichhörnchen den Schwanz ab, so ist es nicht mehr imstande, weite Sprünge auszuführen.
Besser ausgerüstet als die gewöhnlichen Eichhörnchen sind die Flughörnchen, die eine Spannhaut zwischen den Vorder- und Hinterfüßen haben, welche in der Ruhe zusammengefaltet, beim Sprunge schirmartig aufgespannt wird. Die Flughörnchen beleben[S. 97] in verschiedenen Gattungen mit etwa 50 Arten die nördliche Hälfte der Erdkugel von der warmen bis zur kalten Zone. Sie führen sämtlich ein Nachtleben und halten sich am Tage in hohlen Bäumen oder anderen Verstecken verborgen.
Die größte Art ist der in Ostindien und auf Ceylon beheimatete Taguan (Petaurista oral), der eine Länge von 120 cm erreicht, wovon etwa die Hälfte auf den sehr langen Schwanz kommt. Das Tier ist auf der Oberseite schwarzgrau, unten weißgrau gefärbt. Die mit sehr kurzen Haaren bedeckte Flughaut ist rötlich schwarzbraun. Der Taguan ist imstande, vermittels seiner Flughaut 60 m weite Sprünge auszuführen und kann mit Hilfe des als Steuer wirkenden Schwanzes noch in der Luft die Richtung verändern.
Der Zwerg unter den Flughörnchen lebt in Arrakan und Kotschinchina und hat eine Leibeslänge von nur 12 cm.
Der kaum größere Assapan (Glaucomys volans) Nordamerikas zeichnet sich durch große Beweglichkeit und Gewandtheit aus. Mit unglaublicher Schnelligkeit tollt er in den Zweigen umher, führt weite Sprünge aus, hängt sich schwebend an einen Ast, um im nächsten Augenblick fortzuhuschen. Man vermag den zierlichen, behenden Bewegungen des Tieres und dem schnellen Wechsel seiner Stellungen kaum mit dem Auge zu folgen. Aus großer Höhe springt der Assapan im Schwebeflug herab, um noch im letzten Augenblick vor dem Aufprall auf der Erde durch eine jähe Wendung einen Baumstamm oder Ast zu ergreifen und hurtig an ihm emporzurutschen. Das zierliche, gelbbraun gefärbte Tier ist ein wütender Räuber, der neben Pflanzenkost sehr die Fleischnahrung liebt, kleine Vögel, sogar Säugetiere überfällt und erwürgt.
Flughörnchen gelangen öfters in den Tierhandel. Sie sind sehr anmutige und fesselnde Zimmergenossen, die meist schnell zahm werden.
[S. 98]
Nicht nur bei den Eichhörnchen, sondern auch in anderen Klassen der Säugetiere finden wir Fallschirmflieger. Hierzu gehört der etwa katzengroße Kaguang (Galeopithecus volans), der die Sundainseln, einige benachbarte kleinere Inseln und die Malaiische Halbinsel bewohnt. Das sonderbare Tier, das in Gebirgswäldern haust, besitzt ebenso wie die Flughörnchen eine Flughaut zwischen den vorderen und hinteren Gliedmaßen. Seine systematische Einreihung hat den Forschern viel Kopfzerbrechen verursacht, da es sowohl Merkmale der Halbaffen wie der Fledermäuse, der Raubtiere, der Beuteltiere und der Insektenfresser zeigt. Die neuere Systematik gliedert die Pelzflatterer, denen der Kaguang angehört, den Insektenfressern ein.
Unter den Beuteltieren hat der Eichhörnchen-Flugbeutler (Petaurus sciureus) die Kunst des Fallschirmfliegens erworben (Abbildung 5).
Eine höhere Stufe in der Technik des Fliegens als die Fallschirmflieger haben die Fledermäuse erreicht. Hier erhebt sich der Flug aus dem passiven Gleitflug der Fallschirmflieger zum aktiven Gebrauch der Flugwerkzeuge. Die Fledermäuse und ihre Verwandten bilden die besondere Ordnung der Flattertiere (Chiroptera), deren Hände zu Flugwerkzeugen geworden sind. Armknochen und Finger sind sehr lang. Die drei innersten Finger übertreffen an Länge sogar den sehr langen Unterarm. Durch diese Verlängerung der vorderen Gliedmaßen kann die faltenreiche Flughaut, die von den Hinterfüßen längs des Leibes bis zu den Händen reicht und auch die Finger ganz überzieht, weit ausgespannt werden. Die Flugeinrichtung ist also in der Hauptsache auf die vorderen Gliedmaßen verlegt, was bereits an die Vögel erinnert, bei denen die Arme zu Flügeln geworden sind.
Auch der übrige Bau des Körpers ist bei den Flattertieren in[S. 99] ähnlicher Weise wie bei den Vögeln dem Flugwesen angepaßt. Um die Atmung beim Fliegen zu erleichtern, ist der Brustkorb sehr geräumig, da die Wirbelsäule nach hinten gekrümmt ist, und das Brustbein sich unten von der Wirbelsäule nach außen entfernt. Ebenso wie bei den Kielbrustvögeln befindet sich auf der Mitte des Brustbeins ein Kiel, der die Ansatzfläche für die Brustmuskulatur, die die Arme beim Fliegen bewegt, vergrößert. Die Rippen sind zum großen Teil mit dem Brustbein und den Wirbeln, teilweise auch untereinander fest verschmolzen, so daß der Körper die zum Fluge notwendige Starrheit besitzt. Auch eine große Anzahl der Lendenwirbel ist mit dem Becken verwachsen.
Die Flughaut ist sehr kompliziert gebaut und besitzt ein filzartiges, sehr elastisches Gewebe, das reichlich mit Blutgefäßen durchsetzt ist und einen lebhaften Stoffwechsel unterhält. Ferner ist sie mit Sinneshaaren ausgestattet, die ein feines Tastempfinden ermöglichen.
Die Flugbewegung ist ein Flattern, d. h. die Flügel müssen ununterbrochen bewegt werden, um den Körper in der Luft zu halten. Ein Schweben, wie es die Vögel tun, kann die Fledermaus nicht ausführen. Trotzdem ist der Flug sehr gewandt, schnell und rascher Wendungen fähig. Ebenso wie bei den Vögeln hängt die Gewandtheit des Fliegens von der Bildung der Flügel ab. Fledermäuse mit langen, schmalen Flugflächen fliegen viel gewandter und schneller als solche mit kurzen und breiten Flughäuten. Vom Boden können die Fledermäuse nur unbeholfen und schwer auffliegen. Sie rutschen mit ausgebreiteten Flughäuten vorwärts, heben den Körper hoch und versuchen in die Höhe zu springen, bis es ihnen glückt, im Sprung die Flugwerkzeuge zu entfalten und sich in die Luft zu erheben. Infolge der Unbeholfenheit auf dem Erdboden ruhen alle Flattertiere stets in hängender Stellung.[S. 100] Im Absturz ist es ihnen ein leichtes, die Flughäute zu entspannen und den Flug aufzunehmen.
Die Nahrung der Flattertiere besteht in Früchten und Insekten. Einige Arten, die amerikanischen Blattnasen, saugen auch größeren Tieren das Blut aus. Für die Viehherden bilden diese blutsaugenden Fledermäuse eine große Plage. Der im Volksmunde als Blutsauger verschriene Vampir Brasiliens ist aber völlig zu Unrecht in diesen Verdacht gekommen. Er macht in dieser Beziehung gerade eine rühmliche Ausnahme unter seinen Verwandten, lebt nur von Insekten und Früchten und saugt niemals Blut.
Völlig verschieden vom Fallschirmflug und Flatterflug ist das Fliegen der Insekten, das eine ganz besondere Technik darstellt.
Die Insekten, auch Sechsfüßler genannt, bilden einen besonderen Kreis unter den Gliedertieren, die sich durch einen in mehrfache Abschnitte (Segmente) gegliederten Körper und durch ebenfalls gegliederte Füße auszeichnen. Die Festigkeit des Körpers wird durch die Chitinhülle gegeben, die das fehlende innere Skelett ersetzt.
Die Insekten sind die einzigen wirbellosen Tiere, die fliegen können. Freilich besitzen nicht alle Vertreter dieser Klasse die Flugfähigkeit; viele Arten sind unflugfähig, bei anderen sind entweder nur die Männchen oder nur die Weibchen im Besitz der Flugkunst.
Mit Ausnahme der Mücken und Fliegen, die nur zwei Flügel besitzen, haben alle flugfähigen Insekten vier Flügel. Je ein Flügelpaar befindet sich an der Mittel- und Hinterbrust. Bei den Käfern ist das vordere Flügelpaar zu harten Flügeldecken geworden.
Die Technik des Insektenflugs beruht auf dem Prinzip des Hubflugs, d. h. die Arbeit der Flügel muß zunächst den Körper in der Luft halten, und nur die überschüssige Kraft, die hierfür[S. 101] nicht verbraucht wird, dient zur Fortbewegung. Das Heben des Körpers ist also die primäre und die Fortbewegung die sekundäre Erscheinung. Da der Hubflug aus einem beständigen Steigen und Fallen besteht, so ist der Fall um so größer, je langsamer die Flügelschläge aufeinander folgen. Je schneller also die Flügel arbeiten, um so günstiger gestaltet sich der Hubflug. Infolgedessen ist bei vielen Insekten die Anzahl der Flügelschläge ungeheuer groß. Der Hubflug wird dadurch zum Schwirrflug. Die Stubenfliege macht im Fluge in der Sekunde 190 Flügelschläge, die Honigbiene 200 und die Hummel sogar 240. Da im Fluge die meiste Kraft zur Erhaltung des Körpers in der Luft verbraucht wird, so ist die Fluggeschwindigkeit der Insekten nicht allzu groß. Sie beträgt bei der Stubenfliege 2,20 m in der Sekunde und bei der Biene 3,75 m. Die Geschwindigkeit des Insektenflugs ist also im Vergleich zum Vogelflug sehr gering, denn die Brieftaube durchfliegt in der Sekunde ca. 19 m. Im Gegensatz zum Insektenflug beruht der Vogelflug auf dem Prinzip des Drachenflugs, bei dem die Triebkraft in erster Linie der Vorwärtsbewegung zugute kommt.
Bei den mit vier Flügeln ausgerüsteten Insekten leisten Vorder- und Hinterflügel ungefähr dieselbe Arbeit mit derselben Anzahl der Flügelschläge. Eine Ausnahme machen jedoch die Käfer mit ihren zu harten Schutzdecken umgebildeten Vorderflügeln. Die frühere Ansicht, daß ihre Vorderflügel am Fliegen nicht aktiv beteiligt sind, ist durch neuere Beobachtung widerlegt worden. Sie bewegen sich von oben nach unten, ohne jedoch die Horizontallinie zu erreichen, und ihre Schläge sind langsamer als die der Hinterflügel, die die Hauptarbeit des Fliegens verrichten. Der Maikäfer ist nicht imstande, ohne weiteres aufzufliegen, sondern er muß erst eine mühsame Vorbereitung treffen. Er „zählt“, wie der Volksmund sagt, d. h. er bewegt in gleichmäßigem[S. 102] Takt Leib und Fühler auf- und abwärts. Hierdurch wird durch die an den Seiten des Leibes liegenden Atemöffnungen ein Luftvorrat in besondere Luftsäcke eingepumpt. Dieser Luftvorrat befähigt erst den Maikäfer, sich in die Luft zu erheben.
Die Schmetterlinge mit ihren großen und breiten Flügeln sind imstande, außer dem Hubflug auch einen Segel- und Gleitflug auszuführen. Ihre Flugtechnik nähert sich daher der Flugkunst der Vögel.
Libellen und Fliegen können im Fluge sehr schnelle und scharfe Wendungen und Drehungen ausführen, weil der Schwerpunkt ihres Körpers in der Drehachse zwischen den Flügeln liegt.
Wenn ein größeres Insekt, wie eine Libelle oder ein Schmetterling, im Zimmer unterhalb der Decke dahinfliegt, so stößt es fortgesetzt an der Decke an. Die Ursache liegt nicht an einer Ungeschicklichkeit des Fliegens, sondern hat ihre physikalischen Gründe. Über dem fliegenden Insekt entsteht ein luftleerer Raum, der sich um so weniger schnell mit Luft füllen kann, je näher das Tier der Decke ist. Hierdurch wird der luftleere Raum verstärkt und das Tier nach oben gezogen, wodurch der Anprall an der Zimmerdecke erfolgt.
Die höchste Vollkommenheit hat das Flugwesen bei den Vögeln erreicht, die die Beherrscher der Luft geworden sind. Das Fliegen der Vögel ist bald ein Dahinstürmen durch die Luft, wobei die Flügel ruderartig bewegt werden, bald ein Gleiten oder ein Schweben und Kreisen, wobei der Vogel ohne Flügelschlag die Luft durchschneidet, in prachtvollen Schwenkungen sich hebend und senkend. Der Flug der Kolibris ist ein Schwirren. Mit unglaublich schnellen Flügelschlägen, die man mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen kann, rüttelt der Kolibri vor der Blüte und[S. 103] taucht dabei seinen langen Schnabel in den Blumenkelch, um Nektar zu schlürfen und kleinste, im Innern der Blüte verborgene Insekten hervorzuholen. Der Turmfalke steht mit hastigen Flügelschlägen in der Luft, nach Insekten oder Mäusen ausspähend. Eine solche Flugkunst erfordert eine besondere Organisation sowohl des Körpers wie der Flugwerkzeuge.
Ein gewandter Flug verlangt vor allem eine gewisse Starrheit des Rumpfes. Dieser muß wie ein stählernes Luftschiff die Luft durchschneiden. Jede Biegsamkeit und Weichheit würde für die Erhaltung des Gleichgewichts hinderlich sein. Infolgedessen bildet das Skelett des Vogels eine geschlossene Einheit. Die Wirbelsäule ist unbeweglich, mit dem Becken fest verschmolzen und bildet mit den Rippen und dem sehr großen Brustbein ein geschlossenes Ganzes. Die Festigkeit des Brustkorbes wird bei vielen Vögeln noch durch besondere Hakenfortsätze der Rippen, welche diese gegenseitig stützen, erhöht. Von dem kurzen Schwanzskelett sind die ersten Wirbel mit dem Becken verwachsen und die letzten Wirbel zu einem einheitlichen Knochen, dem Steißknochen, verschmolzen, so daß nur die mittleren 5–7 Wirbel frei und beweglich sind, um dem Schwanz Bewegungsfreiheit zu geben.
Der Schultergürtel stellt die Verbindung der Flügel mit dem Rumpf her. Die säbelförmigen Schulterblätter laufen dem Rückgrat parallel und erstrecken sich bisweilen fast bis zum Becken. Am vorderen Ende der Schulterblätter befinden sich die Rabenschnabelbeine. Sie führen senkrecht nach unten zum Brustbein und sind fest mit diesem verankert. Sie verleihen den Schultern und den auf ihnen ruhenden Flügeln eine feste Stütze. Die Schlüsselbeine sind zum einheitlichen Gabelbein verwachsen. Also überall im Körperbau das Prinzip der Festigkeit und geschlossenen Einheit, wie es für den Flug erforderlich ist.
[S. 104]
Das große und breite Brustbein trägt in der Mitte eine kammartige Erhöhung, den Kiel, der die Ansatzfläche für die Brustmuskeln, welche die Flügel bewegen, vergrößert. Dieser Kiel ist das typische Wahrzeichen für die Flugfähigkeit des Vogels. Er fehlt nur den Straußen, Nandus, Emus, Kasuaren und Kiwis, welche nicht fliegen können. Man nennt daher diese Vögel „Flachbrustvögel“ (Ratitae) im Gegensatz zu den „Kielbrustvögeln“ (Carinatae).
Arme und Hände haben ihre ursprüngliche Bedeutung völlig verloren und sind ganz dem Flugwesen angepaßt. Unterarm und Hand sind die Träger der Schwungfedern, die dementsprechend als „Handschwingen“ und „Armschwingen“ unterschieden werden. Da die Hand ihre Bedeutung als Greiforgan eingebüßt hat, so ist die Zahl der Finger und Handknochen erheblich reduziert. Es sind nur 2 Mittelhandknochen und nur 3 Finger vorhanden, von denen 2 verwachsen sind und der äußere dritte, der als Daumen anzusehen ist, ein besonderes kleines Flügelchen, wissenschaftlich „Alula“ genannt, trägt, dessen Bedeutung wir später noch kennenlernen werden. Kasuare und Kiwis haben sogar nur einen Finger an ihrer ganz verkümmerten Hand.
Die Bewegung der Armknochen ist beschränkt und nur so weit gestattet, als es für den Flug notwendig ist. Hierdurch wird jede unnütze Bewegung, die den Flug beeinträchtigen würde, ausgeschaltet. Hand und Unterarm können nämlich nur horizontal in der Ebene des ausgespannten Flügels bewegt werden, aber in keiner anderen Richtung. Sie gestatten also nur die Bewegung, die zum Öffnen und Schließen der Flügel notwendig ist. Sie werden wie ein Taschenmesser auf- und zugeklappt. Der geöffnete Flügel bildet also eine einheitliche feste Tragfläche, die beim Fliegen schraubenartig im Schultergelenk bewegt wird.
[S. 105]
Der Flug der Vögel erfolgt in verschiedener Weise. Werden die Flügel gleichmäßig auf und nieder bewegt, so spricht man vom „Ruderflug“. Die Flügel wirken in der Luft wie die Ruder eines Bootes im Wasser. Der Ruderflug, den alle Vögel ausführen, ist die typische Flugbewegung. Erfolgt sie sehr schnell mit schnurrenden Flügelschlägen, so wird der Ruderflug zum „Schwirrflug“, wie ihn in höchster Vollkommenheit die Kolibris ausüben. Im Gegensatz zum Schwirrflug steht der Flatterflug, der mit hastigen, unbeholfenen Flügelschlägen vor sich geht, wie wir ihn bei den Hühnervögeln finden.
Beim „Gleitflug“ senkt sich der Vogel in schräger Linie aus der Höhe herab mit völlig unbeweglichen Flügeln. Der Motor wird also abgestellt, und die noch im Körper aufgespeicherte Kraft der Vorwärtsbewegung wird dabei ausgenutzt. Die ausgespannten Flügel wirken dann als Fallschirm.
Eine besondere Eigentümlichkeit des Vogelflugs ist der„Segelflug“, der den Forschern viel Kopfzerbrechen verursacht hat. Der segelnde Vogel schwebt ohne sichtbaren Flügelschlag durch das Luftmeer, senkt sich, steigt höher, führt gewandte Schwenkungen aus, zieht Kreise oder bewegt sich in Schraubenlinien auf- und abwärts — eine vollendete Technik des Fliegens! Besonders die Möwen sind wahre Künstler im Segelflug. Ihnen fast gleich tun es die größeren Raubvögel. Wohl jeder hat schon das Kreisen des Bussards hoch in der Luft bewundert.
Wie ist dieser Flug ohne Flügelschlag möglich? Zu seiner Erklärung hat man die verschiedensten Theorien aufgestellt. So glaubte man, daß aufsteigende Luftströmungen den Vogel in der Luft tragen und heben, so daß die Triebkraft der Flügelbewegung unnötig wird und die Flügel nur als Segel und Fallschirm wirken. Diese Annahme ist jedoch nicht zutreffend, denn die Vögel[S. 106] schweben auch an solchen Orten, wo keine aufsteigenden Luftströme vorhanden sind, z. B. die Möwen über dem Meeresspiegel, die Raubvögel und Störche über dem flachen Lande. Andere Forscher meinten daher, daß der Segelflug mit Hilfe feiner, zitternder Bewegungen der Flügel ausgeführt werde, die in größerer Entfernung nicht mehr wahrnehmbar sind. Solche geringen Flügelbewegungen können aber unmöglich ausreichen, um den Vogelkörper in der Luft zu tragen und ihn sogar zu so ungewöhnlichen Flugkünsten zu befähigen. Nach einer anderen Auffassung soll die aus der Kreisbewegung sich ergebende Zentrifugalkraft die Energie zur Überwindung der Schwerkraft liefern. Hiergegen läßt sich einwenden, daß der Segelflug keineswegs von einer Kreisbewegung abhängt, da er auch geradlinig erfolgt.
Alle diese Erklärungen sind nur reine Theorien, die einer gewissenhaften Kritik nicht standhalten können.
Der durch seine ersten Flugversuche berühmte Techniker Otto Lilienthal schreibt in seinem Werke „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“: „Fragen wir uns, worauf wir die Möglichkeit des Segelns zurückzuführen haben, so müssen wir in erster Linie die geeignete Flügelform dafür ansehen; denn nur solche Flügel, deren Querschnitte senkrecht zu ihrer Längsachse die geeignete Wölbung zeigen, erhalten eine günstige Luftwiderstandsrichtung, daß keine größere Geschwindigkeit verzehrende Kraftkomponente sich einstellt. Aber es muß noch ein anderer Faktor hinzutreten; denn ganz reichen die Eigenschaften der Fläche allein nicht aus, um dauerndes Segeln zu gestatten. Es muß ein Wind von einer wenigstens mittleren Geschwindigkeit wehen, welcher dann durch seine aufsteigende Richtung die Luftwiderstandsrichtung so umgestaltet, daß der Vogel zum Drachen wird, der nicht nur keine Schnur gebraucht, sondern sich sogar frei gegen den Wind bewegt.“
[S. 107]
Gustav Lilienthal, der Bruder des verstorbenen Aviatikers, hat die Untersuchungen über die Biotechnik des Fliegens fortgesetzt und nachgewiesen, daß außer einer geeigneten Wölbung des Flügels vor allem die Dicke der Flügelknochen für den Segelflug in Betracht kommt. Nach Lilienthal ist der Auftrieb einer gewölbten Fläche um so größer, wenn die vordere Kante verdickt ist, wie es beim Vogelflügel der Fall ist. Alle Vögel, die segeln, haben besonders starke Armknochen. Während z. B. der Unterarm des Fasans, der nicht segeln kann, nur ¹⁄₃₀ so dick ist als die Flügelbreite, beträgt die Armstärke beim Albatros, der ein vortrefflicher Segler ist, den achten Teil der Flügelbreite. Außerdem spielt auch die Länge der Flügel für das Segeln eine große Rolle. Nach Lilienthal können nur Vögel mit stark gewölbten und verdickten Flügeln den Segelflug ausüben, und zwar nur im möglichst gleichmäßigen Winde, also über dem Lande nur in größeren Höhen, über dem Wasser auch in geringerer Tiefe. Der segelnde Vogel wird also vom Winde getragen und getrieben.
Im Gegensatz zu Lilienthals Erklärung steht die Anschauung Ahlborns, der meint, daß nicht ein gleichmäßiger Wind, sondern gerade die Windschwankungen die Kraftquelle für den Segelflug geben, indem sie dieselbe Wirkung ausüben wie die aktiven Flügelschläge. Die positiven Windstöße wirken wie die Tiefschläge der Flügel, die Flauten wie die Hochschläge. Die eigentlichen Triebfedern beim Segelflug sind die gespreizten äußeren Handschwingen, die sich automatisch in die Vortriebstellung einrichten.
Der Segelflug, den nur gewisse Vögel ausüben können, bedarf jedenfalls noch einer weiteren gründlichen Erforschung, denn die Widersprüche über seine Entstehung und die Art seines Wesens sind noch zu groß, um ein klares Urteil zu gestatten.
[S. 108]
Eine andere Flugart ist das „Rütteln“, wobei der Vogel mit schnellen Flügelschlägen an derselben Stelle in der Luft stehenbleibt. Man sieht es hauptsächlich vom Turmfalken, der infolgedessen auch Rüttelfalk genannt wird. Ebenso wie der Segelflug bedarf auch der Rüttelflug, der nur wenigen Vögeln eigen ist, noch der Aufklärung.
Die Alula oder der Afterflügel des Daumens scheint zum Bremsen der Fluggeschwindigkeit und zum Steuern zu dienen. Vor dem Landen wird der entfaltete Afterflügel abgespreizt und aus der Flügelfläche heraus schräg nach oben gestellt. Hierdurch wird der Körper um seine Querachse nach oben gedreht, und der Vogel kommt in eine aufrechte Haltung, wie sie zum Sitzen erforderlich ist. Ein ungleichmäßiges Aufrichten beider Afterflügel dient wahrscheinlich zur Quersteuerung.
Die seitliche Steuerung während des Fluges wird mit den Flügeln ausgeführt. Durch Verminderung des Flügelschlages und Anziehen eines Flügels wird der Körper seitwärts beigedreht.
Der Schwanz kommt anscheinend als Steuer nur wenig in Betracht. Der ausgebreitete Schwanz wirkt als Tragfläche, die einen Auftrieb verursacht und die Herstellung des Gleichgewichts erleichtert. Infolgedessen wird beim abwärts gerichteten Fluge der Schwanz nach oben gestellt, um seine hebende Wirkung auszuschalten.
Die Beine werden beim Fliegen auf längere Strecken nach hinten unter den Schwanz gelegt. Den Hals strecken wohl die meisten Vögel beim Fliegen nach vorn, einige, wie z. B. die Reiher, ziehen ihren langen Hals ein.
Das Auffliegen erfolgt stets gegen den Wind, und zwar meist in schräger Linie. Kleine Vögel, wie z. B. die Lerchen, steigen auch senkrecht in die Höhe, was man als „Kletterflug“ bezeichnet.
[S. 109]
Die Fluggeschwindigkeit der Vögel ist früher sehr überschätzt worden. Die größte Fluggeschwindigkeit entfalten die tropischen Stachelschwanzsegler (Chaetura) und der Fregattvogel mit einer Eigengeschwindigkeit von etwa 40–44 m/sec. Die Geschwindigkeit der Brieftaube beträgt etwa 19–20 m/sec., also ungefähr 70 km in der Stunde, was nahezu der Schnelligkeit eines Eilzuges gleichkommt.
Manche Vögel haben eine fabelhafte Flugdauer. Der Mauersegler verbringt den größten Teil seines Lebens in der Luft, in der sich sogar die Begattung abspielt. Möwen und andere Seevögel fliegen stundenlang über dem Meere, ohne zu ermüden. Die ausdauerndsten Flieger sind die Sturmvögel, deren Heimat der offene Ozean ist, wo sie tagelang in Unwetter und Sturm über den Wellen dahinschweben, nur hin und wieder eine kurze Rast auf dem Wasserspiegel haltend. Ein Albatros, der größte Sturmvogel, folgte einem Schiff, das mit 4,5 Knoten Geschwindigkeit fuhr, sechs volle Tage im Fluge.
Die Sturmvögel gehören zu den wunderbarsten Vogelgestalten. Sie suchen ihre Nahrung, Fische und Meerestiere, an der Oberfläche des Wassers und treiben sich tagelang mitten auf dem Weltmeere umher, bald niedrig über den Wellen fliegend, geschickt jeder Bewegung des Wassers folgend, ohne sich zu benetzen, bald in herrlichen Schwenkungen höher steigend, um dann in reißend schnellem Fluge durch die Luft zu schießen. Mit größter Gewandtheit und Schnelligkeit drehen und wenden sie sich im Fluge nicht nur nach der Seite, sondern auch auf- und abwärts. Die kleineren Sturmtaucher verschwinden aus reißend schnellem Fluge plötzlich in den Wellen, schwimmen, auf der Jagd nach Beute, ein Stück unter Wasser, wobei sie mit den Füßen und Flügeln rudern, um dann wie eine Rakete aus dem Wasser wieder[S. 110] aufzutauchen und durch die Luft zu jagen. Die Sturmvögel sind die besten, gewandtesten und ausdauerndsten Flieger aller Vögel. Sie nisten an den Meeresküsten und auf Inseln, teils auf dem Erdboden, teils in selbst gegrabenen Erdlöchern. Die Farbe des Gefieders ist im allgemeinen rauchbraun mit mehr oder weniger weißen Abzeichen auf dem Rücken und der Unterseite. Die Sturmvögel bewohnen alle Weltmeere zwischen dem Nördlichen und Südlichen Eismeer. Ihr Verbreitungszentrum liegt jedoch in den warmen Zonen.
Eine besondere Eigentümlichkeit der Sturmvögel ist der Bau der Nasenlöcher. Diese liegen entweder zusammen in einer einheitlichen Röhre auf der Firste des Schnabels, oder in zwei verwachsenen Röhren, oder aber in zwei getrennten Röhren auf jeder Seite des Schnabels. Die Sturmvögel bilden eine eigene Ordnung in der Reihe der Vögel.
Außer dem Flugvermögen ist noch eine zweite Eigenschaft bei den Vögeln zur höchsten Entwicklung gelangt, nämlich die Stimme. Sie hat bei keinem anderen Tier eine solche Vollkommenheit erreicht als beim Vogel und besonders beim Singvogel. Der Gesang der Nachtigall in milder Lenzesnacht mit seinen flötenden, sehnsuchtsvoll schluchzenden Tönen, der markige Schlag der Drossel, das melancholische Lied des Rotkehlchens und die frischen Wirbel der Feldlerche sind herrliche Musik, die das Herz des nüchternsten Menschen erwärmen müssen.
Die hohe Ausbildung der Stimme bei den Vögeln ist vielleicht eine Folge ihrer Flugkraft. Die große Beweglichkeit, die der Flug dem Vogel verleiht, erhöhte die Bedeutung der Stimme als gegenseitiges Verständigungsmittel, als Anlockungsmittel bei ihrem geselligen Leben, und um in der Paarungszeit den Zusammenschluß der Geschlechter herzustellen. Der Gesang der Singvögel spielt ja[S. 111] gerade in der Brunstzeit eine so bedeutende Rolle beim Erwerb der Gattin, die durch die verführerischen Töne angelockt und geschlechtlich erregt wird, und als Waffe im Kampf mit dem Nebenbuhler. Ein Sängerkrieg im wahrsten Sinne des Wortes ist der Vogelgesang im Frühjahr.
Eine so hohe Fähigkeit der Stimmbildung verlangt freilich eine besondere Organisation. So besitzt denn der Vogel ein eigenes Organ für die Erzeugung der Stimme, einen zweiten Kehlkopf, der zwischen Luftröhre und Bronchien eingeschaltet ist. Es ist der „untere Kehlkopf“ oder „Syrinx“, der mit besonderen Membranen, die durch ein kompliziertes Muskelsystem gespannt werden, ausgerüstet ist. Der untere Kehlkopf läßt sich in seinem Bau mit einem Blasinstrument vergleichen. Ebenso sind die Luftsäcke, die einen großen Teil des Vogelkörpers durchziehen und von den Lungen mit Luft versorgt werden, sowie die teilweis eigenartig geformte Luftröhre, die sich bisweilen in großen Windungen durch das Brustbein hindurch bis in die Leibeshöhle erstreckt, von großer Bedeutung für die Stimme. Es würde zu weit führen, hier auf den Bau dieser Organe näher einzugehen, zumal ich sie in meinem Werk „Das Leben der Vögel“[1] eingehend geschildert habe, das auch die „Stimme und den Gesang der Vögel“, ihre Entstehung und Bedeutung ausführlich behandelt.
Freilich besitzen nicht alle Vögel des Gesanges süße Gabe. Viele Vögel, z. B. Gänse, Enten, schnepfenartige Vögel und andere vermögen nur wenige Laute hervorzubringen, die zum Teil sogar recht unschön sind. Andere Vögel sind ganz oder doch fast stumm. Der Strauß bringt nur in der Paarungszeit ein dumpfes Brummen hervor und sagt sonst gar nichts. Der männliche Wiedehopf ruft[S. 112] ein eintöniges „hup, hup“, sein Weibchen ist stumm. Unser allbekannter Freund Adebar ist bis auf ein heiseres Zischen, das im Rachen erzeugt wird und kein eigentlicher Stimmlaut ist, völlig schweigsam. Nur die jungen Nestvögel lassen ein katzenartiges Miauen hören. Den Mangel seiner Stimme weiß der alte Storch aber in anderer Weise zu ersetzen. Er klappert mit dem Schnabel, indem er die Schnabelhälften heftig aneinanderschlägt und dabei den Kopf auf den Rücken legt und allmählich aufrichtet. Das Klappern spielt im Leben des Storchs, den der Volksmund nicht mit Unrecht „Klapperstorch“ nennt, eine große Rolle. Es ist nicht nur ein Zeichen geschlechtlicher Erregung, sondern wird auch sonst fleißig geübt. Es dient zur gegenseitigen Begrüßung und zum Ausdruck freudiger, wie bösartiger Stimmung. Sogar die ganz jungen Störche klappern bereits im Horst mit ihren noch weichen Schnäbeln, oder richtiger gesagt, sie führen nur die Klapperbewegung aus, denn die anfangs noch weichen Schnabelränder erzeugen noch keinen Ton.
Das Klappern des Storchs ist eine Instrumentalmusik, wie sie auch von anderen Vögeln ausgeübt wird. Hierzu gehört das Trommeln der Spechte. Der Specht führt hierbei mit seinem sehr harten Schnabel schnelle, wirbelartige Schläge auf einem dürren Ast aus, dessen Holz hierdurch in seinen Bestandteilen in Schwingungen versetzt wird und einen surrenden Ton erzeugt.
Die männlichen Spechte trommeln im Frühjahr, um sich den Weibchen bemerkbar zu machen, und zwar sind es hauptsächlich die Buntspechte, welche diese Kunst ausüben, da sie außer ihrem eintönigen Lockruf, der wie ein kurzes, scharfes „kick“ klingt, weiter keine Töne hervorbringen können. Die Grünspechte, die einen weithinschallenden, melodischen Ruf haben, trommeln weniger, sondern suchen sich mehr durch ihre Stimme bemerkbar zu machen.


[S. 113]
Wenn wir im Frühjahr des Abends an einem Luch entlang wandern, dann hören wir aus der Höhe eigenartige Töne herabschallen, die an das Meckern einer Ziege erinnern. Es ist die Bekassine oder Himmelsziege, die ihren Balzflug in der Luft ausübt und diese sonderbaren Töne hervorbringt, die den fehlenden Gesang ersetzen sollen. Durch einwandfreie Untersuchung namhafter Ornithologen ist festgestellt worden, daß es sich auch hier nicht um Stimmlaute, sondern um Instrumentalmusik handelt. Die Bekassine bringt die Töne mit den Schwanzfedern hervor. Sie läßt sich im schrägen Bogen mit halb angezogenen Schwingen in der Luft ein Stück herunterfallen und spreizt die Schwanzfedern aus. Der Luftstrom, der unterhalb der Flügel nach rückwärts entweicht, trifft auf die äußeren Schwanzfedern und setzt sie in Schwingungen, welche einen surrenden Ton hervorrufen. Durch feine Zuckungen mit den Flügeln wird die Tonfolge fortlaufend unterbrochen, wodurch ein dem Meckern ähnliches Tremulieren entsteht. Aus dem Absturz schwingt sich der Vogel wieder in die Höhe, um das Spiel von neuem zu beginnen.
In einer Jagdzeitschrift behauptete jüngst ein Weidmann, daß er eine Bekassine beobachtet habe, die auf dem Erdboden sitzend meckerte, und zweifelte infolgedessen die Theorie des Schwanzmeckerns an. Dies ist jedoch ein Irrtum, der wohl dadurch veranlaßt wurde, daß gleichzeitig eine zweite Bekassine in der Nähe ihren Balzflug ausführte, was von dem Beobachter übersehen wurde. Daß die Bekassine die Töne tatsächlich mit den Schwanzfedern hervorbringt, ist durch eingehende Beobachtung und experimentelle Untersuchung festgestellt worden und unzweifelhaft richtig. Man kann das Meckern künstlich hervorrufen, wenn man eine äußere Schwanzfeder der Bekassine mit dem Kiel senkrecht auf einer biegsamen Rute befestigt und dann diese kräftig durch die Luft schwingt.
[S. 114]
Die Tauben lassen beim Auffliegen ein laut klatschendes Geräusch erschallen, indem sie die Flügelspitzen über dem Rücken kräftig aneinanderschlagen. Man darf diese Instrumentallaute wohl als ein Warnsignal ansehen, das die Genossen zur Flucht veranlassen soll.
Eine sexuelle Bedeutung hat das Flügelklatschen, das der Ringeltäuber im Balzflug ausübt.
Bei der Indischen Baumente (Dendrocygna javanica) zeigt die erste Schwungfeder eine starke Ausbuchtung auf der Innenfahne, durch die im Fluge ein lautes, pfeifendes Geräusch hervorgebracht wird. Diese Feder ist also ein regelrechtes Musikinstrument, eine „Schallschwinge“, die zur gegenseitigen Verständigung dieser stimmlosen Enten dient, um im Fluge die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Das Kaninchen, welches nur in höchster Lebensnot Klagetöne ausstößt, im übrigen aber fast stumm ist, warnt seine Genossen bei Gefahr durch lautes Aufschlagen mit den Hinterläufen auf den Erdboden. Sobald dies Signal ertönt, fahren alle in der Nähe befindlichen Wildkaninchen zu Bau.
Unter den im allgemeinen stummen Fischen gibt es einige Arten, die Töne hervorbringen können, die ebenfalls keine Stimm-, sondern Instrumentallaute sind. Einige Welsarten Amerikas und der Knurrhahn bringen durch krampfartige Zusammenziehung der Muskeln im Innern ihres Körpers Geräusche hervor, die sich auf die äußere Wand der Schwimmblase übertragen, welche als Resonanzboden wirkt und den Ton verstärkt. Andere Fische erzeugen Töne durch Reibung der Kiemendeckelteile, der Zähne, der Schultergürtelknochen und der Flossenstacheln. Diese Geräusche lassen bei einigen Arten besonders die Männchen zur Fortpflanzungszeit hören, um die Weibchen anzulocken, woraus man[S. 115] meinte schließen zu können, daß nicht alle Fische taub sind, eine Annahme, die freilich noch der Bestätigung bedarf, da, wie schon an anderer Stelle gesagt wurde, die Wahrnehmung der Schallwellen auch durch den Wasserdruck auf die Seitenorgane erfolgen kann.
Unter den Lurchen finden wir bei den Fröschen bereits einen wohlentwickelten Kehlkopf mit Stimmbändern. Bei vielen Arten wird die Stimme noch durch ein besonderes Instrument, die Schallblasen, welche mit Luft angefüllt werden, verstärkt. Die Schallblasen liegen entweder innerlich, wie bei den Unken und Grasfröschen, oder sie treten äußerlich hervor, wie beim Laubfrosch und Wasserfrosch. Die Schallblasen des Laubfrosches liegen unter der Kehle und sind von einer gemeinsamen Haut überzogen, so daß die aufgeblähten Blasen wie eine große Kugel erscheinen. Beim Wasserfrosch treten die beiden Schallblasen durch besondere Schlitze an den hinteren Seiten des Kopfes hervor.
Unter den Reptilien ist die Klapperschlange wegen ihres an der Schwanzspitze sitzenden Rasselinstruments allgemein bekannt. Diese Klapper entsteht erst allmählich durch die wiederholten Häutungen der Schlange. Der Vorgang ist folgender: Die beiden letzten, verschmolzenen Schwanzwirbel sind mit einer hornartigen Kappe überzogen. Bei der Häutung streift sich diese Kappe nicht ab, sondern bleibt als Ring an der sich neu bildenden Hornhaut des Schwanzendes haften. Durch weitere Häutungen nimmt die Zahl der Ringe zu, die jedoch auch bei alten, erwachsenen Tieren meist nicht mehr als 12 beträgt und selten bis auf 21 anwächst, was die höchste bisher festgestellte Ringzahl ist. Der Prozeß scheint sich also nicht bei jeder Häutung, die mehrmals im Jahre stattfindet, zu wiederholen. Die einzelnen Hornringe sind gegeneinander beweglich und erzeugen durch schnelles Hin- und Herschwingen[S. 116] des Schwanzendes das Rasseln. Das Klappern geschieht nicht nur in der Erregung, wodurch es unter Umständen zum Warnsignal werden kann, sondern bezweckt in erster Linie die gegenseitige Anlockung der Geschlechter. Durch das Klappern verraten sich die Giftschlangen ihrem ärgsten Feind, dem Menschen, und tragen so unbewußt zu ihrer eigenen Vernichtung bei.
Die amerikanischen Klappschildkröten (Cinosternum) haben auf der Innenseite des Oberschenkels eine mit Hornhöckern besetzte Stelle. Durch Reibung dieser Gebilde können die Schildkröten einen zirpenden Ton hervorbringen.
Die Klappschildkröten führen ihren Namen nach der eigenartigen Verschlußvorrichtung ihres Panzers. Das Brustschild besteht aus drei Teilen, von denen der vordere und hintere Teil beweglich sind und an den Rückenpanzer angeklappt werden können, was den Tieren einen vorzüglichen Schutz gegen ihre Feinde gibt.
Ein eigenartiger Musikant ist der mittelasiatische Wundergecko. Der kleine Kerl bringt mit dem Schwanz zirpende Töne hervor, indem er die dachziegelartig übereinanderliegenden Hautschuppen aneinanderreibt. Durch sein Zirpen lockt der Gecko Heuschrecken an, die seine bevorzugte Nahrung bilden. „Er ergeigt sich“, wie Brehm treffend sagt, „seinen Lebensunterhalt.“ —
Das Zirpen der Heuschrecken im saftigen Wiesengras hat ja jeder schon gehört. Das Instrument, mit dem der kleine grüne Musikant die lieblichen Töne hervorbringt, befindet sich an den Hinterfüßen und den Flügeln. An der Innenseite der keulenartig verdickten Schenkel der Hinterbeine steht eine Reihe kleiner Zapfen, und die Flügel haben eine leistenartig vorstehende Ader. Durch Reiben der Zapfen an dieser Ader entsteht der zirpende Ton, der durch die als Resonanzboden wirkenden Flügel noch verstärkt wird. Die Tiefe und Höhe des Tons wechselt je nach der[S. 117] Schnelligkeit, mit der der Musikant die Geige spielt. Die Töne werden natürlich von den Heuschrecken selbst vernommen. Ihr Ohr sitzt aber nicht am Kopf, sondern am ersten Ring des Hinterleibes. Hier befindet sich auf jeder Seite ein Häutchen, das Trommelfell, das über einen Hohlraum gespannt ist, in dem der Hörnerv liegt.
Bei den Grillen erfolgt das Zirpen durch ein Aneinanderreiben beider Flügeldecken, die vorstehende Schrilladern besitzen.
Meister in der Tonkunst sind die Zikaden, die in über 1000 Arten die warmen Länder, besonders Asien bewohnen. Eine Art, die Bergzikade, kommt auch in Deutschland vor. Die Zikaden tragen einen komplizierten Singapparat am Hinterleibe, der aus zwei Trommelhäuten besteht, die durch starke Muskeln in Schwingungen versetzt werden. Hierdurch entstehen sehr laute, schrille Töne. Die Zikaden leben sehr gesellig im Gipfel der Bäume. Beginnt ein Männchen seinen Gesang, so stimmen alle übrigen ein, und der ganze Wald hallt plötzlich von einem tausendstimmigen Konzert wider, das, ebenso jäh wie es begann, nach kurzer Zeit verstummt, um bald wieder von neuem zu beginnen. So wechseln in der strahlenden Glut der Tropensonne brausender Gesang und unheimliches Schweigen stundenlang ab. Jede Art bringt besondere Töne hervor, die bald melodisch, bald gellend und unschön erklingen, so daß der Eindruck des Zikadenkonzerts außerordentlich verschieden sein kann. Hieraus erklärt sich auch die abweichende Beurteilung dieser Musik. Während Anakreon in seiner Ode die Zikaden preist mit den Worten:
beklagt sich Virgil über die „gellenden Töne“.
[S. 118]
Ebenso wie unser Maikäfer erscheint die Zikade in gewissen Zeitabständen in besonders großer Menge. In Nordamerika wiederholt sich der Zikadensegen alle 17 Jahre, eine andere im Süden der Vereinigten Staaten lebende Art hält eine Zeitfolge von 13 Jahren inne. —
Klopfende Töne, die in gleichmäßigen Abständen wiederholt werden und an das Ticken einer Uhr erinnern, bringen die Klopfkäfer hervor, indem sie mit dem Kopf gegen Holz schlagen, um sich gegenseitig von ihrer Anwesenheit zu verständigen und sich zusammenzufinden. Der Volksglaube betrachtet das unheimliche Klopfen der versteckt lebenden Käfer als Vorboten eines Trauerfalles und nennt daher den kleinen Störenfried „Totenuhr“. Die Larven bohren sich Gänge im trockenen Holz und verursachen die allbekannte Wurmstichigkeit der Möbel und Hausbalken.
Die Insekten vermögen zum Teil ganz gewaltige Kraftleistungen zu vollbringen, wie sie kein anderes Geschöpf auch nur annähernd ausführen kann. Der Floh ist imstande, mit seinen zu Springwerkzeugen gewordenen Hinterfüßen 1 m weite Sprünge auszuführen, das ist etwa das Tausendfache seiner Körperlänge! Auch besitzt der kleine Schelm eine geradezu übernatürliche Körperkraft, denn er vermag das Achtzigfache seines Gewichts zu ziehen.
Die Larven vieler Insekten, die im Holz leben, entwickeln geradezu fabelhafte Kräfte bei der Herstellung ihrer Gänge.
Der nur wenige Millimeter große Borkenkäfer bohrt sich durch die Rinde tief in den Stamm der Bäume hinein, um hier seine Eier abzulegen, eine Arbeit, die eine gewaltige Kraft verlangt.
Die höchste Kraftentfaltung finden wir bei den Holzwespen. Die Weibchen treiben ihren langen Legestachel tief in einen Baumstamm hinein, um hier die Eier unterzubringen. Die Larven fressen sich dann später immer weiter in das Holz, um sich zu verpuppen.[S. 119] Auch die ausgeschlüpften Holzwespen verbringen geradezu unerhörte Kraftanstrengungen, um aus dem Innern des Holzes ans Tageslicht zu gelangen. Kiefernholzwespen, welche im Holz von Kisten, in dem Artilleriemunition aufbewahrt wurde, zur Entwicklung gelangt waren, versuchten sich einen Weg ins Freie zu bahnen und fraßen dabei den harten Stahlmantel der Geschosse an.
Die Schnellkäfer (Elateridae) vermögen sich, wenn sie auf dem Rücken liegen, vermittels eines Dornes an der Unterseite der Vorderbrust, der in eine Grube der Mittelbrust hineinpaßt und wie eine Feder wirkt, in die Höhe zu schnellen. In der Luft dreht sich der Käfer um, so daß er mit dem Bauch zur Erde niederfällt und aus seiner hilflosen Rückenlage befreit wird. Dieser Schnellapparat ist für ihn ein wichtiges Werkzeug, da er wegen seiner kurzen Füße nicht imstande ist, sich aufzurichten, wenn er durch Zufall auf den Rücken gefallen ist.
Eine abenteuerliche Gestalt unter den Kerbtieren ist der Pfeilschwanzkrebs, der in mehreren Arten die Küsten des Atlantischen und Stillen Ozeans bewohnt. Mit ihrem eigentümlichen Körperbau haben die Pfeilschwanzkrebse ein wahrhaft vorsintflutliches Aussehen und sind auch im wahrsten Sinne des Wortes vorweltliche Tiere, denn nahe Verwandte, die fast dasselbe Aussehen hatten wie die heutigen Pfeilschwanzkrebse, lebten schon in der paläozoischen Erdperiode. Die heutigen Vertreter dieser Spinnenkerfe erreichen zwar nicht mehr die Riesengröße ihrer Vorfahren, die bis 2 m lang waren, haben aber immer noch die stattliche Körperlänge von ½ m. Der größte Teil des gepanzerten Tieres besteht aus dem ovalen Kopfbrustschild, an den sich der gleichfalls gepanzerte und mit Stacheln bewehrte Hinterleib anschließt. Der Körper trägt sechs Paare von Gliedmaßen. Das erste Paar sind kurze, scherenförmige Fühler, die anderen Paare dienen sowohl als Beine[S. 120] zur Fortbewegung wie als Kauorgane und sind zu diesem Zwecke mit besonderen Kauwerkzeugen ausgerüstet. Das merkwürdige Tier hat vier Augen, von denen zwei als kleine Punktaugen in der Mitte und zwei an den Seiten des Kopfschildes sitzen. Der Hinterleib trägt einen langen, sehr beweglichen Schwanzstachel. Dieser Schwanz ist ein sehr wichtiges Werkzeug für das Tier. Fällt der Pfeilschwanzkrebs beim Überklettern von Steinen auf den Rücken, so stemmt er den Schwanzstachel gegen den Boden und richtet sich durch die Hebelwirkung wieder auf, denn die kleinen, kurzen Füße sind nicht imstande, den schwerfälligen Körper umzuwenden.
Selbst die Kraft der Elektrizität haben die Tiere in ihren Dienst gestellt. Zitterwels, Zitteraal und Zitterrochen haben elektrische Batterien in ihrem Körper, mit denen sie starke Schläge austeilen können. Die elektrischen Organe bestehen aus einer Anzahl nebeneinanderliegender Platten, die aus umgewandelter Muskelsubstanz gebildet sind, und einem Gewebe, das zwischen den einzelnen Platten eingeschaltet ist. Es entspricht der Apparat dem Kupfer und Zink der Voltaschen Säule. Die elektrische Batterie steht mit dem Nervensystem in Verbindung, durch das die Entladung ins Werk gesetzt wird. Die elektrischen Schläge folgen sich sehr schnell. Beim Apparat des Zitteraals erfolgen 200–300 Entladungen in der Sekunde, die eine Stärke von 300 Volt haben. Der Fisch kann die Stärke und Zahl der Entladungen willkürlich bemessen. Die Kraft nimmt jedoch beim Gebrauch erheblich ab und erreicht erst nach längerer Ruhe wieder die volle Höhe. Der Zitteraal vermag durch seine sehr kräftigen Schläge große Tiere, sogar den Menschen zu betäuben.
Die elektrischen Organe dienen dazu, Beutetiere zu betäuben oder zu töten, und sind zugleich ein vorzügliches Abwehrmittel in[S. 121] Gefahr. Ihre Lage am Körper ist verschieden. Beim Zitteraal befinden sie sich unter dem Schwanz, beim Zitterwels umhüllen sie wie ein Mantel fast den ganzen Leib und beim Zitterrochen liegen sie hinter den Kiemen. Die einzelne Batterie des Zitteraals besteht aus 6000 Platten. —
Vielen Tieren gab die Natur Vorrichtungen, die ganz besonderen Zwecken dienen, Apparate und Instrumente, die für die Lebensweise von entscheidender Bedeutung wurden.
Das Walroß trägt im Oberkiefer zwei gewaltige Eckzähne, die senkrecht nach unten stehen und über den Unterkiefer weit herausragen. Sie erreichen beim erwachsenen Tier ein Gewicht von 3 kg und eine Länge von ¾ m. Diese Stoßzähne dienen den Bewohnern der Eisregion des hohen Nordens als Eisbrecher, um sich einen Weg durch das Treibeis zu bahnen. Ferner benutzen die Walrosse ihre Zähne als Stütze beim Erklettern der Eisblöcke, und schließlich sind die Zähne beim Nahrungserwerb von großem Nutzen. Die Nahrung des Walrosses besteht aus Krebstieren, Mollusken und anderen niederen Lebewesen des Meeres. Mit den Zähnen wühlt das Walroß den Schlamm an der Küste und im Meeresgrund auf, um die hier befindlichen Tiere hervorzuholen, die dann mit Hilfe der starken Schnauzborsten zusammengefegt und eingeschlürft werden. Das Walroß gehört zu den größten der heute lebenden Säugetiere. Es erreicht eine Länge von 4,5 m mit einem Leibesumfang von 3 m und ein Gewicht bis zu 1000 kg.
In früherer Zeit dehnte sich das heute ausschließlich auf den höchsten Norden beschränkte Verbreitungsgebiet nach Süden bis zu den Küsten Schottlands und Norwegens aus. Auf der Bäreninsel war das Walroß vor 100 Jahren noch so zahlreich, daß die Fänger auf einem Jagdzuge manchmal viele Hundert dieser Tiere erbeuteten. Heute kommt das Walroß hier nicht mehr vor, und[S. 122] auch auf Spitzbergen ist es fast ganz verschwunden. Menschlicher Unverstand und Habgier haben auch hier einmal wieder in unverantwortlicher Weise gewütet!
Die beiden mächtigen Stoßzähne des Elefanten, die das so begehrte Elfenbein liefern, sind die verlängerten, einzigen Schneidezähne. Sie besitzen keine Wurzeln, sondern sind unten offen und haben wie die Schneidezähne der Nagetiere ein unbegrenztes Wachstum. Wenn die Stoßzähne in erster Linie auch nur ein sekundäres Geschlechtszeichen sind, da sie den Weibchen häufig fehlen und, wenn sie vorhanden sind, stets bedeutend kleiner und schwächer bleiben, so haben sie doch anderseits eine nicht zu unterschätzende Bedeutung als Instrument. Der männliche Elefant schlitzt mit ihnen die Stämme hoher Bäume auf, um sie zu Fall zu bringen, wenn er sie nicht niedertreten kann, und um auf diese Weise zu dem begehrten Laub des Wipfels zu gelangen. Außerdem löst er mit den Stoßzähnen die Rinde ab, um den ausfließenden Saft des Kernholzes zu genießen, und gräbt Knollen und Wurzeln aus der Erde. Bei diesen Arbeiten bedient sich der Elefant vorzugsweise des linken Stoßzahnes, der infolgedessen häufig bedeutend mehr abgenutzt ist als der rechte. Als Waffe scheinen die Stoßzähne weniger gebraucht zu werden. Brunftige Männchen, die um den Besitz eines Weibchens kämpfen, umfassen sich mit dem Rüssel und suchen sich mit dem Gewicht ihres Körpers zu Fall zu bringen oder zu verdrängen.
Ein anderes wichtiges Organ des Elefanten ist die zum Rüssel umgebildete Nase. Der Rüssel ist zunächst ein Schlauch, mit dem der Elefant sein Getränk einsaugt, um es dann ins Maul zu spritzen. Der Rüssel eines großen Elefanten vermag 10 Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Ferner ist der Rüssel mit seinen beiden fingerartigen Endgliedern ein vorzügliches Greiforgan, das mit[S. 123] einem feinen Tastgefühl ausgestattet ist. Mit den Fingern vermag der Elefant kleinste Gegenstände vom Erdboden aufzunehmen. Reißt er Äste von Bäumen herunter, so umschlingt er sie mit dem Rüssel in mehreren Windungen.
Das Nashorn benutzt sein gewaltiges Horn auf der Nase als Standhauer und Axt. Im dichtesten Dorngestrüpp, gegen dessen Verletzung es durch seinen borkigen Hautpanzer geschützt ist, bahnt es sich schnell und sicher einen Weg, indem es die Zweige mit dem Horn zur Seite schlägt. Auch zum Ausroden von Sträuchern wird das Horn gebraucht, um zu den Wurzeln, die eine Lieblingsnahrung dieses Dickhäuters bilden, zu gelangen. Größere Bäume werden mit dem Horn aus dem Erdreich herausgehoben. So dient das Horn als Stemmeisen, Grabscheit, Axt und Beil.
Nach dem fast 1 m langen, doppelschneidigen, sehr scharfen Schwert, das der Schwertfisch an der oberen Kinnlade trägt, hat dies kampfesmutige Ungeheuer des Meeres seinen Namen erhalten. Der Schwertfisch (Xiphias gladius), der eine Körpergröße von 2–3 m erreicht, bewohnt alle Meere, jedoch vorzugsweise in den wärmeren Breiten. Mit seiner gefährlichen Waffe schlachtet er wie ein Scharfrichter seine Opfer ab. Er schwimmt in einen dicht gedrängten Fischschwarm hinein, schlägt mit Gewalt nach allen Seiten mit dem Schwert umher und tötet so eine große Anzahl der Fische. Die Kraft des Schlages und die Schärfe der Waffe ist so groß, daß die Fische häufig ganz durchschnitten werden. Ist die Zahl der Opfer groß genug, dann hält der grausame Wüterich seine Mahlzeit. Die fürchterliche Waffe hat den Charakter des Tieres verdorben, das von Mordlust und geradezu sinnloser Bosheit erfüllt ist. Es läßt seine Wut auch an anderen größeren Lebewesen aus, die ihm nicht zur Nahrung dienen. So greift der Schwertfisch ohne weiteres Walfische an, die ihm zu nah[S. 124] kommen, und verletzt sie mit dem scharfen Schwert in bedenklicher Weise. Badende Menschen sind schon vom Schwertfisch durchstochen worden, ja kleinere Schiffe wurden durch den Dolchstoß seines Schwertes zum Sinken gebracht. Es ist nichts Ungewöhnliches, daß bei der Ausbesserung größerer Überseeschiffe das abgebrochene Schwert eines solchen Fisches im Schiffsrumpf gefunden wird — ein Zeichen, mit welcher Wucht der Fisch seine Waffe gebraucht, und wie groß deren Schärfe ist (Abbildung 9).
Ein würdiges Seitenstück zum Schwertfisch ist der etwa 5 m lange Sägefisch, der in mehreren Arten in allen Weltmeeren warmer Zonen lebt. Der Oberkiefer trägt einen etwa 1,5 m langen schmalen Fortsatz, der an beiden Seiten mit scharfen Hautzähnen besetzt ist und wie eine Doppelsäge aussieht. Mit dieser fürchterlichen Waffe soll der Fisch anderen großen Fischen, sogar Walen den Leib aufschlitzen. Sonst ist über seine Lebensweise noch wenig bekannt.
Da wir einmal bei eigentümlichen Fischformen angelangt sind, so soll auch der sonderbare Hammerfisch nicht unerwähnt bleiben. Der Kopf dieses Haifisches hat die Gestalt eines wagerecht gehaltenen Hammers, dessen Stiel der Halsansatz bildet. Auf jedem Ende des Hammers sitzt ein Auge. Einen besonderen Zweck scheint diese höchst eigentümliche Kopfform nicht zu haben. Sie ist vielmehr eine Laune der Natur, die diese Fische bereits in der Kreidezeit erschaffen hat. —
Der Walfisch kann infolge seines engen Schlundes nur kleine Fische von der Größe des Herings verschlucken. Das gewaltige Tier braucht aber sehr viel Nahrung. Da hat die schöpferische Kraft dem Tier in sehr sinnreicher Weise geholfen. Sie gab ihm ein gewaltiges Maul, mit dem der Wal imstande ist, eine große Anzahl Fische auf einmal aufzuschnappen, wofür besonders die Züge[S. 125] der Heringe, die zu Millionen in dichtgedrängter Masse dahinschwimmen, eine willkommene Gelegenheit bilden. Beim Schließen des Mauls wird eine bedeutende Wassermenge mit aufgenommen. Um das Wasser abfließen zu lassen, ohne die Fische dabei zu verlieren, besitzt das Walfischmaul besondere Einrichtungen, die als Seihapparat wirken. Die Kiefer sind bei den Zahnwalen mit einer Reihe dichtstehender Zähne besetzt, durch deren Zwischenräume das Wasser abfließt, ohne daß die Fische hindurchgleiten können. Andere Wale haben anstatt der Zähne sogenannte Barten in den Kiefern, sichelförmige Hornplatten, mit fein gefasertem Rand, die wie ein feinmaschiges Netz wirken, durch das das Wasser abläuft. Diese Wale heißen zum Unterschiede von den Zahnwalen „Bartwale“.
Auch der Schnabel mancher Wasservögel ist zum Seihapparat geworden. Bei den Schwänen, Gänsen und Enten stehen an den Außenkanten des Schnabelüberzugs feine zahnartige Gebilde, durch welche ebenso wie bei den Walen das Wasser bei der Nahrungsaufnahme abfließt. Sogar die Zunge dieser Vögel ist mit Fransen ausgestattet, die die Nahrung vor dem Verschlucken noch einmal durchsieben.
Bei den Vögeln vertritt der Schnabel oft die Stelle eines besonderen Werkzeuges, das für den Lebensunterhalt von Wichtigkeit ist.
Der dünne, feingebogene Schnabel des Baumläufers stellt eine Sonde dar, mit der der Vogel in die feinsten Ritzen der Baumrinde eindringen kann, um verborgene Kerfe hervorzuholen.
Der harte, scharfkantige Schnabel der körnerfressenden Singvögel, besonders der Kernbeißer, wirkt als Kneifzange, mit der der Vogel die Hülsen hartschaliger Sämereien aufknackt. Der[S. 126] Kirschkernbeißer ist sogar imstande, mit seinem massigen Schnabel Kirschkerne zu zertrümmern.
Die Schnepfe gebraucht ihren langen, nervenreichen Stecher als Pinzette und holt damit Würmer aus der Erde, indem sie den Schnabel hineinbohrt. Um die Nahrung leicht erfassen zu können, ohne den ganzen Schnabel öffnen zu müssen, was infolge des Widerstandes der Erde größere Kraft verlangen würde, besitzt die Schnepfe die Fähigkeit, nur das vordere Ende des Schnabels unabhängig von dem übrigen Schnabelteil öffnen und schließen zu können. Bei der frisch erlegten Schnepfe läßt sich diese eigenartige Beweglichkeit des Schnabels durch einen seitlichen Druck mit den Fingern gegen den Kopf leicht hervorrufen.
Der Kreuzschnabel besitzt in seinen kreuzweise übereinanderliegenden Schnabelhälften ein praktisches Instrument zum Öffnen der Tannenzapfen. An diesen eigentümlichen Vogel mit seiner wechselnden Gefiederfarbe, der sogar im Winter bei Frost und Schnee zur Brut schreitet, knüpfen sich allerhand Sagen und Märchen. Man glaubte früher, daß das Wasser, das durch den Kot des Vogels verunreinigt ist, ein unfehlbares Heilmittel gegen Fallsucht und Krämpfe sei, und zwar sollten die Vögel, bei denen die Hakenspitze des Oberschnabels rechts neben dem Unterschnabel liegt, die Krankheiten der Männer, die Linksschnäbler dagegen die Krankheiten der Frauen heilen. In einsamen Gebirgsdörfern, wo der Kreuzschnabel ein beliebter Käfigvogel ist, mag noch heute dieser Aberglaube Geltung haben.
Beim amerikanischen Hakenweih (Rostrhamus sociabilis) bildet die Spitze des Oberschnabels einen langen, nach unten gebogenen Haken, der weit über den Unterschnabel reicht. Die Nahrung dieses unserem Bussard nahestehenden Raubvogels besteht aus Schneckenleibern. Der Vogel lauert der kriechenden[S. 127] Schnecke auf und stößt den Haken des Schnabels durch ihren Körper dicht vor dem Gehäuse, wodurch die Schnecke verhindert wird, sich einzuziehen. Dann reißt er die Schnecke aus dem Gehäuse heraus und verzehrt sie.
Der sehr große, unförmige, aber dünnwandige und leichte Schnabel der Tukane ist eine Fruchtpresse, die den Vögeln beim Verzehren von Früchten gute Dienste leistet (Abbildung 10).
Ein vielseitiges Instrument ist der Papageischnabel. Der gekrümmte Oberschnabel läuft in eine den Unterschnabel überragende, gebogene Spitze aus und trägt häufig auf jeder Seite einen zahnartigen Ansatz, der in eine entsprechende Vertiefung des Unterschnabels hineinpaßt. Der dicke, breite, nach unten gewölbte Unterschnabel hat vorn eine breite, ausgeschweifte Kante, deren Enden in hochstehende Spitzen auslaufen. Mit diesem Werkzeug kann der Papagei Unglaubliches leisten. Er benutzt es als Zange, Bohrer und Schraubenzieher. Immer wieder muß man staunen, was für Zerstörungen ein großer Papagei, besonders ein Kakadu, vollbringen kann. Dicker Draht wird durchkniffen, Eisenblech durchlöchert und zernagt, das härteste Holz in kurzer Frist zersplittert. Die Gebrauchsfertigkeit des Schnabels wird noch dadurch erhöht, daß der Oberschnabel durch ein zwischen ihn und den Schädel eingeschaltetes Scharnier sehr beweglich ist, im Gegensatz zu anderen Vögeln, bei denen der Oberschnabel mit dem Schädel fest verwachsen ist. Die Papageien vermögen mit ihrem kräftigen Schnabel sehr schmerzhafte und nicht ungefährliche Bißwunden beizubringen. Eine Arara kann mit ihrem mächtigen Schnabel mit einem Biß die Handknochen zertrümmern. Die gewaltige Wirkung des Schnabels zeigt sich am besten darin, daß die großen Araras imstande sind, die eisenharte Schale der Paranüsse aufzuknacken.
[S. 128]
Bei den zierlichen, bunt gefärbten Honigsaugern Afrikas, die nicht zu den Kolibris, sondern zu den Singvögeln gehören, ist die Zunge mit ihren einwärts gebogenen Rändern zum Saugschlauch geworden, mit dem die Vögel den Nektar aus den Blüten schlürfen.
Die Loris, kleine bis mittelgroße, sehr bunt gefärbte Papageien, die Australien und die umliegenden Inseln bewohnen, haben eine Pinselzunge, d. h. ihre Zunge trägt am vorderen Ende einen Büschel haarartiger Borsten, mit denen die Vögel den Saft der Blüten und Früchte auftutschen.
Auf Neuguinea lebt ein riesengroßer, tiefschwarzer Kakadu mit nacktem, rotem Gesicht und breitem Federbusch auf dem Kopfe. Seine rote, walzenförmige, fleischige Zunge ist ausgehöhlt, und die Ränder können nach innen umgebogen werden. Mit diesem „Löffel“ befördert der absonderliche Vogel die mit dem gewaltigen Schnabel zerkleinerte Nahrung, die hauptsächlich aus Nüssen besteht, in die Speiseröhre.
Der Ararakakadu hat eine schnarrende Stimme, die an das Knarren einer Tür erinnert und von dem üblichen Kreischen der anderen Papageien völlig abweicht. Der Vogel hat in seinem gewaltigen Schnabel eine Riesenkraft. Gefangene zerbeißen Futtergefäße aus gebranntem Ton, dickem Porzellan, ja sogar aus Gußeisen mit Leichtigkeit. Nur ganz schwere schmiedeeiserne Geschirre leisten seiner Zerstörungswut Widerstand.
Der Schnabel der Spechte mit der vorn abgeschnittenen, aber scharfen Kante ist ein regelrechter Meißel, mit dem die Vögel festes Kernholz durch kräftige Schläge zersplittern können. Als Höhlenbrüter nisten sie nicht in natürlichen Baumhöhlen, sondern meißeln sich ihre birnenförmigen Bruthöhlen in die Baumstämme und schaffen hierdurch anderen Höhlenbrütern, wie Hohltaube, Wiedehopf und Blaurake, passende Niststätten.


[S. 129]
So finden wir überall im Tierleben eine mannigfache Technik. Die Gliedmaßen und Organe sind zum Teil zu Instrumenten geworden, wie sie menschlicher Erfindungsgeist zur Ausübung der Kunst, für die Forschung in der Wissenschaft und zum Handwerk ersann. Die Natur gab den Tieren diese technischen Hilfsmittel zur Erfüllung ihrer Lebensaufgaben und ihrer Daseinsnotwendigkeiten, damit sie den Kampf des Lebens siegreich bestehen, bis die Kräfte erlahmen und des Lebens Kreislauf sich schließt, um neuen Generationen Platz zu machen, die vielleicht dereinst in Anpassung an veränderte Lebensbedingungen, die Erdumwälzungen hervorrufen, in fortschreitender Entwicklung eine andere Technik des Lebens erwerben.
[1] Friedrich von Lucanus, Das Leben der Vögel. Verlag August Scherl, Berlin 1925.
[S. 130]
Die Lust zum Wandern ist nicht allein eine uralte, tiefeingewurzelte Eigenschaft des Menschengeschlechts, sondern sie tritt in noch höherem Maße in der Tierwelt auf.
Alljährlich im Herbst und Frühjahr begeben sich unsere Zugvögel auf die weite Wanderschaft, die sie von Erdteil zu Erdteil führt. Gewaltige Strecken werden auf dieser Luftreise durchflogen. Kuckuck, Schwalben, Segler, Nachtigall, Pirol und viele andere Vögel suchen das tropische Afrika als Winterherberge auf. Freund Adebar dehnt sogar seine Reise bis über den Äquator hinaus aus und überwintert im südlichen Afrika, in der englischen Kapkolonie und den früheren Burenstaaten, wo die dort zahlreich auftretenden Heuschrecken, die eine gewaltige Plage des Landes sind, ihm zur Nahrung dienen. Vielleicht bilden die Heuschrecken die Ursache zu dieser weiten Wanderung der Störche.
Ganz gewaltige Reisen vollbringen die Regenpfeifer und Strandläufer, die das arktische Gebiet der Alten und Neuen Welt bewohnen. Sie ziehen aus ihrer zirkumpolaren Heimat bis Südafrika, Südamerika und Indien und überfliegen zum Teil nicht weniger als 133 Breitengrade, was eine Entfernung von etwa 15000 km bedeutet! Diese weite Strecke legen die Vögel zweimal im Jahre, auf dem Herbstzug und auf dem Frühjahrszug, zurück! Das sind gewaltige Flugleistungen, die aber noch von einer Vogelart, der Küstenseeschwalbe (Sterna paradisea), übertroffen werden. Die Küstenseeschwalbe ist von allen Vögeln am weitesten nach Norden vorgedrungen. Ihr Brutgebiet reicht[S. 131] bis zum 82. Grad nördl. Br. Von hier zieht sie nach den Berichten amerikanischer Ornithologen bis zum südlichen Eismeer, um dort zu überwintern. Sie überfliegt also zweimal jährlich den ganzen Erdkreis.
Auf diesen weiten Wanderungen nehmen sich die Vögel freilich Zeit. Sie fliegen in kleineren Etappen, die täglich etwa 200 bis 300 km betragen, und brauchen mehrere Wochen, bis sie am Ziel sind. Die alte Annahme, daß die Zugvögel mit gewaltiger Geschwindigkeit reisen, die sie in wenigen Stunden über ganze Erdteile trägt, ist durch die neueren Forschungen widerlegt worden und gehört in das Reich der Fabel.
Andere Vögel, wie z. B. die kleineren Singvögel, reisen noch langsamer. Durch die Vogelberingung, die heute unser bestes Mittel zur Erforschung des Vogelzuges ist, wurde nachgewiesen, daß Stare, Drosseln und Rotkehlchen nur 30–60 km täglich zurücklegen.
Durch Messungen der Fluggeschwindigkeit ziehender Vögel wurde festgestellt, daß sie auf dem Wanderfluge etwa die Schnelligkeit eines Eilzuges entwickeln, also ca. 60–70 km in der Stunde.
Die viel umstrittene Frage, ob die Vögel auf ihren Wanderungen bestimmten, gesetzmäßig festliegenden Zugstraßen folgen, ist durch die Vogelberingung dahin geklärt worden, daß manche Vogelarten zweifellos solche Zugstraßen haben, andere dagegen nicht, sondern auf dem Zuge sich fächerförmig über den Erdteil verteilen, nur einer allgemeinen Richtung folgend. Man spricht in letzterem Falle vom Zuge in „breiter Front“. Ein Vogel, der ganz bestimmte Zugstraßen innehält, ist der weiße Storch. Die Beringung von Störchen hat ergeben, daß die Brutvögel aus Mittel- und Osteuropa im Herbst über den Balkan, die Dardanellen, Kleinasien, Syrien, Palästina und den Suezkanal nach Afrika ziehen, während[S. 132] die westlichen Vögel ihren Weg über Frankreich, Spanien und Gibraltar nehmen. Die Grenze zwischen diesen beiden Zuggebieten bildet die Weser. Beim Zug des Storches ist es also vollauf berechtigt, von „Zugstraßen“ zu sprechen, die freilich nicht auf engen, schmalen Linien verlaufen, sondern eine breite Ausdehnung haben, die z. B. auf dem Balkan und in Kleinasien ca. 200–400 km beträgt.
Viele Vögel scheinen auf ihrem Zuge durch die Sahara den Tarso- und Tassili-Gebirgen zu folgen. Diese Zugstraße ist noch breiter, sie hat eine Ausdehnung von etwa 1000 km. Gleichwohl kann man auch hier noch von einer Zugstraße sprechen, denn sie hebt sich als fest begrenzter Abschnitt aus dem großen Wüstengebiet der Sahara heraus, das in seiner Gesamtausdehnung eine Breite von ca. 5000 km besitzt.
Mit dem Begriff „Zugstraße“ dürfen wir also keine schmale Linie verbinden, sondern die „Zugstraße“ charakterisiert nur die Zugbewegung auf einer enger begrenzten Fläche innerhalb eines größeren zu Gebote stehenden Raumes. Wird dieser Raum in seiner ganzen Breite überflogen, dann sprechen wir vom Zuge in „breiter Front“.
Über die Bezeichnungen „Zugstraße“ und „breite Front“ im Problem des Vogelzuges ist in unserer ornithologischen Literatur schon so viel Verwirrung angerichtet worden, daß es mir notwendig erschien, diese Begriffe hier näher zu erläutern. —
Die Entstehung des Vogelzuges müssen wir auf die Eiszeit und den durch sie hervorgerufenen Wechsel der Jahreszeiten zurückführen. Solange noch gleichmäßig warmes, tropenartiges Klima in unseren Breiten herrschte, fanden die Vögel während des ganzen Jahres geeignete Lebensbedingungen in ihrer nördlichen Heimat. Dies änderte aber die Eiszeit mit ihren klimatischen Umwälzungen.[S. 133] Viele Vögel wurden durch das kalte Klima allmählich aus ihrer Heimat verdrängt und siedelten sich im Süden unter dem Äquator an, wo die Unwirtlichkeit der Eiszeit sie nicht berührte. Später, nach dem Rückgang der Eiszeit, erfolgte dann von neuem eine Ausbreitung von Süden nach Norden, wo die Vögel im Sommer wieder geeignete Lebensbedingungen fanden. Der Winter zwang aber die Vögel, in das warme Tropenklima zu flüchten, um dann im Frühjahr zum Brüten wieder nach dem Norden zurückzukehren. Mit Berechtigung kann man fragen: Warum blieben die Vögel nicht in ihrer südlichen Heimat, die ihnen zu allen Jahreszeiten die besten Lebensbedingungen spendete, und weshalb nahmen sie die Schwierigkeit und Unbequemlichkeit der Wanderung auf sich? Wenn wir auch bei der Beantwortung dieser Frage lediglich auf Spekulation angewiesen sind, so geht man vielleicht nicht fehl, die Ausbreitung des Brutgebiets nach Norden auf eine Übervölkerung der Vögel in der tropischen Zone zurückzuführen, wo sich die Vögel zur Eiszeit in großen Massen zusammendrängten. Außerdem wohnt vielen Vogelarten eine ausgesprochene Neigung inne, ihr Brutgebiet dauernd zu vergrößern. Auch heute können wir solche Verschiebungen in der Vogelwelt beobachten. So dehnt z. B. der Girlitz beständig sein Wohngebiet nordwärts aus.
Der Girlitz, der ja nur eine geographische Rasse des wilden Kanarienvogels ist und infolgedessen nach der ternären Nomenklatur den Namen Serinus canaria serinus L. führt, war ursprünglich ein Bewohner des subtropischen Klimas der Mittelmeerländer. Von hier breitet er sich ständig nach Norden aus. Vor etwa 300 Jahren war er bis Süddeutschland vorgedrungen und bereits bei Frankfurt a. M. ein häufiger Brutvogel, wonach er damals „Frankfurter Vögelchen“ genannt wurde. Heute ist er[S. 134] bereits in der Mark Brandenburg, in Pommern, Schlesien und dem westlichen Polen eingewandert und in neuerer Zeit sogar in Schweden festgestellt worden. Die Singdrossel, die zu Linnés Zeiten in Skandinavien noch unbekannt war, singt ihr Lied bereits unter dem 60. Grad nördl. Br. Ähnliche Beispiele ließen sich noch für viele andere Vogelarten anführen.
Die Eiszeit mag nicht alle Vögel aus dem Norden verdrängt haben. Sie war wohl kaum so unwirtlich, daß nicht einige Arten mit kräftiger und widerstandsfähiger Natur in den kurzen Sommermonaten hier ausharren konnten. Nur der Winter zwang sie, vorübergehend im Süden ihren Aufenthalt zu nehmen. So entwickelte sich auch bei ihnen die Eigenschaft des Ziehens unter der klimatischen Umwälzung der Eiszeit.
Alle Vögel, die auf der Suche nach einer geeigneten Winterherberge eine unzweckmäßige Richtung einschlugen, gingen zugrunde, während diejenigen Individuen, die in Gegenden gelangten, die von der Vereisung unberührt geblieben waren, den Winter überstanden und im Sommer zum Brüten in die Heimat zurückkehren konnten. So wurde im Laufe der Zeit durch natürliche Zuchtwahl ein Vogelstamm herangezüchtet, bei dem der Zug, und zwar der Zug in eine bestimmte Richtung, eine regelmäßige Lebenserscheinung wurde, die sich allmählich zu einer erblichen Anlage verankerte. Somit wäre der Vogelzug ein Beweis für die Erblichkeit erworbener Eigenschaften, die bekanntlich von manchen Forschern in Abrede gestellt wird. Daß die Zugbewegung heute bei vielen Vögeln eine erbliche Veranlagung ist, läßt sich mit Sicherheit nachweisen. Storch, Kuckuck, Wiedehopf, Pirol, Segler und andere Vögel verlassen uns bereits im Hochsommer, im August, also zu einer Zeit, wo von einer Temperaturabnahme oder Nahrungsmangel noch keine Rede ist. Es kann also nur ein[S. 135] innerer, periodisch erwachender Trieb sein, der den Fortzug veranlaßt. Ferner zeigen Nachtigall, Grasmücke, Würger und viele andere Zugvögel in der Gefangenschaft sowohl im Frühjahr wie im Herbst eine starke Unruhe, die den Vogel rastlos im Käfig umherflattern läßt. Es ist der angeborene Zugtrieb, der in ihnen erwacht, und den sie durch ihre Unruhe befriedigen müssen.
Bei anderen Vögeln, wie z. B. den nordischen Enten und Tauchern, kommt der Zugtrieb weniger zur Geltung. Sie verlassen ihre Heimat erst dann, wenn die Vereisung im Winter ihre Lebensbedingungen unterbindet. Ihre Wanderungen sind also nur ein Ausweichen nach eisfreien Gebieten und werden nicht durch einen inneren, angeborenen Trieb, sondern durch äußere klimatische Einflüsse hervorgerufen.
Die Zugvögel wandern teils des Nachts, teils am Tage, viele Arten sowohl in der Nacht wie am Tage. Ausgesprochene Tagwanderer sind die meisten Raubvögel, die Raben und Störche, während Singvögel, schnepfenartige Vögel und Regenpfeifer fast ausschließlich oder vorwiegend die Nacht zu ihren Reisen wählen. In finsteren Nächten werden die Vögel bei ihrem Fluge über die See durch den Lichtschein der Leuchttürme angelockt. Mit rasender Gewalt fliegen sie gegen die hellen Fenster des Leuchtfeuers und stoßen sich den Kopf ein. Hunderte von Vogelleichen bedecken dann am folgenden Morgen den Erdboden in der Umgebung der Leuchttürme. Leider ist es bisher noch nicht gelungen, wirksame Abwehrmaßnahmen gegen diesen traurigen Vogelmord zu treffen. Alle Versuche, die man gemacht hat, blieben erfolglos.
Viele Raubvögel, der Kuckuck, der Wiedehopf und andere Arten ziehen einsam nach dem fernen Süden, andere Vögel vereinigen sich zu größeren oder kleineren Scharen. Kraniche und[S. 136] Störche versammeln sich vor dem Fortzug zu Hunderten und Tausenden an bestimmten Plätzen.
Kraniche, Gänse, Enten, Schwäne, Regenpfeifer und andere Vögel bilden auf dem Zuge einen Winkel oder Keil. Sie gruppieren sich in zwei Linien, die sich vorn in einem spitzen oder stumpfen Winkel schneiden. Die Vögel fliegen hierbei nicht hintereinander, sondern jeder Vogel überragt seinen Vordermann nach außen. Es findet also eine seitliche Staffelung statt. Man meint, daß die Keilform des Wanderfluges den Vögeln die Überwindung des Luftwiderstandes erleichtert, indem der von den Vögeln gebildete Keil, als aeromechanisch untrennbares Ganzes aufgefaßt, wie ein Luftschiff die Luft durchschneidet. Austernfischer, Brachvögel und Ibisse bilden auf dem Zuge keinen Keil, sondern eine breite Front, indem die Vögel in einer breiten Linie nebeneinander fliegen. Im Gegensatz zur Winkelform ist diese breite Linie, als einheitliches Ganzes aufgefaßt, für die Überwindung des Luftwiderstandes gerade ungünstig, denn ein breiter Körper überwindet den Luftwiderstand schwerer als ein spitzer. Hier versagt also die für den Winkelflug gegebene Erklärung. Infolgedessen sind andere Forscher der Ansicht, daß man diese Fluganordnungen der Zugvögel nicht als ein einheitliches Ganzes ansehen darf, sondern daß die Flugleistungen der einzelnen Vögel in Betracht gezogen werden müssen. Jeder Vogel erzeugt beim Fliegen einen aufwärtssteigenden Luftstrom, der dem Nebenmann zugute kommen soll, da er sich der Fluggeschwindigkeit überlagert, eine Abnahme des Fortbewegungswiderstandes hervorruft und somit eine Verminderung der Flugarbeit zur Folge hat.
Dieser Vorteil des durch den Nebenvogel erzeugten aufwärtssteigenden Luftstroms, der sich auf Grund der Prandtlschen Aeroplantheorie nachweisen läßt, kommt in erster Linie bei der einreihigen[S. 137] Flugordnung der Austernfischer, die dicht nebeneinander fliegen, zur Geltung. Dagegen erscheint es recht zweifelhaft, ob dies auch für den Winkelflug Gültigkeit hat. Hier sind die Vögel, die in den beiden benachbarten Linien nebeneinander fliegen, so weit getrennt, daß die Wirkung der Luftströme kaum noch zur Geltung kommen kann. Es ist daher recht zweifelhaft, ob diese Erklärungen für die Flugordnungen der Zugvögel das Richtige treffen.
Bei dem Winkelflug folgen sich die Vögel, die auf derselben Seite fliegen, nicht auf Vordermann, sondern sie sind seitlich gestaffelt. Hierdurch hat jeder Vogel die Front frei und ist infolgedessen davor geschützt, auf seinen Vordermann aufzuprellen, wenn dieser die Fluggeschwindigkeit verkürzt. Dasselbe ist in noch größerem Maße der Fall beim Zuge in einer geraden Linie, wo jeder Vogel ein völlig freies Gesichtsfeld hat. Wenn man also für die Erklärung der Flugformationen von der aerodynamischen Wirkung absieht, so kann vielleicht diese rein äußerliche Ursache für die Bildung der Flugformen von Bedeutung sein, die die Vögel vor dem Zusammenstoß schützt.
Junge Enten folgen im Schwimmen auf dem Wasser ihrer Mutter meist ebenfalls in Winkelform, oder sie bilden eine schräge Linie, wobei ebenfalls eine Stafflung nach außen stattfindet. Die Stafflung hat hier zweifellos den Zweck, das Gesichtsfeld der Vögel frei zu machen. Diese suchen ihre Nahrung, die in Mückenlarven und Wasserinsekten besteht, während des Schwimmens auf der Oberfläche des Wassers. Würden nun die jungen Enten hintereinander schwimmen, so würde der vorderste Vogel alle Nahrung fortschnappen, während die nachfolgenden Enten das Nachsehen hätten. Hier ist also der Zweck der Winkelform oder der schrägen Linie mit einer Stafflung nach außen völlig ersichtlich.[S. 138] Die Formationen dienen hier lediglich dem freien Gesichtsfeld.
Nur wenige Vögel bilden auf dem Zuge derartige Flugordnungen. Die meisten ziehen in großen, wolkenartigen Schwärmen, und trotzdem herrscht hier eine bewundernswerte Disziplin. Da fliegt eine große Schar nordischer Leinzeisige in dichtgedrängter Masse dahin. Wie auf Kommando schwenken die Vögel plötzlich ab und führen die schärfsten Wendungen aus, ohne daß ein Zusammenprallen erfolgt. Trotz der rasenden Geschwindigkeit, die einem Eilzuge gleichkommt, macht jeder Vogel genau in demselben Augenblick die gleiche Wendung, ohne daß unter den nach Hunderten und Tausenden zählenden Vögeln eine Verwirrung entsteht, ohne daß der Schwarm sich lockert oder auflöst. Da steht man vor einem Rätsel, dessen Lösung noch völlig in Dunkel gehüllt ist. —
Die Vogelberingung hat die Richtigkeit der schon von älteren Ornithologen ausgesprochenen Vermutung, daß in Europa der Herbstzug weniger nach Süden als nach Westen und Südwesten gerichtet ist, vollauf bestätigt. Diese westliche Zugrichtung können wir als eine nach dem milden Klima des Atlantischen Ozeans verlaufende Zugbewegung ansehen. An der Festlandsküste verhindert dann das Weltmeer die Fortsetzung des westlichen Fluges. Die Vögel biegen nach Süden ab, um über Gibraltar Afrika zu erreichen. Die Vögel des nördlichen Europa folgen auf ihrem westlichen Zuge mit Vorliebe den Küsten der Ost- und Nordsee. Außer dieser „Westlichen Küstenstraße“, wie ich dies Zuggebiet in meinen „Rätseln des Vogelzuges“ genannt habe[2], lassen sich nach[S. 139] den Ergebnissen der Vogelberingung noch zwei andere Zuggebiete in Europa erkennen, die von zahlreichen Vogelarten, Land- wie Wasservögeln, auf ihrem Zuge durchflogen werden. Das eine Gebiet, die „Italienisch-Spanische Zugstraße“, führt aus Osteuropa über Oberitalien, den Löwengolf nach Spanien und Afrika, das zweite Gebiet, die „Adriatisch-Tunesische Zugstraße“, bringt die beschwingten Wanderer über die Adria, Sizilien nach Tunis. —
Um für die Beurteilung der sehr umstrittenen Frage nach der Höhe des Vogelzuges zuverlässige Angaben zu erhalten, stellte ich im Jahre 1901 die Luftfahrt in den Dienst der Vogelzugforschung. In der mehr als zwanzigjährigen Beobachtungszeit bestätigten die Angaben der Luftfahrer immer wieder, daß die Zugvögel sich im allgemeinen nicht sehr hoch über die Erdoberfläche erheben. Die Flughöhe übersteigt selten 400 m relativer Höhe. In nur wenigen Fällen, die als große Ausnahme gelten, wurden Vögel in Höhen über 1000 m von den Luftfahrern beobachtet. Die größte bisher festgestellte relative Flughöhe beträgt 2300 m. Hier traf ein Flieger eine Schar Schwalben an, die sich auf dem Zuge befanden. Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft müssen wir also annehmen, daß die Vögel auf ihren Wanderungen keine sehr großen Höhen aufsuchen. Die frühere Annahme, daß die Zugvögel in gewaltigen Höhen, von 10000–12000 m, wo sie der Wahrnehmung von der Erde aus völlig entzogen sind, ihre Luftreisen ausführen, läßt sich nicht aufrechterhalten. Sie ist um so weniger glaubwürdig, als wir heute wissen, daß in diesen Höhen der Luftdruck so niedrig und die Kälte so groß ist, daß ein längerer Aufenthalt der Vögel hier ganz unmöglich ist.
Hiermit sind jedoch die Fragen, die sich an das fesselnde und rätselhafte Problem des Vogelzuges knüpfen, noch lange nicht erschöpft. Hierzu gehören vor allem der Zusammenhang des[S. 140] Zuges mit der Witterung und die Orientierung der Zugvögel. Über beide Fragen sind zahlreiche Theorien aufgestellt worden, die jedoch einer strengen Kritik nicht standzuhalten vermögen. Nach den neueren Beobachtungen scheint die Zugbewegung, die in der Hauptsache auf einem angeborenen, periodisch im Vogel selbst erwachenden Trieb beruht, wenig mit den meteorologischen Verhältnissen zusammenzuhängen, und die Orientierung der Zugvögel müssen wir wohl auf einen angeborenen Richtungssinn zurückführen, der den Vogel ganz automatisch leitet. Wir werden uns mit der Frage nach dem Orientierungsvermögen der Tiere später noch näher befassen.
Außer den regelmäßig wiederkehrenden Wanderungen der Zugvögel, die durchaus gesetzmäßig verlaufen, unternehmen bisweilen ausgesprochene Standvögel plötzlich große Wanderungen. Solche unregelmäßigen Wanderungen wurden besonders vom sibirischen Tannenhäher und dem asiatischen Steppenhuhn beobachtet.
Der sibirische Tannenhäher unterscheidet sich von dem gewöhnlichen auch bei uns als Brutvogel auftretenden Tannenhäher durch einen schlankeren, sehr viel dünneren Schnabel. Er hat daher in der modernen ternären Nomenklatur den lateinischen Namen Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm erhalten. Dank der systematischen Subtilforschung sind wir jetzt imstande, bei vielen Tieren geographische Rassen zu unterscheiden, die sich durch eine Abweichung in der Größe und Färbung oder bei den Vögeln auch durch Unterschiede in der Schnabel- und Fußbildung kennzeichnen. So hat z. B. der Kleiber in Skandinavien und Nordrußland eine hellere, fast weiße Unterseite, während der mitteleuropäische Kleiber unterwärts ockergelb gefärbt ist. In der Mitte zwischen beiden Formen steht der Kleiber aus Ostpreußen und Polen, dessen Unterseite[S. 141] rahmfarben gefärbt ist. Um diese Unterschiede wissenschaftlich zum Ausdruck zu bringen, hat man die ternäre Nomenklatur eingeführt. Die mitteleuropäische Form heißt Sitta europaea caesia Wolf., die nördliche, helle Rasse Sitta europaea europaea L. und die ostpreußische Mittelform Sitta europaea homeyeri Hart. Der ursprünglich von Linné gegebene Artname „europaea“ wird beibehalten, zu dem ein neuer, dritter Name, der die geographische Rasse bezeichnet, hinzugesetzt wird. Man spricht dann in der Wissenschaft von einem „Formenkreis“, der in diesem Falle „Sitta europaea“ heißt, und der die verschiedenen Unterarten oder Rassen, die mit einem weiteren Namen gekennzeichnet werden, umschließt. Durch die beiden Artnamen mit dem Gattungsnamen entstehen also im ganzen drei Namen (ternäre Nomenklatur). Linné hat in seiner von ihm eingeführten binären Nomenklatur den Kleiber „Sitta europaea“ genannt und hat hiermit zunächst den schwedischen Kleiber gemeint, ohne gewußt zu haben, daß die Kleiber in anderen Gegenden sich von dem schwedischen Kleiber unterscheiden. Um nun zum Ausdruck zu bringen, daß der Linnésche Name „Sitta europaea“ sich nur auf den schwedischen Kleiber bezieht, und um das Autorenrecht zu wahren, wird dieser Artname zweimal wiederholt. Da nun in der neueren Systematik die Gattungsnamen teilweise geändert werden mußten und manchmal ein früherer Artname zum Gattungsnamen erhoben wurde, so entsteht in der ternären Nomenklatur bisweilen die zwar unschöne, aber schwer zu vermeidende Wiederholung von drei gleichen Namen. So heißt z. B. der europäische Uhu, den Linné „Strix bubo“ nannte, nach der ternären Nomenklatur „Bubo bubo bubo“, weil der ursprüngliche Artnamen „bubo“ ein Gattungsbegriff geworden ist. Nach dem Prioritätsgesetz, das den Artnamen des ersten Autors sichert, muß der Artname Linnés „bubo“ bestehen[S. 142] bleiben, und er muß verdoppelt werden, um den von Linné beschriebenen europäischen Uhu von andern geographischen Rassen, die in denselben Formenkreis gehören, abzutrennen. —
Der dünnschnäblige Tannenhäher lebt in Sibirien und dem nördlichen Asien bis Korea und trägt ein braunes, mit großen weißen Tupfen geziertes Federkleid. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus den Sämereien der Nadelhölzer, besonders aus Zirbelnüssen, den Früchten der Arven. In Jahren, wo die Arven nur wenig Nüsse tragen, leiden die Tannenhäher in Sibirien unter Nahrungsmangel, sie verlassen dann in großen Scharen ihre Heimat und wandern westwärts nach Europa, wo sie in größeren oder kleineren Trupps umherschweifen. Außer in Deutschland wurden auch schon in Frankreich, England und Skandinavien derartige Einwanderungen des sibirischen Tannenhähers beobachtet. Die letzte größere Tannenhäherinvasion erfolgte im Jahre 1917. Auf der Kurischen Nehrung durch die Vogelwarte Rossitten beringte Tannenhäher setzten ihre Reise nach Südwesten in das Innere Deutschlands und nach Österreich fort.
Ebensolche westlichen Wanderungen unternimmt zeitweise auch das Steppenhuhn, welches die dürren Steppen Asiens bewohnt. Die größten Einwanderungen fanden in den Jahren 1863 und 1888 statt, wo die Steppenhühner zu Tausenden in Europa erschienen. Meist bildeten die Vögel kleine Völker von etwa 20–40 Stück, doch wurden auch große Scharen von 300–400 Vögeln angetroffen. Trotz einiger Brutversuche, die die Steppenhühner in Deutschland, Holland und Großbritannien machten, erfüllte sich die Hoffnung auf eine dauernde Einbürgerung der Vögel nicht. Alle die großen Scharen, die in Europa einwanderten, gingen hier im Laufe von 1–2 Jahren zugrunde. Den Vögeln fehlen offenbar als Steppenbewohnern die geeigneten Lebensbedingungen.[S. 143] Um so mehr muß man sich wundern, daß diese Wanderungen, die ebenso wie beim Tannenhäher offenbar auf Nahrungsschwierigkeiten beruhen, immer wieder nach Westen gerichtet sind, wo die Vögel in den kultivierten Ländern Europas keine Existenzmöglichkeiten finden und dann elend zugrunde gehen. Sie wissen den Rückweg in ihre Heimat anscheinend nicht wieder zu finden, denn es sind niemals Rückwanderungen der Steppenhühner und Tannenhäher beobachtet worden.
Die Wanderungen der europäischen und auch der asiatischen Zugvögel sind vorwiegend nach Westen und Südwesten gerichtet, und auch die unregelmäßigen Auswanderungen der Steppenhühner und Tannenhäher erfolgen auffallenderweise nach Westen, obwohl in diesem Falle, wie wir sahen, die westliche Richtung recht unzweckmäßig ist, da sie den Vögeln, die der Nahrungssorge entgehen wollen, die Lage nicht verbessert, sondern sie in den sicheren Tod führt. Auch die großen Völkerwanderungen im Mittelalter waren stets nach Westen gerichtet, und die Ausbreitung der Städte erfolgt bei uns meist auch nach Westen. Der Drang nach dem Westen scheint bei Mensch und Tier stark ausgeprägt zu sein. Sollte hier vielleicht ein innerer Zusammenhang bestehen, dessen Ursachen uns noch unbekannt sind! Auffallend ist es, daß die westliche Richtung aller dieser Wanderungen der Drehung der Erde, die von West nach Ost erfolgt, entgegengerichtet ist. Vielleicht ist ein unwillkürliches Empfinden, die Rotationsbewegung der Erde zu kompensieren, die Veranlassung zu einer bevorzugten Bewegung in entgegengesetzter Richtung nach Westen? —
Der Leser, der weniger mit der ornithologischen Systematik vertraut ist, könnte durch den Namen „Steppenhuhn“ leicht in den Glauben versetzt werden, daß es sich um einen hühnerartigen Vogel handelt. Dies ist aber nicht der Fall. Das Steppenhuhn[S. 144] (Syrrhaptes paradoxus) gehört zu den sogenannten Flughühnern, die mit den Scharrvögeln, also den Hühnern, nichts zu tun haben. Die Flughühner bilden eine Ordnung für sich, die sich den Tauben eng anschließt. Sie sind wie die Tauben vorzügliche Flieger und haben im Gegensatz zu den Hühnern, die kurze und runde Flügel besitzen, sehr spitze und lange Flügel. Die sehr kleinen, meist nur dreizehigen Füße sind bis zu den Zehen dicht befiedert. Die Zehen sind bis zur Spitze mit einer Haut verbunden, so daß eine einheitliche Fußsohle entsteht, die das Einsinken im losen Steppensand verhindert. Die Flughühner sind ausgezeichnete Flieger, die auf der Nahrungssuche weite Strecken in der Steppe sehr schnell durchmessen. Ihr Federkleid ist dem Erdboden des dürren Steppengebietes vortrefflich angepaßt und auf sandfarbenem Grunde mehr oder weniger dunkel gewellt und gefleckt. —
Der Einfall der Steppenhühner zu vielen Tausenden in Europa, die Vereinigung von Kranichen, Störchen, Staren und vieler anderer Vögel zu Hunderten und Tausenden auf dem Zuge, dies alles wurde weit übertroffen durch die Massenwanderungen der Wandertaube, die noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts in Nordamerika lebte und eine der interessantesten aller Vogelarten war. Sie ist wie so viele Tiere durch den Unverstand des Menschen und durch seine blinde Vernichtungswut ausgerottet worden. Die Wandertaube, eine große, blaugraue, langgeschwänzte Taube, durchzog in gewaltigen Massen, deren Kopfzahl nicht nach Tausenden, sondern nach Millionen und Milliarden zählte, das Land auf der Suche nach Nahrung. Nach Angabe des amerikanischen Forschers Audubon erschienen die Wandertauben bisweilen in solchen Mengen, daß die ganze Luft von ihnen erfüllt war, die Sonne verdunkelt wurde und der Kot der Vögel wie[S. 145] Schneeflocken herabrieselte. In den Wäldern, die die Tauben zur Nachtruhe aufsuchten, brachen die Äste der Bäume unter der Last der auf ihnen ruhenden Tiere, und der Waldboden wurde meilenweit mit dem Kot der Vögel bedeckt. Die Fluggeschwindigkeit der Wandertauben wurde von den Amerikanern auf eine englische Meile in einer Minute geschätzt, also auf fast 100 km in der Stunde, was freilich für einen länger anhaltenden Dauerflug eine gewaltige Leistung ist, falls diese Angabe als zuverlässig betrachtet werden kann. Auf kürzere Strecken entwickeln freilich manche Vögel erstaunliche Flugleistungen. Die besten Flieger, Albatros und Stachelschwanzsegler, sollen imstande sein, eine Fluggeschwindigkeit von 40–44 m/sek. zu entfalten, also zwei englische Meilen in 36–42 Sekunden zurückzulegen. Diese Fluggeschwindigkeit, die die Vögel freilich nur auf kurze Strecken und nicht auf der Wanderung ausführen, würde also die Fluggeschwindigkeit der Brieftaube um mehr als das Doppelte übertreffen.
Überall, wo die Wandertauben erschienen, wurden sie rücksichtslos von den Menschen verfolgt. Man schoß und fing sie zur eigenen Nahrung, man metzelte sie schonungslos nieder, um die Schweine damit zu mästen, die von allen Seiten zu Hunderten herbeigetrieben wurden. Gegen Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts nahmen die Wandertauben ab, und seit den neunziger Jahren fehlt jede Kunde von diesen eigenartigen Vögeln, die der Vernichtungswut des Menschen zum Opfer gefallen sind. Falls sich nicht im Innern Nordamerikas noch einzelne Überreste erhalten haben, die den Bestand allmählich wieder vergrößern, muß diese Vogelart leider als ausgestorben betrachtet werden.
Eine andere Vogelart Nordamerikas, der Karolinasittich, der einzige in den Vereinigten Staaten vorkommende Papagei, ist[S. 146] ebenfalls in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch den Menschen ausgerottet worden. Die gelb und rot gefärbten Köpfe dieses schönen Sittichs wurden ein begehrter Hutschmuck der Damenwelt. Die Mode schlachtete die Sittiche zu Tausenden und aber Tausenden hin, bis sie schließlich ausgerottet wurden, womit Nordamerika eine weitere Vogelart verlor, die dem Lande ein so besonderes, charakteristisches Gepräge gab.
Zu Wandertaube und Karolinasittich gesellt sich noch ein drittes Tier Amerikas, das, wenn auch nicht völlig, so doch zum größten Teil der Gewinnsucht und Habgier des Menschen zum Opfer gefallen ist. Es ist der amerikanische Bison (Abbildung 11), der einst in unzählbaren Herden, zu vielen Millionen den nördlichen Teil der Neuen Welt bewohnte. Mit der fortschreitenden Kultivierung Amerikas wurde der Bison allmählich in die im Innern liegenden Steppengebiete zurückgedrängt.
Die Union-Pazifik-Bahn teilte das Verbreitungsgebiet der Bisons in zwei Teile, einen nördlichen und einen südlichen. Da dank der Eisenbahn die Bisongebiete so leicht und bequem zu erreichen waren, bildeten sich zahlreiche Jagdgesellschaften, um den Abschuß im großen Maßstabe ins Werk zu setzen und aus der Verwertung des Fleisches und der Felle Gewinn zu ziehen. Der Abschuß oder, richtiger gesagt, die Schlächterei der harmlosen und schwerfälligen Tiere war keine Kunst und erforderte keine hohe weidmännische Begabung. Einzelne Schießer, den Ausdruck „Jäger“ für diese empörenden Massenschlächter zu gebrauchen, widerstrebt unserem weidmännischen Empfinden, brachten auf einem Jagdausfluge nicht weniger als 1000, ja bis 3000 Bisons zur Strecke. Ein gewisser A. Andrews soll nach amerikanischer Mitteilung innerhalb einer Stunde 63 Bisons niedergeschossen haben. Seine unrühmliche Handlungsweise wird aber nach einer Mitteilung des[S. 147] Amerikaners Dodge noch von einem anderen Schützen übertroffen, der es fertigbrachte, in ¾ Stunden in einem Umkreis von nur 400 m 112 Bisons abzuschlachten. Nur mit Ekel und Verachtung kann man sich von einem solchen Treiben abwenden!
Infolge dieser törichten und sinnlosen Schießerei wurde der Bestand der Bisons, so gewaltig er auch war, in kurzer Zeit aufgerieben. Mit Eröffnung der Union-Pazifik-Bahn im Jahre 1869 begann die Massenschlächterei der Bisons. 1871 wurde die Anzahl der südlich der Bahn lebenden Tiere noch auf 3 Millionen veranschlagt, nach 4 Jahren waren von dieser stattlichen Herde nur noch wenige, kümmerliche Überreste vorhanden. Nicht anders erging es der nördlichen Herde, die in 3 Jahren so gut wie ausgerottet war. Es ist völlig unbegreiflich und unverständlich, daß die amerikanische Regierung diesem ruchlosen, wahnsinnigen Treiben habgieriger Schießer zusah, ohne rechtzeitig einzugreifen und den Leuten ihr schmachvolles Handwerk zu legen. Erst nachdem das Werk vollbracht war und der Bison so gut wie ausgerottet ward, versuchte man in zwölfter Stunde noch das Rettungswerk. So waren die einst nach Millionen zählenden Bisons innerhalb weniger Jahre bis auf etwa 800 Stück zusammengeschmolzen.
Außer im Yellowstone-Park und im Schutzpark von Alberta hat man noch verschiedene Reservate eingerichtet, wo der Bison völligen Schutz genießt. So hat der Bestand sich in letzter Zeit wieder etwas gehoben, ohne jedoch auch nur im entferntesten an jenen der früheren Zeiten zu erinnern.
Solange die Bisons noch ungestört lebten, unternahmen sie zweimal jährlich große Wanderungen. Sie wanderten zum Winter südwärts und kehrten zum Frühjahr wieder nach dem Norden zurück. Es waren also regelmäßige Züge, ähnlich wie die Wanderungen[S. 148] der Zugvögel. Die Bisons aus Kanada sollen ihre Reisen bis zum mexikanischen Golf ausgedehnt haben. Auf diesen Wanderungen vereinigten sich die Bisons zu gewaltigen Scharen. Reisende berichteten, daß sie eine volle Woche hindurch unaufhörlich mit ihrer Karawane neben wandernden Bisonherden hergezogen sind.
Zwei dem Bison nahverwandte Wildrinder sind der europäische Ur- oder Auerochse und der Wisent. Auerochse und Wisent, die der Laie häufig für dieselben Tiere hält, waren zwei ganz verschiedene Arten, die in früherer Zeit nebeneinander in Europa gelebt haben. Der Auerochse war ein geradrückiges Rind mit sehr langen nach vorn und aufwärts gebogenen Hörnern, das unserem heutigen Rindvieh sehr ähnlich sah. Der bedeutend massigere Wisent, der den Ur bis auf den heutigen Tag überlebt hat, ist durch einen kurzen Hals und hochgewölbten Rücken gekennzeichnet. Sein Fell besteht aus langen, etwas gekräuselten Grannenhaaren und einem darunter stehenden dichten Wollpelz. Die Hörner sind nicht wie beim Ur nach vorn, sondern seitwärts herausgebogen und bedeutend kürzer. Der Unterschied zwischen Auerochse und Wisent ist so groß und so auffallend, daß man beide Tiere als völlig verschiedene Arten ansehen muß, die nichts miteinander zu tun haben. Dagegen haben Wisent und Bison viel Ähnlichkeit miteinander. Ebenso wie der Wisent trägt auch der Bison einen dichten Pelz und kurze, seitwärts gebogene Hörner. Aber das Wuchtige und Massige der Erscheinung kommt beim Bison noch mehr zur Geltung. Der Kopf ist unverhältnismäßig groß und sehr breit, der Widerrist noch höher als beim Wisent. Überhaupt fällt beim Bison der mächtige Brustteil im Gegensatz zu dem schmächtigeren Hinterteil des Körpers sehr auf, während der Wisent mehr eine gewisse Ausgeglichenheit in den Formen zeigt. Auch in der Körpergröße[S. 149] übertrifft der Bison den Wisent ganz erheblich. Der Wisent erreicht ein Körpergewicht bis höchstens 700 kg, der Bison dagegen bis zu 1000 kg. —
Nach den Untersuchungen Nehrings hat der Auerochse noch bis zum 15. Jahrhundert an einigen Stellen in Europa in freier Wildbahn gelebt. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden noch wenige Stücke in eingehegten Revieren gehalten, von denen 1627 das letzte Tier starb, womit der Auerochse, an den sich soviel Sagen des alten Germanentums knüpfen, verschwunden war. Der Auerochse ist als der Stammvater unseres Hausrindes anzusehen. Der Ausgangspunkt der Zähmung des Urs liegt in Mesopotamien und Ägypten, wo er als heiliges Wesen galt. Aus dem religiösen Rinderkultus entwickelte sich allmählich die Überführung des Rindes in den Hausstand des Menschen und seine Verwendung als Nutztier. Wir dürfen also unsere heutigen Hausrinder als die Nachkommen des Auerochsen ansehen.
Besser als dem Ur erging es dem Wisent, der sich bis auf den heutigen Tag, freilich nur in wenigen Überresten, erhalten hat. Im Altertum sehr zahlreich über ganz Europa verbreitet, lebte der Wisent hier noch in einzelnen Gegenden bis in das 18. Jahrhundert. In der Mitte des 14. Jahrhunderts kam der Wisent noch in Pommern vor, und selbst im 18. Jahrhundert gab es noch einige Wisente in Ostpreußen. Der letzte deutsche Wisent in freier Wildbahn wurde bei Tilsit im Jahre 1755 von einem Wilderer erlegt. Hundert Jahr länger erhielt sich der Wisent in Ungarn, wo er bis zum Ende des 18. Jahrhunderts noch in Siebenbürgen, im Rodnaer und im Keleman-Gebirge vorkam.
Für den Weidmann bildete die Erlegung eines Wisents, dieses tapferen und wehrhaften Wildes, seit den ältesten Zeiten die Krone der Jagd. Die alten Germanen und die Ritter des Mittelalters[S. 150] gingen im mutigen Kampfe mit dem Speer dem Wisent zu Leibe. Die Erlegung eines Wisents im tapferen Zweikampf erfüllte den Jäger mit Ruhm und Stolz. Als später nach der Erfindung der Feuerwaffe der Bestand der Wisente erheblich verringert war, wurde die Jagd auf den Wisent ein Vorrecht gekrönter Häupter, die das begehrte Wild in besonderen Revieren hegten und große Treibjagden veranstalteten. Besonders die Könige von Polen und die Zaren des Russischen Reiches widmeten sich mit größtem Eifer der Wisentjagd. So blieb diesem edlen Wilde in Polen und in Rußland eine Zufluchtsstätte erhalten, wo es dank der weidmännischen Bestrebungen der Herrscher mit Verständnis gehegt wurde. Der Wald von Bialowies und der Kaukasus waren diese ehrwürdigen Stätten, wo die letzten Reste des Wisents als Zeugen herrlicher, verklungener Zeiten ihr Leben fristeten. Leider muß man sagen „waren“, denn heute sind sie nicht mehr. Der sinnlosen Wut und dem blöden Unverständnis des russischen Bolschewismus mußten diese herrlichen Naturdenkmäler zum Opfer fallen. Die Rätetruppen haben die Wisente schonungs- und erbarmungslos niedergeknallt. Hat man doch in Rußland Treibjagden auf Wisente mit Maschinengewehren unter Aufbietung ganzer Regimenter der roten Garde als Schützen und Treiber abgehalten. So haust der Bolschewismus, der im Kleide des Kommunisten und Spartakisten auch an unsere Tür klopft. Darum, deutsche Jugend, sei auf der Hut vor diesem alle Kulturwerte zerstörenden Wahnwitz menschlichen Geistes!
Außer in den russischen Jagdgehegen wurden noch in den europäischen Zoologischen Gärten und in einem Wildpark des Fürsten Pleß Wisente gehalten, die sich regelmäßig fortpflanzten und so einen dauernden Bestand bildeten. Die Not des Krieges hat auch hier aufgeräumt, so daß die Anzahl sehr zusammengeschmolzen[S. 151] ist. Der Wisentpark im Pleßschen Revier ist leider auch ein Opfer der Revolution geworden. Die letzte Stunde des gewaltigsten europäischen Naturdenkmals begann zu schlagen. Da ertönte der Ruf edel denkender Männer: „Wisent in Not, in allerhöchster Not.“ Unter Führung des Direktors des Zoologischen Gartens der Stadt Frankfurt a. M., Dr. Priemel, taten sich zahlreiche Männer zusammen, um den Wisent vor dem Untergange zu retten und begründeten im Jahre 1923 die „Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“. Die letzten Reste des edlen Wildrindes sollen gesammelt und zur weiteren Zucht zunächst in einem geeigneten, größeren Gehege untergebracht werden, das Graf Arnim in Boitzenburg in der Uckermark in hochherziger Weise zur Verfügung gestellt hat. Ist der Bestand genügend herangewachsen, dann wird eine Aussetzung des Wildes in einem der größeren Staatsforsten in Ostpreußen geplant. Möge das edle Werk durch vollen Erfolg gekrönt sein! —
Ebenso wie in Europa war der Wisent auch in Asien in früheren Zeiten weit verbreitet, wo er jedoch bis auf ein kleines Rückzugszentrum im Innern von Persien ebenfalls völlig verschwunden ist. Aber auch hier sind die Tage des Wisents gezählt, der in Persien nicht den geringsten Jagdschutz genießt. Die „Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents“ plant daher, einige Wisente aus Persien zu überführen zur Blutauffrischung des hiesigen Bestandes, den die Gefahren der Inzucht allzusehr bedrohen.
So wird es hoffentlich gelingen, eins der wertvollsten Naturdenkmäler aus der Tierwelt vor dem Untergang zu bewahren. —
Ebenso wie der Bison unternimmt auch das Rentier in Sibirien und Nordamerika regelmäßige, große Wanderungen (Abbildung 12). Im Herbst verlassen die Rentiere die baumlosen Niederungen und suchen in den Wäldern Schutz vor den Unbilden[S. 152] des Winters, um dann im Mai wieder in die Steppe zurückzuwandern. Bei diesen Wanderungen werden gewaltige Strecken von mehr als 100 geographischen Meilen zurückgelegt, wobei sich die Rentiere zu großen Herden vereinigen. Da bei den Rentieren nicht wie bei den anderen Hirscharten nur die männlichen Tiere, sondern auch die Kühe Geweihe tragen, so gleicht eine in dichtgedrängter Masse wandernde Rentierherde mit den Geweihen einem wandelnden Wald.
Das erste dicht über der Stirn hervorsprießende Ende am Geweih wird in der Weidmannssprache „Augsprosse“ genannt. Sie ist beim Rothirsch die Hauptwaffe für den Kampf, und jene Hirsche, bei denen die Augsprossen besonders lang sind und sich nicht nach oben biegen, sondern wagerecht nach vorn stehen, sind die gefährlichsten Gegner. Sind zugleich die übrigen Enden des Geweihs nur schwach oder gar nicht entwickelt, dann ist die Gefährlichkeit der starken Augsprosse noch größer. Solche Hirsche forkeln im Zweikampf jeden anderen Hirsch, auch wenn er stärker ist, mit den wie Dolche wirkenden Augsprossen zu Tode. Der Jäger nennt sie daher „Schadhirsche“, weil sie unter dem Wildstand argen Schaden anrichten.
Bei dem Rentier ist die Augsprosse auch stark entwickelt, aber sie trägt vorn eine breite Schaufel, die zwar keine gefährliche Waffe ist, aber ein sehr praktisches Gerät, um im Winter auf der Nahrungssuche den tiefen Schnee fortzuschaufeln. Für das Rentier ist also das Geweih notwendiger als für andere Hirscharten, da es eine praktische Bedeutung hat. Dies mag wohl der Grund sein, weshalb nicht nur die Hirsche, sondern auch die Kühe ein Geweih tragen. —
In Lappland ist das Rentier seit langen Zeiten zum Haustier geworden (Abbildung 13). Es vertritt dort unser Rindvieh. Sein[S. 153] Wildbret dient den Lappen zur Nahrung, die Decke wird zu Kleidungsstücken und Leder verarbeitet, aus den Knochen werden Geräte hergestellt. Das gezähmte Rentier unterscheidet sich von dem wilden durch seine etwas schwächere Gestalt und das Auftreten von weißen und weißgescheckten Tieren. Die weiße Farbe beruht jedoch nicht auf Albinismus, sondern ist das sogenannte domestizierende Weiß, was bei allen Haustieren vorkommt. Infolgedessen haben weiße Haustiere auch keine roten Augen, die nur für den Albinismus charakteristisch sind. Den Albinos fehlt jegliches Pigment, infolgedessen auch das Pigment in der Iris, die durchsichtig ist und das rote Blut durchscheinen läßt.
Wohlhabende Lappländer besitzen Rentierherden von mehreren tausend Stücken. Die Einbürgerung des Rentiers als Haustier läßt sich bis in das 9. Jahrhundert verfolgen, wahrscheinlich ist sie aber noch viel älter.
Ebenso wie das Rentier unternimmt auch der Moschusochse, der das Polargebiet von Nordamerika bewohnt, im Winter große Wanderungen, die das Tier jedoch aus dem arktischen Gebiet nicht hinausführen, sondern nur der Nahrungssuche dienen. Haben sie an einer Stelle die unter der hohen Schneedecke verborgene kümmerliche Äsung aufgezehrt, dann wandern die Moschusochsen weiter und legen hierbei häufig große Strecken in dem weiten Gebiet der Arktis zurück. Der Weg führt über das Eis des zugefrorenen Meeres von Insel zu Insel. Entsprechend des Aufenthalts in einem kalten Klima ist der Moschusochse mit einem langhaarigen Pelz bekleidet, der eine dichte Unterwolle trägt. Trotz der scheinbaren plumpen Gestalt sind die Tiere sehr beweglich. Sie laufen schnell und gewandt und erklettern ebenso geschickt wie Ziegen und Gemsen hohe und steile Felsen und führen[S. 154] sogar an schroffen Felswänden im losen Steingeröll die sichersten Sprünge aus.
Während Bison, Rentier und Moschusochse regelmäßige Wanderungen ausführen, die mit den Lebensbedingungen dieser Tiere in engster Verbindung stehen, werden andere Säugetiere nur zeitweise von einem Wandertrieb erfaßt, der an keine bestimmte Jahreszeit gebunden ist und ebenso wie die Wanderungen des sibirischen Tannenhähers und des Steppenhuhns sich in ganz unregelmäßigen Abständen wiederholt. So unternimmt z. B. der im arktischen Europa und Asien beheimatete Lemming, ein kleines nur 15 cm langes, gelb und schwarz geflecktes Nagetier, zeitweise große Wanderungen, bei denen sich die Tiere meist nur zu kleineren Scharen von höchstens 100 Stück vereinigen und nur ausnahmsweise große Gesellschaften, die nach Hunderten zählen, bilden. Die Tiere drängen sich auf ihren Wanderungen nicht dicht zusammen, sondern halten größere Abstände voneinander. Jedes Tier sucht sich seinen eigenen Weg. Die Wanderungen bewegen sich in der Regel aus dem Gebirge nach der Ebene, und da die Tiere sich hierbei die gangbarsten Stellen aussuchen, so gibt es in manchen Gegenden ganz bestimmte Pfade, die die Lemminge immer wieder benutzen. Ebenso wie beim Vogelzuge kann man auch bei den Wanderungen der Lemminge von „Zugstraßen“ sprechen. Bestimmte Himmelsrichtungen werden jedoch von den wandernden Lemmingen nicht innegehalten, sondern die Richtung der Zugbewegung hängt lediglich von der Richtung der von den Gebirgskämmen in die Ebene führenden Pfade ab. In der Regel verlassen nicht alle Lemminge ihre Heimat, sondern immer nur ein Teil ihres Bestandes, und zwar meist die Männchen. Es scheint also das Wandern der Lemminge mit dem Sexualleben in Verbindung zu stehen. Die überzähligen Männchen wandern aus, um in anderen[S. 155] Gegenden auf die Suche nach einer Frau auszugehen. Den Massenwanderungen der Lemminge geht stets eine übergroße Vermehrung der sehr fruchtbaren Tiere voraus, die eine Übervölkerung hervorruft. Die Übervölkerung führt naturgemäß zu einer Ausbreitung, die die Tiere allmählich in Regionen bringt, die ihnen weniger zusagen. Das Gefühl der Unbehaglichkeit ergreift sie und weckt das Bestreben, geeignetere Gegenden aufzusuchen, die bessere Lebensbedingungen bieten, woraus dann der Wandertrieb entsteht. So mag neben dem unbefriedigten Fortpflanzungstrieb der Männchen, deren Zahl bei starker Vermehrung vielleicht unverhältnismäßig groß ist, auch die Übervölkerung und der Trieb zur Ausbreitung die Ursache der Wanderungen sein. —
Alle Tiere, welche wie die Zugvögel, der Wisent und das Rentier regelmäßig wandern, kehren stets in ihre Heimat zurück. Die Tiere aber, die sich nur ausnahmsweise und in ganz unregelmäßigen Abständen auf die Wanderschaft begeben, kehren fast niemals zur alten Wohnstätte zurück, sondern gehen auf der Reise, die eine regelrechte Auswanderung ist, meist zugrunde. Dies ist beim Tannenhäher, dem Steppenhuhn und auch beim Lemming der Fall. Nur sehr selten sind Rückwanderungen von Lemmingen beobachtet worden. Die wandernden Tiere werden in der Regel von Seuchen befallen, die sie völlig aufreiben, oder gelangen in Gegenden, die ihren Lebensbedingungen nicht entsprechen, und sterben des Hungertodes. Den wandernden Lemmingscharen folgen mit Vorliebe die Raubvögel, besonders Schnee-Eule und Rauhfußbussard, um sich den durch die Natur reichgedeckten Tisch nicht entgehen zu lassen. So werden durch die Wanderzüge eines Tieres auch andere Tiere zum Wandern veranlaßt. —
[S. 156]
Übervölkerung und Nahrungsmangel treiben mitunter auch das Eichhörnchen auf die Wanderschaft. Besonders in Sibirien sind Massenwanderungen von Eichhörnchen keine seltene Erscheinung. Wenn auch die Eichhörnchen meist nur in kleineren Trupps wandern, so kommen hin und wieder auch größere Massenvereinigungen vor, die Hunderte, ja Tausende von Tieren zusammenscharen. Diese lassen sich bei ihren Wanderungen durch keine Hindernisse aufhalten, dringen in Ortschaften ein, übersteigen hohe Gebirgszüge und durchschwimmen sogar reißende Flüsse, wie den breiten Jenissei. Ebenso wie die Lemminge sind auch die wandernden Eichhörnchen dem Tode preisgegeben. Auch bei uns in Deutschland wurden schon Wanderzüge von Eichhörnchen beobachtet. Im Jahre 1907 durchzog eine große Schar Eichhörnchen den Harz und tat in den Kulturen der Nadelbäume bedeutenden Schaden. Der Durchzug währte jedoch nur wenige Tage.
Ein berüchtigtes und mit Recht gefürchtetes Wandertier ist die Wanderratte. Ursprünglich in China beheimatet, hat sie sich von hier aus über ganz Asien verbreitet und gelangte auch nach Europa. Außerdem wurde sie durch Schiffe nach Europa verschleppt und kam auf diese Weise auch nach Amerika. Überall, wo die Wanderratte unfreiwillig durch den Schiffsverkehr eingeführt wurde, hat sie sich eingebürgert und schnell weiter ausgebreitet. Dank ihrer großen Fruchtbarkeit ist die Vermehrung eine überaus schnelle, so daß an Orten, wo sie ungestört ist, sehr bald eine gewaltige Rattenplage eintritt. Die dem Tiere innewohnende rege Wanderlust, die wohl hauptsächlich eine Folge der durch die starke Vermehrung verursachten Übervölkerung ist, treibt die Wanderratten auf die Reise, um neue Ansiedlungsmöglichkeiten zu suchen. Auf ihren Wanderzügen rotten sich die Tiere zu Hunderten und Tausenden zusammen und scheuen sich nicht, breite[S. 157] Ströme, ja sogar Meeresteile zu überschwimmen. So erschien im Jahre 1846 auf einer Insel im Kleinen Belt eine große Rattenschar, die nur über das Meer dorthin gelangt sein konnte. Da die Ratte als Allesfresser überall geeignete Lebensbedingungen findet, gehen die wandernden Scharen nicht zugrunde, wie es beim Lemming, dem Tannenhäher und dem Steppenhuhn der Fall ist, sondern sie gründen sich ein neues Heim, indem sich die Schar allmählich auflöst und verteilt. Bald wimmelt es an der neuen Wohnstätte wieder von Ratten, und eine Übervölkerung setzt abermals einen Wanderzug in Bewegung. So erfolgt die Ausbreitung ungeheuer schnell. Die Wanderratte hat die Hausratte, von der sie sich durch bedeutendere Größe und die rein weiße Unterseite unterscheidet, fast ganz verdrängt, so daß die Hausratte jetzt geradezu ein seltenes Tier geworden ist, das nur noch an wenigen Stellen neben der Wanderratte auftritt. Neben der Färbung, die bei nicht selten vorkommenden melanistischen Wanderratten der gleichmäßig grauschwarzen Farbe der Hausratte ähnlich ist, ist der Schwanz ein sicheres Unterscheidungsmerkmal beider Arten. Die Hausratte hat einen sehr langen Schwanz, der aus 260–270 Ringen besteht, die Wanderratte dagegen einen verhältnismäßig kürzeren Schwanz von nur 210 Ringen.
Ähnlich wie bei der Wanderratte kommen auch bei der Feldmaus bisweilen Auswanderungen vor, wenn durch übergroße Vermehrung der Bestand ein zu zahlreicher geworden ist. Die wandernden Feldmäuse bewegen sich in langer, dünner Linie, die einzelnen Tiere dicht zusammengedrängt, vorwärts und gleichen von weitem einer kriechenden, großen Schlange. Die wandernden Mäuse fallen bisweilen auch in Waldungen ein, wo sie in den jungen Kulturen großen Schaden anrichten können. Die Wanderungen der Feldmaus finden im allgemeinen selten statt[S. 158] und bilden daher im Gegensatz zu den Wanderzügen der Lemminge und Wanderratten nur eine Ausnahmeerscheinung.
Gesetzmäßige und regelmäßig wiederkehrende Wanderungen vollführen die Fische. Der Lachs zieht zum Laichen aus dem Meere nach den Flüssen, während umgekehrt der Aal zur Fortpflanzung aus den Flüssen in das Meer wandert. Ebenso wie die Zugvögel immer wieder ihre ursprüngliche Heimat, in der sie selbst das Licht der Welt erblickt haben, zum Brüten aufsuchen, begeben sich auch die Lachse zum Laichen stets dorthin, wo sie geboren sind. Die Lachse, welche aus der Weser stammen, kehren zur Fortpflanzungszeit stets in die Weser zurück, die Lachse aus dem Rhein immer wieder nach dem Rhein. Ja sogar die Nebenflüsse, wie Aar, Mosel und Lahn, sollen von den Fischen ihrer Herkunft entsprechend zum Laichgeschäft aufgesucht werden, wie man durch Markierung junger Lachse mit kupfernen Ringen, die in den Flossen befestigt wurden, festgestellt hat. Auf der Wanderung, die je nach dem Alter der Fische und der Örtlichkeit ihrer Herkunft zu verschiedenen Jahreszeiten stattfindet, lassen sich die Lachse durch keine Hindernisse aufhalten. Sie überwinden Stromschnellen, nicht zu hohe Wasserfälle und Wehren mit großer Gewandtheit und Leichtigkeit, da sie, wie alle Salmoniden, vorzügliche Springer sind und sich mehrere Meter in die Höhe schnellen können. Auf ihren Flußwanderungen legen die Lachse täglich etwa 40 km zurück. Die Männchen, welche harte Fehden in Sachen der Liebe ausführen, werden im 2., die Weibchen erst im 3. Lebensjahre fortpflanzungsfähig.
Im Gegensatz zum Lachs, der ein Meeresbewohner ist, wandert der Aal als Süßwasserfisch umgekehrt aus den Flüssen ins Meer. Der Laichplatz des Aals liegt mitten im Atlantischen Ozean zwischen dem 25. und 45. Grad nördl. Br., in einer Tiefe von ca. 1000 m.[S. 159] Dem noch unbekannten Laich des Aals, den man bisher noch nicht gefunden hat, entschlüpfen die Aallarven. Sie haben die Gestalt eines Weidenblattes und halten sich anfangs in größeren Meerestiefen auf. Innerhalb von 1–2 Jahren wachsen sie unter dauernder Umwandlung zu kleinen, 6–8 cm langen Fischchen heran und erhalten allmählich die Aalgestalt. Jetzt beginnt die Wanderung der jungen Aale, die einen farblosen, durchsichtigen Körper haben und Glasaale genannt werden. Sie sammeln sich in großen Scharen an den Flußmündungen und steigen die Flüsse hinauf, um fortan ihr Leben in den Flußgebieten und den mit ihnen zusammenhängenden Binnengewässern zu führen. In dichtgedrängter Masse wälzt sich der Strom der jungen Aale dahin. Große Hindernisse, wie steile Wasserfälle und hohe Wehren, werden von den Fischchen überwunden. Selbst der Rheinfall bei Schaffhausen und der Rhonefall vermögen nicht die wandernden Jungaale aufzuhalten. Tausende, ja Millionen Fische finden hierbei ihren Tod, und ihre Leiber dienen den Überlebenden als Stützpunkte beim Überwinden des Hindernisses. Der Schwarm löst sich allmählich auf, und die jungen Aale zerstreuen sich in den Flußgebieten. Nach 5–8 Jahren werden die Männchen, nach 7–9 Jahren die Weibchen geschlechtsreif, und nun beginnt die Rückwanderung ins Meer, um den Laichplatz im Atlantischen Ozean aufzusuchen. Wie bei vielen Insekten, so scheint auch beim Aal die Fortpflanzung den Tod herbeizuführen. Man hat noch niemals die Rückwanderung der Laichaale vom Meer in die Flüsse beobachtet. Sie scheinen also die Liebe mit dem Tode zu besiegeln. Hierfür spricht auch die eigenartige Erscheinung, daß zugleich mit der Entwicklung der Keimdrüsen die Verdauungsorgane einschrumpfen und die Ernährung aufhört. Die fortpflanzungsfähigen Fische sind dem Hungertode preisgegeben, den sie[S. 160] selbst wohl nicht fühlen mögen, da Magen und Därme außer Tätigkeit treten. Die Umwandlung des Aals zum fortpflanzungsfähigen Tier dauert ungefähr 3–4 Monate und macht sich auch äußerlich bemerkbar. Der Kopf wird spitzer, die Augen treten mehr heraus, der Körper wird trotz der unterbrochenen Ernährung straffer, und die Haut erhält einen schönen metallischen Glanz. Der Aal heißt jetzt „Blankaal“ im Gegensatz zum noch nicht geschlechtsreifen, helleren „Gelbaal“. In der Entwicklung des Aals lassen sich also 4 verschiedene Stadien unterscheiden: Aallarve, Glasaal, Gelbaal und Blankaal.
Über die Fortpflanzungsgeschichte des Aals sind wir erst seit 1895 unterrichtet. Wohl kannte man schon lange die merkwürdigen, blattartigen Fischchen des Atlantischen Ozeans, aber man ahnte nicht, daß dies die Larven des Aals waren. Diese Entdeckung machten 1895 die italienischen Gelehrten Grassi und Calandruccio. Spätere Forschungen dänischer und norwegischer Gelehrten klärten uns dann darüber auf, daß der Laichplatz des Aals in den Tiefen des Atlantischen Ozeans liegt. Man hat noch unter dem 53. Grad westlicher Länge Aallarven im Ozean gefunden. Der Laichplatz des europäischen Flußaals liegt also näher nach Amerika als nach Europa hin. Bei der weiten Wanderung ins Meer legt der Aal täglich nicht mehr als etwa 15 km zurück und braucht somit etwa ¾ Jahr, bis er seinen Laichplatz erreicht.
In ähnlicher Weise wie beim Aal vollzieht sich auch das Fortpflanzungsgeschäft der Scholle. Auch hier finden Wanderungen der alten Fische nach bestimmten Laichplätzen statt, und die jungen Larven der Scholle führen wieder ihrerseits große Wanderungen aus, um die notwendigen Lebensbedingungen zu finden.


Der Laichplatz der Schollen liegt in möglichst salzhaltigen und warmen Meeresteilen. Solche Laichplätze sind der südwestliche[S. 161] Teil der Nordsee zwischen Holland und England und der nördliche Teil zwischen Jütland und Schottland. Beide Stellen zeichnen sich durch hohen Salzgehalt und warme Temperatur aus infolge des Einflusses des Golfstromes, der hier in die Nordsee eindringt. Ein bevorzugter Laichplatz in der Ostsee ist das Becken östlich von Bornholm, das die Schollen von der pommerschen Küste und der Südküste Schwedens zum Laichen wählen. Die Meerestiefe beträgt an den Laichplätzen nicht mehr als höchstens 80 m, da die Schollen größere Tiefen vermeiden.
Aus dem Laich entschlüpft nach zehn Tagen zunächst eine Larve, die mit der erwachsenen Scholle noch keine Ähnlichkeit hat. Sie hat noch nicht die platte Schollengestalt, sondern hat normale Fischfigur. Sofort nach dem Ausschlüpfen beginnt die Larve nach der Seeküste zu wandern und nimmt auf ihrer Reise allmählich die Gestalt des Flachfisches an. Das linke Auge bewegt sich über die Stirn hin fort nach der rechten Seite des Kopfes, und der Körper wird breiter, bis schließlich der schwimmende Fisch von der vertikalen zur horizontalen Körperhaltung übergeht. Als fertige Schollen erreichen die Jungfische nach einer Wanderung von etwa 4 Monaten die Meeresküste, nicht um hier zu verbleiben, wie man vermuten sollte, sondern um sich sofort von neuem auf die Wanderschaft zu begeben, um wieder größere Meerestiefen zu erreichen. Diese Rückwanderung geht sehr langsam vonstatten, da die Meerestiefe, in der die Fische leben, in einem bestimmten Verhältnis zum Wachstum steht. Zwei- bis dreijährige Schollen, die eine Körperlänge von etwa 15–20 cm haben, leben in einer Meerestiefe von 10–20 m, Fische von etwa 25 cm Größe verlangen eine Meerestiefe von etwa 30–40 m, und größere Schollen leben in Tiefen von 50 bis 70 m.
[S. 162]
Die Wanderungen der Schollen stehen also in einem gesetzmäßigen Zusammenhang mit der Fortpflanzung und dem Wachstum.
Nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch zu anderen Jahreszeiten unternehmen alle Flachfische größere oder kleinere Wanderungen, um ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Der Heilbutt hält sich im Sommer in der Nähe der Küste auf und wandert zum Winter in größere Meerestiefen. Der Steinbutt steigt im Frühjahr aus der Tiefe des Meeres nach den flachen Ufern der Sandbänke herauf, und die Flunder erscheint nur zu bestimmten Zeiten im Küstengebiet, die je nach der Örtlichkeit verschieden sind. Bei diesen Wanderungen, die sich hauptsächlich in vertikaler Richtung bewegen, spielen wohl die Nahrungsverhältnisse die ausschlaggebende Rolle.
Mit der Nahrung hängen auch die Wanderzüge des Herings zusammen, die volkswirtschaftlich von größter Bedeutung sind, da sie die so wertvolle Heringsfischerei ins Leben gerufen haben. Auf diesen Wanderzügen, bei denen die Heringe dem Plankton des Meeres folgen, das ihre bevorzugte Nahrung bildet, schwimmen sie zu Millionen und Milliarden in dicht gedrängter Masse nahe des Wasserspiegels dahin. Im Wasser folgen ihnen die Walfische, Delphine und Seehunde, in der Luft zahlreiche Möwen und andere Seevögel, um die in so reichem Maße gespendete Nahrung nach Kräften zu vertilgen. Die unablässige Verfolgung ihrer Feinde schart die Heringe immer dichter zusammen, so daß sich die ganze Masse wie ein Strom dahinwälzt, der sich durch die glitzernden Leiber der Fische auf dem Wasserspiegel kennzeichnet. Solche „Heringsberge“, wie man die wandernde Fischmasse genannt hat, haben bisweilen eine riesige Ausdehnung von vielen Meilen in der Länge und Breite. Fischerboote, die in die Heringszüge geraten, laufen Gefahr, zu kentern.
[S. 163]
Kein Wunder, daß nicht nur die Tiere, sondern vor allem der Mensch aus den gewaltigen Heringsansammlungen Nutzen zog und die Heringsfischerei ins Leben rief, deren Anfänge bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen. Sie entwickelte sich zuerst in Schweden, besonders in der Landschaft Schonen. Später wurde der Heringsfang auch in Norwegen, Holland, England, Schottland und Deutschland ein wichtiger Erwerbszweig, dessen Bedeutung nicht allein in der reichen Einnahme liegt, sondern vor allem in der Schaffung eines überaus wichtigen Volksnahrungsmittels. In Deutschland wurden in den letzten Jahren vor dem Kriege jährlich etwa 300000 Tonnen Salzheringe aus dem Ertrag der deutschen Fischerei hergestellt. Dies reichte aber nicht annähernd aus, um den Bedarf des deutschen Volkes zu decken, denn es wurde außerdem noch die drei- bis vierfache Menge an Salzheringen von außerhalb eingeführt. Diese Zahlen geben einen ungefähren Begriff von der wirtschaftlichen Bedeutung der Heringsfischerei.
Bei den Wanderungen der Fische erregt die Frage, wie sich die Fische hierbei orientieren, in besonderem Maße unser Interesse. Wenn die Heringe auf ihren Zügen den Tieren des Planktons folgen, so ist die Orientierung hier in sehr einfacher Weise gegeben. Die Fische folgen eben der Nahrung.
Bei den Schollen, welche zum Laichen stark salzhaltige und warme Meeresteile aufsuchen, spielen offenbar die Meeresströmungen, der Salzgehalt und die Temperatureinflüsse die entscheidende Rolle. Die Orientierung erfolgt hier mit dem Geschmack und dem Gefühl.
Der Geschmack ist bei den Fischen der am höchsten entwickelte Sinn. Er wird durch besondere Organe, die sogenannten „Geschmacksknospen“, vermittelt. Diese bestehen aus Sinneszellen mit[S. 164] feinen Schmeckstiftchen und aus dazwischengelagerten Stützzellen. In diese Zellen münden zahlreiche Verästlungen der Gehirngeschmacksnerven. Geschmacksknospen befinden sich nicht nur im Maul und auf den Lippen, sondern auch an den Kiemen, auf den Flossen, ja bisweilen sogar auf dem ganzen Körper, wie Herrick und Parker experimentell am Zwergwels nachgewiesen haben. Außer dem Geschmackssinn ist auch der mit diesem in enger Verbindung stehende Geruchssinn bei den Fischen vorzüglich ausgebildet.
Wenn der Lachs zum Laichen stets dasjenige Flußgebiet aufsucht, in dem er geboren wurde, und hierbei sogar die Nebenflüsse eines größeren Stromes berücksichtigt, so dürfen wir wohl annehmen, daß die Orientierung mit Hilfe des hochentwickelten Geschmacks und des feinen Geruchs erfolgt. Freilich muß außerdem noch ein gutes Gedächtnis hinzukommen, denn der Lachs muß sich aus seiner Jugendzeit eine Erinnerung an den spezifischen Geschmack und Geruch des Flußwassers, dem er entstammt, und das er zum Laichgeschäft wieder aufsucht, bewahrt haben. Eine derartige Seelenfunktion liegt aber durchaus im Bereich der Möglichkeit, denn durch neuere Versuche ist nachgewiesen worden, daß die Fische in ihrem Kleinhirn ein Zentrum besitzen, das sie zu gutem Gedächtnis und Assoziationsmöglichkeit befähigt. Auch scheint bei den Fischen gerade das Ortsgedächtnis sehr gut ausgebildet zu sein. Sie gewöhnen sich z. B. sehr schnell daran, bestimmte Stellen, wo sie gefüttert werden, regelmäßig und sogar zu bestimmten Zeiten aufzusuchen.
Geschmack, Geruch und ein hochentwickelter Ortssinn scheinen jedenfalls die wichtigsten Faktoren zu sein, die den Fischen auf ihren Wanderzügen die Richtung angeben. Dagegen muß es sehr zweifelhaft erscheinen, ob diese Orientierung in zielbewußter,[S. 165] verstandesmäßiger Weise ausgeführt wird. Die meisten Handlungen des Tiers lassen sich letzten Endes auf angeborene Triebe, die automatisch in Tätigkeit treten, zurückführen, worauf wir in einem späteren Kapitel näher zurückkommen werden. So dürfen wir also annehmen, daß die Orientierung der Fische im Unterbewußtsein erfolgt, indem Gedächtnis und Assoziation reflektorisch das Streben nach einem Gewässer mit einem bestimmten Geruch und Geschmack auslösen, und die Ausführung dieses angeborenen Wunschgefühls durch einen Reiz der Geschmacks- und Geruchsnerven ermöglicht wird.
Die innere Unruhe, die den laichreifen Fisch auf die Wanderschaft treibt, müssen wir ebenfalls auf einen angeborenen Trieb zurückführen, der sich zugleich mit dem Erwachen des Geschlechtstriebes einstellt.
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Zugvögeln. Der im Organismus des Vogels einsetzende Zugtrieb veranlaßt die Zugbewegung im Herbst, wobei freilich der Geschlechtstrieb nicht in Frage kommt. Anders liegen aber die Verhältnisse im Frühjahr. Hier erfährt der Zugtrieb des Vogels durch den gleichfalls erwachenden Fortpflanzungstrieb eine wesentliche Verstärkung, die sich darin zeigt, daß der Frühjahrszug bedeutend schneller verläuft als der Fortzug im Herbst. Die Allmacht der Liebe erzeugt in der Vogelseele das Bestreben, möglichst schnell nach dem Brutplatz der Heimat zu gelangen, und beschleunigt daher die Geschwindigkeit auf dem Zuge. Der weiße Storch durchmißt auf dem Herbstzuge täglich ca. 120–200 km, auf dem Frühjahrszuge dagegen 400 km. Ebenso wie die Fische zeigen auch die Zugvögel im allgemeinen das Bestreben, zur Fortpflanzung dorthin zurückzukehren, wo sie selbst das Licht der Welt erblickt haben. Die Rückkehr in die Heimat zur Zeit der geschlechtlichen[S. 166] Reife scheint also ein Naturgesetz zu sein, das im Tierleben weittragende Bedeutung hat.
Andererseits tritt auch ein grundlegender Unterschied zwischen den Wanderungen der Fische und dem Zuge der Vögel hervor. Der Laichplatz, den der wandernde Fisch aufsucht, ist seine Geburtsstätte, also ein Ort, an dem er schon einmal gewesen ist, und an den er sich eine Erinnerung bewahrt haben kann. Dies ist aber beim Zugvogel nicht der Fall. Der junge Vogel, der sich zum ersten Male im Herbst auf die Reise begibt, kennt weder das Land, dem er zustrebt, noch den Weg, der hinführt, denn er war ja noch niemals dort. Trotzdem findet er auf unbekanntem Wege in das unbekannte Land der Winterherberge, und zwar ohne Führung älterer Artgenossen oder seiner Eltern, denn viele Vögel, wie z. B. Raubvögel, der Kuckuck und andere, ziehen nicht gesellig, sondern einsam. Hier kann also von einer zielbewußten Orientierung überhaupt keine Rede sein, denn es fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, da sowohl der zurückzulegende Weg wie das Ziel der Reise völlig unbekannt sind. Es kann sich also nur um eine automatische Seelenfunktion handeln, die ohne Verstand, lediglich im Unterbewußtsein vollbracht wird, und darum nehmen wir Ornithologen an, daß dem Zugvogel zugleich mit dem Zugtrieb auch die Fähigkeit angeboren ist, eine bestimmte, zweckmäßige Richtung, die in ein geeignetes Winterquartier führt, auf der Wanderung einzuschlagen. Hierbei kann es sich natürlich nur um eine allgemeine Richtung handeln, z. B. im Herbst nach Westen oder Süden zu fliegen. Dagegen können wir nicht annehmen, daß das Innehalten eines komplizierten Wanderwegs, der seine Richtung vielfach ändert, auf reiner Vererbung beruhen soll. Hier müssen noch andere, von der Außenwelt stammende Reize hinzukommen, und diese Reize geben vermutlich die Wasserläufe,[S. 167] die Flüsse und Meeresküsten, denen die Zugvögel mit Vorliebe folgen. Dies gab mir Veranlassung, eine doppelte Art der Orientierung der Zugvögel anzunehmen, die ich in meiner Schrift „Die Rätsel des Vogelzuges“ grobe und feine Orientierung genannt habe. Die grobe Orientierung, d. h. die Fähigkeit, einer bestimmten Himmelsrichtung zu folgen, ist eine angeborene Eigenschaft, die feine Orientierung erfolgt durch äußere Reize. In dieser Richtung fliegt der Zugvogel so lange, als der Zugtrieb in ihm rege ist. Hört der Zugtrieb auf, so bleibt der Vogel dort, wo er sich gerade befindet, und diese Stelle ist eben sein Winterquartier. Die Dauer des Zugtriebes ist von der Natur so abgestimmt, daß sie zu der Länge des Zugweges bei normaler Flugleistung im gleichen Verhältnis steht. Auf diese Weise wird auch die Frage, wie der junge Vogel, der zum ersten Male allein ohne Führung seiner Eltern die weite Reise ausführt, das entfernte, ihm unbekannte Winterquartier findet, ohne Schwierigkeit gelöst. Er strebt überhaupt nicht einem bestimmten Ziele zu, sondern das Ziel der Reise ergibt sich von selbst aus dem Erlöschen des Zugtriebes.
Wir sehen hieraus, wie automatisch, rein triebmäßig eine Zugbewegung verlaufen kann, und dies dürfen wir bei anderen Tieren, die wie die Fische geistig erheblich hinter den Vögeln zurückstehen, erst recht vermuten. —
Wenn wir von den Fischen uns weiter zurück in das Reich der Tiere wenden, so finden wir wieder bei den Insekten große Wanderungen, die hauptsächlich der Suche nach geeigneten Nahrungsplätzen gelten.
Berüchtigt seit alten Zeiten sind die Wanderzüge der Wanderheuschrecke, die in mehreren Arten Südeuropa, Afrika, Asien und Amerika bewohnt. Eine der sieben Plagen, die zu Moses Zeiten[S. 168] Ägypten heimsuchten, war das Massenauftreten der Heuschrecken, die das Land verwüsteten. Berühmt ist die anschauliche Schilderung, die der Prophet Joel (Kap. II, 2–10) von einer über Palästina hereinbrechenden Heuschreckenverheerung gibt. Er vergleicht die Heuschrecken mit einem feindlichen Heer, das plündernd und sengend das Land durchzieht: „Vor ihm geht ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüste Einöde. Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen rasseln, und wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Streit gerüstet ist. Sie werden laufen wie die Riesen und die Mauern ersteigen wie die Krieger. Sie werden in der Stadt umherreiten, auf der Mauer laufen und in die Häuser steigen, und wie ein Dieb durch die Fenster hineinkommen. Vor ihm erzittert das Land und bebet der Himmel; Sonne und Mond werden finster, und die Sterne verhalten ihren Schein.“
Diese klassische Schilderung des Propheten entspricht durchaus der Wirklichkeit. Zu Myriaden, in dichtgedrängter Masse fallen die Heuschrecken gleich einem Wolkenbruch in das Land ein und vernichten in kurzer Frist Felder, Weinberge, Anpflanzungen und Gärten. Alles Grün ist kahl gefressen, das Land ist auf weite Strecken völlig verödet und gleicht den traurigen Verheerungen einer gewaltigen Feuersbrunst. Brehm berichtet in seinem „Tierleben“, daß eine aus vierzigtausend Pflanzen bestehende Tabaksplantage innerhalb einer halben Minute von einem plötzlich einfallenden Heuschreckenschwarm völlig vernichtet wurde. Die Tiere bedeckten wie ein dichter Mantel die ganze Anpflanzung, die völlig verschwunden war, als der Schwarm nach einer halben Minute sich erhob und weiterzog, um das grausige Werk an anderer Stelle fortzusetzen.
[S. 169]
Schon die ungeflügelten Heuschreckenlarven begeben sich in großen Scharen zu Fuß auf die Wanderschaft und ziehen plündernd durch das Land. Durch Hineinreiten und Schwenken mit Tüchern wissen die Farmer die gefräßigen Tiere von ihren Anpflanzungen abzuhalten, während man gegen den Überfall der erwachsenen Flugheuschrecken völlig machtlos ist.
Im Altertum und im Mittelalter scheinen die Heuschreckenplagen gewaltiger und zahlreicher gewesen zu sein, als es in unserer Zeit der Fall ist, obwohl die Nachrichten über Verheerungen durch Heuschrecken bis heutigen Tages nicht verstummen. Besonders Afrika hat unter der Plage zu leiden. Im Jahre 1799 wurde fast ganz Marokko von den Heuschrecken verwüstet, und ein Jahr später wiederholte sich dasselbe Schauspiel in Kleinasien. 1747 fand ein großer Einbruch in Europa vom südlichen Rußland aus statt. Gewaltige Schwärme traten zuerst in Ungarn auf, verbreiteten sich von hier über Süddeutschland bis nach Frankreich und zogen sogar über den Kanal nach England. Selbst über das offene Meer nehmen die Heuschrecken ihren Weg. Berger beobachtete einen Flug Wanderheuschrecken mitten auf dem Ozean auf der Fahrt von Hongkong nach Manila. —
Zu Anfang des 17. Jahrhunderts erregte eine wundersame, gespensterhafte Erscheinung die Aufmerksamkeit der Menschen. Eine graue, 3–4 m lange Schlange bewegte sich in langsam schlängelnden Windungen durch das Dunkel des Waldes. Das seltsame Gespenst trat hin und wieder in Deutschland sowie in Schweden und Norwegen auf. Eine nähere Untersuchung ergab, daß die Schlange aus zahllosen kleinen Würmern bestand, die in dichtgedrängter Masse über den Waldboden wanderten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelang es durch wissenschaftliche Forschungen festzustellen, daß diese Würmer die Larven einer[S. 170] Mücke sind, die nach dieser eigenartigen Erscheinung Heerwurm-Trauermücke (Sciara militaris) benannt wurde. Die Larven nähren sich von den auf dem Boden des Laubwaldes liegenden faulenden Blättern und leben meist versteckt unter dem Fallaub. Zu ihrem Gedeihen bedürfen sie eines bestimmten Feuchtigkeitsgrades. Allzu große Trockenheit wird ihnen ebenso verderblich wie übermäßige Nässe. Sagt ihnen die Feuchtigkeit ihres Aufenthaltsorts nicht zu, dann scharen die Larven sich zusammen und wandern, ein langes, finger- bis handbreites Band bildend, aus, um eine andere Gegend aufzusuchen. Die einzelne Larve in dem langen Zuge bewegt sich nach Art der Raupen fort, indem sie den Körper nach oben krümmt, den hinteren Teil des Leibes vorschiebt und den vorderen Teil ausstreckt. Hierdurch erhält der wandernde Heerwurmzug eine wogende, wellenförmige Bewegung.
Mit dem Heerwurm verband sich allerhand Aberglauben. Zog ein Heerwurm talabwärts, so deutete man hieraus auf Frieden und reiche Ernte, bewegte er sich bergan, so wurde Krieg und Unglück prophezeit. Wer einem Heerwurm im Walde begegnete, legte seine Kleider vor ihn auf den Weg. Kroch der Heerwurm darüber fort, so galt dies als ein glückbringendes Orakel, wich er dem Kleidungsstück aus, dann lautete die Wahrsagung auf Unheil und Tod.
Die weit verbreitete Gattung der Trauermücken „Sciara“ hat ihren Namen nach den dunkeln Flügeln dieser Insekten erhalten, die in Laubwäldern leben.
Ähnliche Wanderungen wie beim Heerwurm finden wir auch bei den Raupen des Prozessionsspinners, die an Eichen, Kiefern und anderen Nadelhölzern leben. Sind die Bäume ihres Aufenthaltsorts kahl gefressen, so verlassen die Prozessionsraupen ihren Aufenthaltsort und kriechen, wie der Heerwurm ein dichtes Band[S. 171] bildend, nach anderen Bäumen, deren Laub ihnen Nahrung spendet.
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners (Cnethocampa processionea) spinnen sich am unteren Teil des Stammes, am liebsten in einer Astgabel, ein Nest aus lockerem Gewebe, in dem sie den Tag verbringen. Bei der Abenddämmerung verlassen sie ihre Behausung und kriechen im Gänsemarsch, eine hinter der anderen, am Baumstamm zur Krone herauf, um hier die Blätter zu verzehren. Sind die Tiere sehr zahlreich, dann bilden sie auf ihrem Nahrungszuge einen Keil. Eine Raupe übernimmt an der Spitze die Führung, ihr folgen paarweise geordnet zwei Raupen, und die nächsten Glieder sind zu dreien, vieren usw. gebildet. Haben sich die gefräßigen Tiere gesättigt, so begeben sie sich in ihre Behausung zurück. Dieser eigentümliche, an eine Prozession erinnernde Marsch hat dem Schmetterling den Namen „Prozessionsspinner“ gegeben. —
[2] Friedrich von Lucanus, Die Rätsel des Vogelzuges. Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Luftfahrt und Vogelberingung. Verlag Beyer & Söhne, Langensalza. 2. Auflage 1923.
[S. 172]
„Alles Leben und alle Bewegung auf unserer Erde wird mit wenigen Ausnahmen unterhalten durch eine einzige Triebkraft, die der Sonnenstrahlen, welche uns Licht und Wärme bringen.“ Diese Worte des großen Physikers Helmholtz zeigen die gewaltige Bedeutung der Sonne für das organische Leben auf der Erde. Ohne Sonne wäre eine Entwicklung des Lebens gar nicht denkbar gewesen. Sie ist die Quelle und die Ursache alles Lebens. Entziehen wir der Pflanze nur für kurze Zeit das Sonnenlicht, so verkümmert sie. Der menschliche und tierische Körper verfällt, des Sonnenlichts beraubt, elendem Siechtum. Das Sonnenlicht ist der ärgste Feind jener kleinsten Organismen, die als Bakterien unser Dasein bedrohen. Die heilende Wirkung der Sonnenstrahlen kann durch nichts ersetzt werden.
So wichtig Sonnenlicht und Sonnenwärme für die organische Welt auch sind, so gibt es dennoch sogar unter den höherstehenden Tieren solche Formen, die das Sonnenlicht scheuen, ja für die Nacht und Finsternis notwendige Lebensbedingungen sind.
Wie sagt doch Rückert vom Maulwurf?
Der Maulwurf ist nicht blind, wie der Dichter sehr richtig sagt, aber er hat nur sehr kleine Augen, die nicht größer sind als ein Mohnkorn. Da sie außerdem von den Gesichtshaaren ganz überwachsen sind, können sie für ein Sehen kaum oder nur sehr gering in Betracht kommen. Da der Maulwurf ganz auf eine unterirdische Lebensweise eingestellt ist und er seine Nahrung, die hauptsächlich aus Regenwürmern und Engerlingen besteht, im Dunkeln unter der Erde sucht, so bedarf er des Augenlichts nicht in der Weise wie andere Tiere. Seine Orientierung erfolgt ausschließlich mit dem hochentwickelten Geruchssinn und dem ebenfalls vorzüglich ausgebildeten Gehör. Mit dem Geruch spürt der Maulwurf seine Nahrung auf, während er mit dem Gehör sich vor Gefahren schützt. Das leiseste Geräusch, das von außen in seine unterirdischen Gänge dringt, nimmt er sofort wahr und veranlaßt ihn, sich tiefer einzugraben.
Die Vorderfüße des Maulwurfs stellen ein ganz hervorragendes Werkzeug zum Graben dar. Die mit starken, flachen Nägeln bewaffneten Hände sind sehr breit und bilden eine Grabscheitfläche. Durch einen besonderen Knochen, das Sichelbein, das sich dem Daumen anreiht, wird die Handfläche verstärkt und verbreitert.[S. 174] Damit das Tier bei seinen unterirdischen Arbeiten sich leicht durch das Erdreich hindurchzwängen kann, sind die Arme sehr kurz und ganz am Körper verborgen, so daß nur die nach rückwärts gedrehten Hände aus dem Fell hervorragen, die schraubenartig bewegt werden können, was für die Grabarbeit von größtem Nutzen ist. Der Oberarm ist nicht wie bei anderen Säugetieren an das Schulterblatt, sondern an das Schlüsselbein angesetzt und ebenfalls sehr beweglich. Ober- und Unterarm stellen kurze, sehr kräftige Schrauben dar, die dem Maulwurf die Arbeit des Grabens schnell und mühelos ermöglichen. Bei seinen Minierarbeiten zieht der Maulwurf den Kopf möglichst weit ein und schaufelt dann die Erde mit den Händen vor sich fort. Er verrichtet die Arbeit so schnell, daß er auch in horizontaler Richtung unter der Erde rasch vorwärts kommt, ja geradezu im Erdreich läuft oder, richtiger gesagt, „schwimmt“, denn ein Schwimmen ist gewissermaßen die Bewegung der grabenden Hände und das Vorwärtsgleiten des Körpers. Wenn sich die Erde hierbei zu sehr vor ihm anhäuft, dann wirft er sie mit dem Kopf nach oben heraus, wodurch die bekannten Maulwurfshügel entstehen.
Auch die übrige Ausrüstung des Körpers ist dem unterirdischen Leben vortrefflich angepaßt. Das Fell besteht aus ganz kurzen, dichten, samtartigen Haaren, die beim Wühlen in der Erde ihre Lage nicht verändern und sich infolgedessen nicht abscheuern. Anstatt eines äußeren Ohres ist nur ein Gehörspalt vorhanden, der durch eine Hautfalte verschlossen werden kann, um ein Eindringen von Erde zu verhüten. Die Nasenlöcher liegen auf der Unterseite der rüsselartig verlängerten Oberlippe und sind hierdurch gegen eine Verunreinigung durch Sand geschützt. Die Oberlippe trägt eine besondere Hautfalte, welche die Unterlippe verschließt und so ein Eindringen von Erde in den Mund verhütet.[S. 175] Schließlich ist die walzenförmige Gestalt des ganzen Körpers zum Fortgleiten in der Erde außerordentlich geeignet.
So sehr der Maulwurf auch auf eine unterirdische Lebensweise angewiesen ist, so scheut er doch das Tageslicht nicht völlig. Wenn auch nicht oft, so begibt er sich doch hin und wieder ins Freie, sucht dann mit Vorliebe in Wagengleisen nach Nahrung oder genießt sogar für kurze Zeit die wohltuende Wärme der Sonne. Besonders junge Tiere kommen öfters ins Freie als alte. Man hat schon wiederholt junge Maulwürfe beobachtet, die an sonnigen Hängen zusammen spielten.
Noch einige Worte über den Nutzen und Schaden des Maulwurfs, worüber die Ansichten geteilt sind. Durch das Verzehren von Engerlingen und anderen schädlichen Insektenlarven ist der Maulwurf zweifellos sehr nützlich. Da er aber auch Regenwürmer sehr liebt und diese als „Erdarbeiter“ nützlich sind, weil sie die Bildung der wichtigen Humuserde befördern, so wird er hierdurch zum schädlichen Tier. Ferner macht er im Walde in jungen Kulturen und in Gärten durch seine Wühlarbeit manchen Schaden, indem er die Wurzeln der Pflanzen lockert. Auch tragen die Maulwurfshügel nicht gerade zur Verschönerung gepflegter Parkanlagen bei. Es geht mit dem Maulwurf wie mit so vielen Tieren, er ist eben beides, sowohl nützlich wie schädlich. Von Natur ist kein Tier nur schädlich oder nur nützlich. Jedes Tier hat vielmehr im Haushalte der Natur seine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Das Zusammenwirken aller Lebewesen erhält das Gleichgewicht in der Natur. Die Begriffe „schädlich“ und „nützlich“ sind erst durch die Kultur des Menschen geprägt worden, die leider über so viele Tiere das Todesurteil gefällt hat. Mit Recht hat es sich daher die moderne Naturschutzbewegung zur Aufgabe gemacht, die Tiere ohne Rücksicht auf ihre sogenannte Nützlichkeit und[S. 176] Schädlichkeit zu schützen und sie um ihrer selbst willen zu erhalten, um unsere Natur vor Verödung zu bewahren. —
Ein unterirdisches Leben wie der Maulwurf führen auch die afrikanischen Goldmulle und die zu den Nagetieren gehörende Blindmaus (Spalax typhlus). Die Augen dieser Tiere liegen nicht frei, sondern unterhalb der behaarten Kopfhaut und können daher zum Sehen überhaupt nicht mehr benutzt werden. Sie sind also blind. Trotzdem kommen auch diese Tiere ab und zu an das Tageslicht, um die Sonnenwärme zu genießen. Die Heimat der Blindmaus ist das südöstliche Europa, Westasien und Unterägypten. Ihre unterirdischen Gänge, die in geringer Tiefe laufen, führen sogar unter Flußläufen hindurch und an Berghängen entlang. Bei ihren Grabarbeiten benutzt die Blindmaus im Gegensatz zum Maulwurf mehr den Kopf als die Füße und besitzt hierfür eine ganz eigenartige Einrichtung. Von den Nasenlöchern bis zu den Augen zieht sich jederseits eine Reihe starrer, borstiger Haare. Mit dieser Bürste schiebt die Blindmaus durch Auf- und Abwärtsbewegen des Kopfes die Erde fort.
Die Goldmulle graben wie die Maulwürfe mit den Händen, benutzen sie aber in ganz anderer Weise. Bei den Goldmullen sind die Mittelfinger sehr groß und tragen einen starken Nagel. Die ganze Arbeit des Grabens wird mit diesem riesigen Mittelfinger geleistet, der hierbei als Spitzhacke verwendet wird. Er besitzt ferner eine tiefe Rille, in die die anderen, bedeutend kleineren Klauen, die keine Dienste beim Graben leisten, hineingelegt werden können.
Die Goldmullen führen ihren Namen nach dem schönen, grünlichen Metallglanz ihres Pelzes.
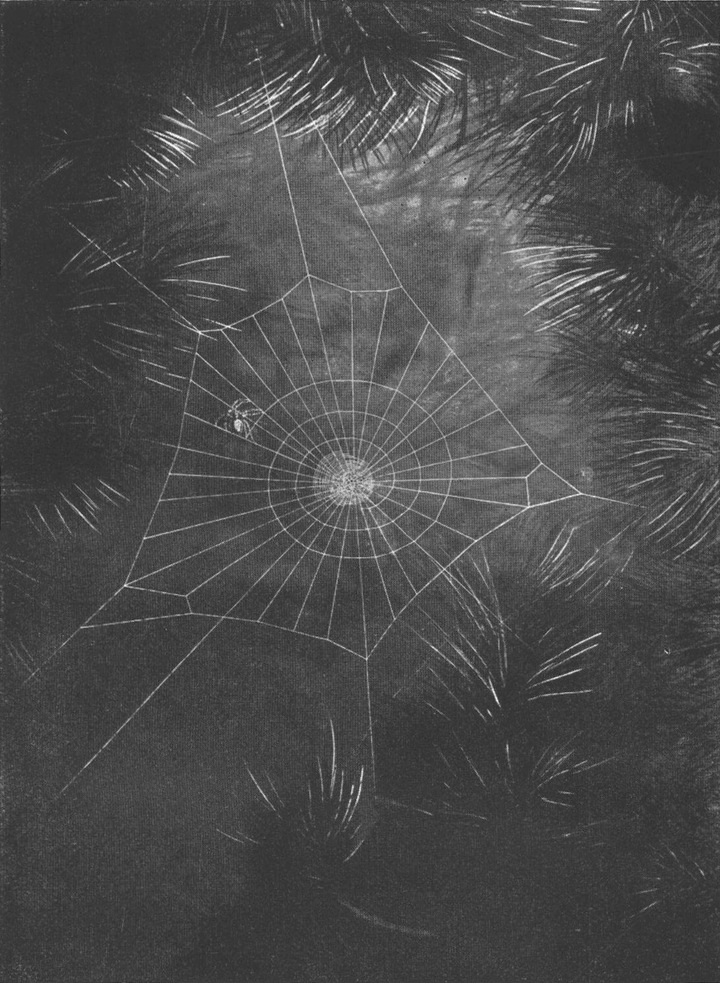

Ein Vogel, der ein völlig nächtliches Leben führt, ist der Guacharo oder Fettschwalk (Steatornis caripensis), den Alexander von[S. 177] Humboldt 1799 in der Felsenhöhle von Caripe in Venezuela entdeckte. Als der Forscher 150 m weit in die dunkle Höhle eingedrungen war, umschwirrten plötzlich geisterhafte Schatten den Schein der Fackeln. Es waren Vögel, die hier ihr Wesen trieben und mit ihrem lauten, krächzenden Geschrei einen gespensterhaften Spuk trieben.
Der Guacharo bewohnt die unterirdischen Höhlen der Anden, nistet hier in großen Kolonien und erzieht in völliger Finsternis seine Jungen. Nur zur Nachtzeit verlassen die Vögel ihr Felsenverlies, um im Waldesdunkel ihrer Nahrung, die aus Früchten besteht, nachzugehen. Noch vor Anbruch der Morgendämmerung sucht der Guacharo wieder sein unterirdisches Versteck auf.
Der Guacharo ist unserem Ziegenmelker nah verwandt, unterscheidet sich aber von ihm durch ein härteres Gefieder und seinen längeren, gekrümmten Schnabel, der an der Spitze einen Zahn trägt. Sein kastanienbraunes Federkleid ist gelblichweiß gefleckt. Er ist ein sehr gewandter Flieger, aber sehr unbeholfen zu Fuß. Er kann überhaupt nicht aufrecht gehen, sondern nur mühsam mit Unterstützung der Flügel kriechen. Der Körper des Fettschwalks hat eine ungeheure Fettschicht, die durch den Mangel an Bewegung und den ständigen Aufenthalt im Dunkeln hervorgerufen wird. Das Fett, ein dickflüssiges, helles Öl, wird von den Indianern als Speisemittel sehr begehrt. Sie fangen die Vögel, besonders die noch unflugfähigen Jungen, in den Nestern, in großen Mengen, lassen das Fett über dem Feuer aus und bewahren es in Tongefäßen auf, in denen es sich wegen seiner Reinheit jahrelang frisch und genießbar erhält.
Der Guacharo ist der einzige Vogel, der das Tageslicht völlig scheut und niemals die wohltuende Einwirkung der Sonne genießt.
[S. 178]
Ein nächtliches Leben führen auch die Ziegenmelker und die Eulen, ohne jedoch das Tageslicht so zu verabscheuen wie der Guacharo. Die Eulen pflegen am Tage behaglich der Ruhe im Sonnenschein (Abbildung 14). Ihr eigentliches Leben und Treiben beschränken jedoch die meisten Arten auf die Dämmerungsstunden und die Nachtzeit. Infolgedessen sind die Augen der Eulen sehr groß, um möglichst viel Lichtstrahlen aufnehmen zu können und hierdurch auch bei schwachem Lichtschein ein Sehen zu ermöglichen. Bei weitem besser als das Gesicht ist das Gehör der Eule ausgebildet. Sie ist imstande, die leisesten Geräusche, die für uns völlig unhörbar sind, wahrzunehmen. Mein zahmer Waldkauz erwachte sofort aus tiefem Schlaf, wenn ich eine weiße Maus auf dem Teppich laufen ließ, was nach unseren Begriffen gar kein Geräusch verursacht. Bei ihren Raubzügen im Dunkel der Nacht verläßt sich die Eule ganz und gar auf das Gehör, denn sie kann die Maus, die im düsteren Waldesgrunde auf dem dunkeln Erdboden läuft, unmöglich sehen. Lediglich das Geräusch verrät ihr die Beute. Ihr Gehörsinn ist so fein ausgebildet, daß sie die Richtung und die Stelle, aus der das Geräusch kommt, sofort richtig erfaßt, wie ich mich an meinen gefangenen Eulen oft genug überzeugen konnte. Die Ohröffnung der Eulen ist sehr groß. Vermöge einer besonderen Hautfalte können die strahlenförmig angeordneten Gesichtsfedern, welche den sogenannten Schleier bilden, senkrecht vom Kopf abgestellt werden, wodurch die Ohröffnung freigelegt wird, so daß die Schallwellen ungehindert eindringen können. Ein Kranz kleiner steifer Federn umgibt den hinteren Rand der Ohröffnungen. Sie sind konkav gebogen und dienen ebenfalls dem Auffangen der Schallwellen. Durch diese Federn wird dieselbe Wirkung erzielt, die wir durch Anlegen der hohlen Hand ans Ohr hervorrufen, um besser hören zu können. Bei den[S. 179] Eulen ist die feine und sinnreiche Konstruktion des Gehörapparats eine ganz vortreffliche Anpassung an das nächtliche Leben und ein hervorragender Ersatz für die Beeinträchtigung des Gesichts in der Dunkelheit.
Eine nächtliche Lebensweise führt der australische Kiwi oder Schnepfenstrauß (Apteryx australis). Er gehört zu den merkwürdigsten Vogelgestalten. Ebenso wie den Straußen fehlt seinem Brustbein der Kiel. Die Flügel sind völlig verkümmert und nur noch durch kurze Stummel angedeutet. Das Gefieder besteht aus zerschlissenen, lose herabhängenden, haarartigen Federn. Eine besondere Merkwürdigkeit ist die Lage der Nasenlöcher. Während sich diese bei allen anderen Vögeln an der Wurzel des Schnabels befinden, sitzen sie beim Kiwi vorn an der Spitze des sehr langen, sanft gebogenen Schnabels. Im Gegensatz zu anderen Vögeln scheint beim Kiwi der Geruchssinn gut ausgebildet zu sein. Wenn er in der Nacht das trockene Laub und den Erdboden nach Insekten und Würmern durchsucht, so hört man ein schnüffelndes Geräusch, was auf eine intensive Nasenarbeit hindeutet. Ferner ist der Schnabel bis zur Spitze mit zahlreichen Nervenzügen durchsetzt, die dem Tastvermögen dienen, das beim Kiwi außerordentlich fein entwickelt ist. Die Augen sind nur klein und können daher in der Dunkelheit keine großen Dienste leisten. Der Mangel des Gesichts wird durch den Geruch und den Tastsinn ersetzt.
Der Kiwi hält sich am Tage unter Baumwurzeln und in selbstgescharrten Erdhöhlen versteckt und ist nur in der Dämmerung und in der Nacht rege. Leider gehört der Kiwi zu den im Aussterben begriffenen Tieren. Die Verfolgung durch die Eingeborenen und nicht zum mindesten durch die in seiner Heimat sehr zahlreichen, verwilderten Hauskatzen hat seinen Bestand so sehr[S. 180] gelichtet, daß nur noch wenige Überreste von diesem interessanten Vogel ihr Leben fristen (Abbildung 15).
Auf den Malaiischen Inseln lebt ein absonderliches Säugetier, der Koboldmaki oder das Gespensttier (Tarsius tarsius). Dies kleine, etwa eichhorngroße Wesen, das zu den Halbaffen gehört, bewohnt die dichten Waldungen, verbirgt sich am Tage in dunkeln Schlupfwinkeln und turnt des Nachts mit sehr gewandten, geräuschlosen Sprüngen in den Baumzweigen umher, um Kerbtiere zu jagen. Beim Koboldmaki sind die Augen dem nächtlichen Leben sehr angepaßt. Sie sind ungeheuer groß und nehmen den größten Teil des Kopfes ein. Die großen löffelartigen Ohren lassen auf ein gut ausgebildetes Gehör schließen. Im Gegensatz zu den kurzen Vorderfüßen stehen die auffallend langen Hinterbeine, die dem Tier eine große Sprungkraft verleihen. Die Fußwurzel der Hinterbeine ist sehr verlängert und bildet wie bei den Vögeln einen zwischen Fuß und Unterschenkel eingeschalteten „Tarsus“. Er ist mit haarloser Haut bekleidet. Die Finger und Zehen sind gleichfalls nackt und sehr lang. Die vordersten Glieder sind breite, platte Teller, die vermutlich wie Gummischeiben eine saugende Wirkung haben und ähnlich wie beim Laubfrosch zum Festhalten dienen. Auch andere Halbaffen besitzen diese erweiterten, platten vorderen Zehenglieder. Mein zahmer Mongoz (Lemur mongoz) kletterte an der Kante völlig glatter Schränke in die Höhe, indem er sich mit den Fingerscheiben festsaugte, wobei ein quietschendes Geräusch entstand.
Auch die ebenfalls zu den Halbaffen zählenden Zwergmakis, Loris und Galagos sind ausgesprochene Nachttiere, die im allgemeinen das Tageslicht scheuen.
In den Gewässern der unterirdischen Höhlen in Krain, Dalmatien und der Herzegowina lebt ein merkwürdiger Lurch, der[S. 181] erst vor 200 Jahren bekannt gewordene Olm. Er hat einen langen wurmartigen Körper mit vier sehr kleinen, dünnen Füßchen und einen hechtartigen Kopf. Seine Farbe ist gelblichweiß oder hell fleischfarben, die Büschelkiemen sind blutrot. Als ausgesprochenes Wassertier atmet der Olm während seines ganzen Lebens durch Kiemen, ohne wie die anderen Lurche eine Verwandlung durchzumachen. Die nur punktgroßen, zurückgebildeten Augen sind von der Kopfhaut überwachsen und vermögen nur Helligkeitsunterschiede wahrzunehmen, aber keine Gegenstände zu erkennen. Die Lichtempfindlichkeit erstreckt sich sogar über die Haut des ganzen Körpers. Gefangene Olme meiden jeden Lichtstrahl und halten sich stets in der dunkelsten Ecke ihres Behälters auf. Die Finsternis ist ihr wahres Lebensbedürfnis. In seiner Heimat wird der Olm regelmäßig in größerer Menge für den Tierhandel gefangen. Er ist ein langweiliger Gesell, der seinem Pfleger wenig Freude, aber um so mehr Mühe macht. Zu seinem Gedeihen bedarf er eine beständige Wassertemperatur von 9–11 °C, muß stets im Dunklen gehalten werden und an einem völlig ruhigen Ort stehen, da er Erschütterungen nicht verträgt. Das Futter besteht in Regenwürmern, kleinen Fischen und Fleischstückchen. In vielen Fällen verschmähen gefangene Olme jegliche Nahrung und gehen bald zugrunde.
Unter den Amphibien führen auch die Blindwühlen ein völlig unterirdisches Leben. Die Blindwühlen besitzen keine Füße und gleichen mit ihrem walzenförmigen, langen Körper den Schlangen, müssen jedoch wegen ihres inneren Körperbaues und ihrer Entwicklung aus metamorphosierenden Larven zu den Amphibien gezählt werden. Die Larven verbringen eine kurze Zeit im Wasser, wie die Kaulquappen der Frösche. Das fertig ausgebildete Tier lebt jedoch nach Art der Regenwürmer in der Erde.[S. 182] Die Augen fehlen entweder ganz, oder sie sind mit einer Haut überwachsen und zum Sehen untauglich. Die Ohren sind verkümmert. Die Wahrnehmung ist ganz auf das Tastgefühl beschränkt, das durch einen nervenreichen Fühler vermittelt wird, der vor den rudimentären Augen liegt und vorgestreckt und zurückgezogen werden kann.
Die Heimat der Blindwühlen ist das äquatoriale Afrika, Asien und Amerika. Einzelne Arten wohnen in den Erdhaufen der Ameisen, die ihnen neben Insektenlarven und Regenwürmern als Nahrung dienen.
Eine ähnliche Lebensweise wie die Blindwühlen führen unter den Reptilien die Ringelechsen, die in ihrer Gestalt einem Wurm gleichen. Ihre glatte, lederartige Haut, der walzenförmige Leib und die völlig zurückgebildeten Gliedmaßen, die bei einigen Arten nur noch als stummelhafte Vorderfüße auftreten, bei anderen äußerlich ganz fehlen, machen den Körper der Ringelechsen in hohem Maße zum Wühlen in der Erde geeignet. Die kleinen Augen sind von der Körperhaut überwachsen, die Ohren fehlen völlig. Die meisten Arten hausen in den Haufen der Termiten und Ameisen und leben von deren Larven. Sehr auffallend ist es, daß die Ameisen, die sonst wütend über fremde Tiere, die in ihren Bau eindringen, herfallen, die Ringelechsen ruhig dulden. Die Ringelechse folgt sogar den Ameisen, wenn diese ihren Bau verlassen und eine neue Wohnstätte errichten. —
Auch unter den Schlangen gibt es einige Arten, die wie die Regenwürmer in der Erde leben und auch ein wurmähnliches Aussehen haben. Die Blindschlangen (Typhlopidae) ähneln den Regenwürmern so sehr, daß nur bei genauer Betrachtung die schlängelnden Bewegungen und das charakteristische Züngeln ihre Schlangennatur verraten. Das sehr kleine, bei manchen Arten[S. 183] völlig verkümmerte Auge ist von den Kopfschilden überdeckt. Die Blindschlangen bewohnen die Tropenländer der Alten und Neuen Welt. Eine Art kommt auch in Griechenland und Kleinasien vor.
Ausgesprochene Nachttiere sind die Geckos, welche in mehr als 200 Arten über die warmen Länder der ganzen Erde verbreitet sind und sowohl die Wälder wie die Wüstenregionen bewohnen (Abbildung 16). Viele Arten bevorzugen zu ihrem Aufenthalt sogar die menschlichen Wohnhäuser.
Die Geckos gehören zur Familie der Haftzeher, die an den Zehen blattartige Scheiben tragen, mit denen sie sich ansaugen und auch an völlig glatten Flächen festhalten können. Nach Art der Fliegen laufen die Geckos an Fensterscheiben, den Zimmerwänden, ja sogar an der Decke umher. Am Tage verbergen sie sich in den Ritzen und Spalten des Mauerwerks und werden erst am Abend rege, um in der Nacht bis zur Morgendämmerung ihr gespensterhaftes Wesen zu treiben. Ihre Nahrung besteht in Fliegen und anderen Insekten. Die Farbe der meisten Geckos ist ein unscheinbares Grau oder Braun, nur wenige Arten, die in Wäldern wohnen, sind grün oder bunt gefärbt.
Die frühere Annahme, daß das Ansaugen der Zehen durch einen klebrigen Stoff erfolge, ist durch neuere Untersuchungen widerlegt worden. Die Saugscheiben haften nur durch Luftdruck. Der Vorgang ist folgender. Das Tier preßt die Saugscheiben fest an einen Gegenstand an und verringert dann den Druck. Durch besondere Muskeln werden die Haftscheiben in der Mitte etwas hochgezogen, wodurch ein luftleerer Raum entsteht, dessen saugende Wirkung die Zehen an der Unterlage festhält.
Das Auge der Geckos ist ganz für das nächtliche Leben eingestellt. Es ist sehr groß und stark gewölbt, kann also sehr viel Lichtstrahlen aufnehmen. Die Pupille kann so sehr erweitert werden,[S. 184] daß die lebhaft, meist rötlichgelb gefärbte Iris dann nur noch als kleiner Kreis sichtbar ist.
Wie alle Eidechsen sind die Geckos ungeheuer lebhaft. Wenn sie am Abend ihre Schlupfwinkel verlassen haben, dann beginnt ihr neckisches Spiel. In hastigem Vorschießen ergreifen sie eine Fliege oder Spinne, in schlängelnden Bewegungen gleiten sie an den Wänden entlang, spielen und raufen miteinander.
Der unkundige Eingeborene verfolgt und tötet die harmlosen Geschöpfe, unbekümmert um den großen Nutzen, den sie durch Vertilgen der gerade in den Tropen so lästigen Insekten stiften. Man glaubt, daß in ihren Haftzehen ein gefährliches Gift enthalten sei, dessen Berührung dem Menschen den Tod bringt. In Dalmatien herrscht noch heute der Aberglaube, daß die Speisen oder Gefäße, über die ein Gecko gelaufen ist, vergiftet seien. Einen besseren Ruf genießt der Gecko in Siam. Hier lebt der Tokee (Geco verticillatus), der zu den größten Arten gehört und eine Körperlänge von 36 cm erreicht. Er wird als Glücksbringer geschätzt und daher sorgsam in den Häusern und Wohnungen behütet. Er macht sich durch ein eigenartiges Gegacker bemerkbar und läßt außerdem einen zweisilbigen Ruf hören, der wie die Silben „to—ke“ klingt, wonach der kleine Schelm seinen Namen erhalten hat. An seinen Ruf knüpfen sich allerhand Märchen und Sagen. Bringt der Gecko ihn mehrmals hintereinander hervor, so verheißt dies Glück und Segen, während seine Schweigsamkeit bei festlichen Anlässen als unheilvolles Orakel gedeutet wird. Sogar ein Spiel hat man für den Ruf des kleinen Hausfreundes ersonnen. Es gewinnt diejenige Losnummer, welche der Gecko bei der mehrmaligen Wiederholung seiner Stimme ausruft. —
Ein gewaltiges und wundersames Tierleben herrscht in den dunkelen Tiefen des Meeres. Hier begegnen wir Tieren von den[S. 185] absonderlichsten Gestalten, die sich ihren Weg in der ewigen Finsternis mit Lampen erleuchten.
Die lichtarme Tiefsee beginnt in einer Tiefe von 400 m unter dem Meeresspiegel. Die Einflüsse der Jahreszeiten und der Witterung fehlen hier völlig. Das Wasser ist dauernd still und unbeweglich. Seine Temperatur ist sehr niedrig, häufig dem Gefrierpunkt nahe und stets gleichbleibend. Eine weitere Eigenschaft der Tiefsee ist die Lichtarmut. In größeren Tiefen unterhalb 1000 m herrscht sogar völlige Finsternis.
In der Tiefsee sind also die Lebensbedingungen völlig anders als im Flachwasser, und zwar handelt es sich nicht nur um geringfügige biologische Veränderungen, sondern um gewaltige, durchgreifende Faktoren. So ist es von vornherein klar, daß die Bewohner der Tiefsee gänzlich anders organisiert sein müssen als alle anderen Lebewesen. Mit Recht nennt Dofflein die Tiefsee ein ungeheures Experiment der Natur, in dem die normalen Lebensbedingungen künstlich abgeändert, ja geradezu ausgeschaltet sind.
Mit Rücksicht auf die gleichmäßige Temperatur in der Tiefsee sind ihre Bewohner stenotherm, d. h. sie sind lediglich auf eine bestimmte Außentemperatur eingestellt und können keine Temperaturschwankungen ertragen.
Ferner ist der Körper aller Tiefseebewohner sehr zart. Er zerreißt und zerbricht sehr leicht. Das Skelett der Tiefseefische und die Schalen der Tiefseekrebse sind auffallend dünn im Vergleich zu den in höheren Wasserschichten lebenden Tieren. „Es ist ein sehr verblüffender Anblick,“ sagt Dofflein, „wenn man das freipräparierte und getrocknete Skelett eines Tiefseefisches vor sich liegen hat; denn es gleicht einem Häufchen dünner Papierblättchen und wiegt nur wenige Gramm.“
[S. 186]
Der zarte Körperbau und die schwachen Knochenteile sind offenbar eine Folge der Unbeweglichkeit des Wassers in der Tiefe des Meeres. In dem ruhigen Element fehlen der Zug und Druck, die eine Bewegung des Wassers hervorrufen, und die einen starken, widerstandsfähigen Körperbau verlangen. Infolgedessen haben Tiere, die in bewegtem Wasser leben, und noch mehr solche Arten, welche der Brandungszone ausgesetzt sind, starke Muskulatur und feste Knochen, unter Umständen sogar besondere Einrichtungen, sich am Boden festzuklammern, oder an Gegenständen anzusaugen, wie die Aktinien. Alles dies fehlt dem Körper der Tiefseetiere.
Die Tiefseetiere leben beständig unter einem starken Wasserdruck, der aber infolge der absoluten Ruhe des Wassers stets gleichbleibt. Auch hierfür mag der weiche, zarte Körperbau sehr günstig sein.
Die meisten Tiefseetiere erleiden, wenn sie an die Oberfläche gebracht werden, starke Beschädigungen. Die Ursache liegt jedoch weniger in der Druckveränderung, wie der Laie meist annimmt, sondern in dem plötzlichen Temperaturwechsel und der Erschütterung des Körpers, der ja auf völlige Ruhe eingestellt ist.
Im Mittelmeer ist die Temperatur in der Tiefe wärmer als im Ozean, wo sie um den Nullpunkt liegt. Sie beträgt im Mittelmeer 12–13 °C. Werden in einer Zeit, wo die Lufttemperatur über dem Mittelmeer ungefähr dieselbe Wärme hat, Tiefseetiere herausgefischt, so bleiben sie in gutem Zustande. Unter diesen Umständen gelang es Dofflein, Tiefseetiere aus dem Mittelmeer mehrere Tage am Leben zu erhalten.
Von großem Einfluß auf die Sinnesorgane der Tiefseetiere ist die Lichtarmut in den Tiefen des Meeres. Die Augen sind entweder ganz verkümmert, oder sie zeichnen sich durch gewaltige Größe und absonderliche Gestalt aus.
[S. 187]
Da gibt es Fische mit Teleskopaugen, die weit aus dem Kopf herausragen. Sie sind röhrenförmig und unterscheiden sich von den Augen anderer Fische hauptsächlich durch ihre Stellung. Während die normalen Fischaugen an den Seiten des Kopfes liegen, so daß jedes Auge sein eigenes Gesichtsfeld hat und daher ein monokuläres Sehen erfolgt, liegen die Teleskopaugen dicht nebeneinander in einer Ebene, entweder nach oben oder nach vorn gerichtet. Beide Augen überblicken also ein und dasselbe Gesichtsfeld. Das Sehen ist binokulär. Die sehr große Linse hat einen weiten Abstand von der Netzhaut. Die Hornhaut ist stark gewölbt. Durch einen besonderen Muskelapparat kann die Linse der Netzhaut willkürlich genähert werden, wodurch eine Akkommodation des Auges ermöglicht wird als Ersatz für die Starrheit der Pupille, die die Fische nicht vergrößern und verkleinern können. Die Funktion des Teleskopauges gewährleistet eine bestmögliche Ausnutzung des geringen Lichtes in der Tiefsee und eine leichte Wahrnehmung von Bewegungen.
Das Vorhandensein von Augen bei den Tiefseefischen, die sogar eine äußerst sinnreiche Organisation erlangt haben, deutet von vornherein darauf hin, daß in der Tiefsee keine völlige Dunkelheit herrschen kann, wie man es früher angenommen hat, wenigstens nicht in jenen Tiefen, in denen diese Fische leben. Ein gewisser Lichtschein muß auch noch in die größeren Tiefen des Meeres eindringen. Daß dies tatsächlich der Fall ist, haben die Versuche erwiesen, die man in neuerer Zeit mit photographischen Platten gemacht hat. Hiernach ist die Lichtintensität der Farbenstrahlen sehr verschieden. Nach Helland-Hansen ist die Einwirkung der roten Lichtstrahlen auf eine im Meer versenkte photographische Platte schon in einer Tiefe von 100 m sehr schwach, während die blauvioletten Strahlen bis zu 500 m Tiefe und die violetten und[S. 188] ultravioletten Strahlen sogar bis zu 1000 m eine Einwirkung erkennen ließen. Die meisten Tiefseefische steigen nicht tiefer als bis zu 500 m in das Meer hinab, und nur wenige Arten leben in größeren Tiefen, deren Grenze nach den heutigen Forschungen in etwa 1000 m liegt. So steht also den Tiefseefischen immer noch eine gewisse Lichtquelle zur Verfügung. Auch halten sich die Tiefseefische keineswegs ausschließlich in der Tiefsee auf, sondern dringen zeitweise auch in das Pelagial ein, d. h. in die oberhalb der Tiefsee gelegene Wasserschicht.
Die meisten Tiefseefische sind dunkel gefärbt, einige Arten rot und silberweiß. Die dunkeln Fische leben in den größten Tiefen von 1000 m, die roten in geringeren Tiefen, deren obere Grenze 500 m beträgt, und die silberglänzenden Fische oberhalb 500 m. In dieser Vertikalverteilung der Farben liegt ein vorzüglicher Schutz. Da die roten Lichtstrahlen in einer Tiefe von 500 m nicht mehr zur Geltung kommen, so sind die roten Fische hier unsichtbar. Die silberweißen Fische, welche in höheren Schichten leben und in das Pelagial bis zu einer Tiefe von 150 m heraufsteigen, sind wieder in ihrer hellen, glitzernden Farbe, die dem Wasser angepaßt ist, gut geschützt. —
Unter den in der Tiefsee vorkommenden Krebsen finden wir Formen mit riesenhaft großen Augen, die ein Zehntel, ja sogar fast ein Sechstel der Körpergröße erreichen. Ein kleiner, zu den Schizopoden gehörender Tiefseekrebs (Stylocheiron mastigophorum) hat Stielaugen von 1 mm Länge und ½ mm Breite bei einer Körpergröße von nur 6–8 mm Länge. Das sind Verhältnisse, wie sie unter den übrigen stieläugigen Krebsen nicht im entferntesten vorkommen. Das Auge der Tiefseekrebse ist ein überaus lichtstarkes optisches Instrument. Der Hintergrund des Auges ist stark glänzend, um das Licht der Leuchtorgane anderer Tiefseetiere,[S. 189] die den Krebsen zur Nahrung dienen, besser aufnehmen zu können.
Andere Tiefseekrebse haben völlig verkümmerte Augen, wie die japanische Tiefseekrabbe (Cyclodorippe uncifera). Dasselbe Tier kommt, wie sein Entdecker Chun feststellte, auch im Flachwasser vor und hat hier wohlentwickelte Augen. Die Larven der blinden Tiefseeform sind zunächst nicht blind, sondern haben Augen, die erst in der Metamorphose verkümmern. Die Krebslarven sind sehr beweglich und durchschwimmen weite Räume im Meer. Chun konnte nun feststellen, daß die Larven der Tiefseekrabbe sich viel schneller verwandeln als die Larven der im Flachwasser wohnenden Rasse. Diese abgekürzte Metamorphose verhindert, daß die Larve in höhere, hellere Regionen aufsteigt, in denen das Auge durch den Lichtreiz nicht verkümmern würde. Die Dunkelheit ist offenbar die Voraussetzung für die Bildung der rudimentären Augen der Tiefseeform.
Bei den blinden Tiefseekrabben sind als Ersatz für die verkümmerten Augen der Geruch und der Tastsinn sehr fein ausgebildet.
Viele Tiere der Tiefsee haben besondere Leuchtorgane am Körper. Sie strahlen in verschiedenen Farben, in Gelbgrün, Blauviolett und Rot. Der gelbgrüne Glanz ist der häufigste. Vielfach sind Leuchtkörper mit verschiedenen Farben an demselben Tier vereint.
Die Leuchtorgane treten am meisten bei den Tiefseefischen auf. Sie befinden sich hier an den verschiedensten Stellen des Körpers. Sie sitzen teils am Ende der Strahlen der Rückenflossen auf besonderen Tentakeln und werden hiernach Tentakelorgane genannt. Teils befinden sie sich auf den Barteln, an der Basis der Flossen, auf dem Kiemendeckel oder in der Umgebung der Augen. Schließlich können sie auch in symmetrischen Reihen an den Körperseiten,[S. 190] am Schwanz und auf dem Bauch liegen oder auch unregelmäßig über den ganzen Körper verteilt sein.
Der Bau der Leuchtorgane ist äußerst kompliziert und mannigfaltig. Das Leuchten ist nicht, wie man früher annahm, ein physiologischer Vorgang, der im Protoplasma selbst erzeugt wird, sondern nach Brauer, der sich eingehend mit der Erforschung der Tiefseefauna beschäftigt hat, ein chemischer Prozeß. Die Drüsen der Leuchtorgane sondern eine Ausscheidung ab, die in Verbindung mit Sauerstoff zum Leuchten gebracht wird. In vielen Fällen wird das Sekret nach außen abgesondert, es fließt ins Wasser und verbindet sich mit dem im Wasser enthaltenen Sauerstoff. Der Leuchtprozeß geht dann also außen vor sich. Bei anderen Leuchtorganen wird das Sekret nicht nach außen abgesondert, sondern der chemische Vorgang spielt sich im Innern des Körpers ab, indem der zum Leuchten notwendige Sauerstoff vom Blut des Fisches zugeführt wird. Die Lichtproduktion ist hier also eine intrazelluläre. Die Lichtstärke der Leuchtorgane beträgt etwa 0,0024 Mk[3].
Bei vielen Leuchtorganen sind die Drüsen, welche das Sekret absondern, mit einem Bindegewebe umschlossen, das nadelförmige Guaninkristalle enthält und wie ein Scheinwerfer wirkt, der das Licht zurückwirft. Ein Pigmentmantel hinter dem Reflektor blendet das Licht nach hinten ab. Das einzelne Leuchtorgan stellt also eine regelrechte Laterne dar. Die Leuchtorgane leuchten zum Teil nur auf einen besonderen Reiz, zum Teil dauernd. Im letzteren Falle können sie abgeblendet werden, indem sie mit Hilfe einer besonderen Muskulatur nach dem Körper zu umgedreht werden.
[S. 191]
Die Tiefseefische leben teils auf dem Meeresgrunde, teils in der darüberliegenden Wasserschicht. Erstere nennt man wissenschaftlich benthonische, letztere bathypelagische Fischarten. Die benthonischen Formen leben meist gesellig und nähren sich von wenig beweglichen Tieren. Sie sind daher im allgemeinen ruhig und träge. Die bathypelagischen Fische sind Einzelgänger und leben von beweglicher Beute. Sie sind daher sehr lebhaft und durchschwimmen auf der Suche nach Nahrung große Strecken sowohl in horizontaler wie in vertikaler Richtung im Meere. Viele bathypelagische Tiefseefische besitzen keine Schwimmblase, wodurch die Bewegung in vertikaler Richtung erleichtert wird. Die mit Gasen gefüllte Schwimmblase ist ein hydrostatischer Apparat, mit dessen Hilfe der Fisch jederzeit sein spezifisches Gewicht verändern und der Wassertiefe, in der er sich aufhält, anpassen kann. Die Schwimmblase verändert ihren Umfang je nach dem Wasserdruck, der auf dem Fischkörper lastet. Bei geringem Wasserdruck vergrößert sie sich, bei zunehmendem Wasserdruck wird sie verkleinert. Eine plötzliche Verringerung des äußeren Druckes kann sehr leicht eine Zerreißung der Schwimmblase durch die schnelle Ausdehnung der Gase hervorrufen. Dies tritt meist ein, wenn Tiefseefische im Netz an die Oberfläche gebracht werden. Die Verkümmerung oder das Fehlen der Schwimmblase bei vielen bathypelagischen Tiefseefischen ist also eine Anpassung an ihre Lebensweise. Sie sind dadurch imstande, bei ihren Beutezügen schnell tiefer und höher zu steigen, ohne Gefahr zu laufen, sich zu schädigen.
Muskulatur und Skelett der Tiefseefische sind weich und zart, die Haut ist häufig glatt und gallertartig.
Leuchtorgane finden sich außer bei Fischen auch bei Krebsen und Tintenfischen. Die Leuchtorgane der Krebse haben ihren Sitz teils[S. 192] an den Augen, teils auf der Unterseite des Körpers und sondern ein phosphoreszierendes Sekret ab.
Bei den Tintenfischen kommen zwei Formen von Leuchtorganen vor. Die einen scheiden aus Drüsen ein leuchtendes Sekret aus, die anderen besitzen einen Leuchtkörper und wirken als Laternen.
Die Ausscheidung des leuchtenden Sekrets aus den Drüsen ist bei einigen Arten sehr stark. Die Flüssigkeit ergießt sich als grünlich leuchtende Kugeln und Fäden ins Wasser und schützt das Tier in ähnlicher Weise wie der Tintenerguß der gewöhnlichen Tintenfische vor den Angriffen seiner Feinde. Diese werden durch die Leuchtmasse irregeführt und schnappen danach, in der Meinung, es sei ihre Beute, während der verfolgte Tintenfisch unterdessen entflieht.
In höchster Pracht treten die Leuchtorgane bei der Wunderlampe (Lycoteuthis diadema) auf. Dieser Tintenfisch besitzt 22 Leuchtorgane, die am Kopf unterhalb der Augen, an den langen Fangarmen und an den Bauchseiten sitzen und in den herrlichsten Farben erstrahlen. Ihr Licht ist schneeweiß, perlmutterfarben, himmelblau, dunkelblau und rot. Das ganze Tier sieht wie mit funkelnden Edelsteinen besetzt aus. Der Bau dieser napfförmigen, nach außen gewölbten Organe ist außerordentlich mannigfaltig. Es lassen sich nicht weniger als 10 verschiedene Systeme unterscheiden, nach denen diese 22 Laternen hergestellt sind.
Die Leuchtorgane der Tiefseetiere erfüllen offenbar verschiedene Aufgaben. Am nächsten liegt die Annahme, daß sie als Laterne dienen, um die nähere Umgebung des Tiers zu erleuchten. Ältere Autoren, besonders französische Forscher meinten, daß die finstere Tiefsee durch die Leuchtorgane ihrer Bewohner dauernd von einem milden Lichtschein erfüllt sei. Die Leuchtorgane sollten also[S. 193] ähnlich wirken wie die Laternen auf der Straße. Eine solche Wirkung scheint aber selbst bei einer starken Ansammlung der Tiere nicht möglich, da die Lichtintensität viel zu gering ist. Das Leuchten kann nur für das einzelne Tier auf kürzeste Entfernung in Betracht kommen. Auch ist die Anzahl der leuchtenden Tiere im Vergleich zu nicht leuchtenden Tieren viel zu gering, als daß eine allgemeine Beleuchtung dadurch erzeugt werden könnte. So sind nur 11 Prozent aller bis jetzt bekannten Tiefseefische mit Leuchtorganen ausgestattet. Man darf vielleicht vermuten, daß ein stark bevölkerter Raumteil der Tiefsee etwa den Eindruck eines Sternhimmels macht, aber auch nur eines schwachen Sternhimmels, an dem einzelne Pünktchen aufblitzen. Der Wert der Leuchtorgane für die Beleuchtung der Umgebung darf jedenfalls nicht zu hoch eingeschätzt werden. Dagegen dienen diese Organe offenbar noch anderen, bei weitem wichtigeren Zwecken. Ihre verschiedene Anordnung auf dem Körper der einzelnen Tierarten, ihre wechselnde Anzahl und die verschiedene Farbe des Lichts geben dem Träger ein bestimmtes Muster, das sich mit der Fleckung und Streifung buntfarbiger Tiere vergleichen läßt. Dies Muster dient wohl zur gegenseitigen Verständigung. Die einzelnen Arten erkennen sich daran untereinander. Ferner sind bei manchen Formen die Leuchtorgane geschlechtlich verschieden, haben also eine sexuelle Bedeutung. Schließlich spielen die Leuchtorgane eine wichtige Rolle für die Ernährung. Sie locken die Beutetiere herbei, die durch das Licht angezogen werden, ebenso wie der Schein einer Lampe die Insekten in der Nacht anlockt. In dem Gebrauch als Fangmittel liegt vielleicht der größte Wert der Leuchtorgane.
Man darf vermuten, daß die Bedeutung der Leuchtorgane als gegenseitiges Erkennungsmittel für die Art und das Geschlecht durch die verschiedene Lichtfarbe wesentlich unterstützt wird. Wir[S. 194] dürfen aber hieraus nicht unmittelbar den Schluß ziehen, daß die Tiere Farben wahrnehmen können. Auch wenn die Tiere farbenblind sind, kann die verschiedene Färbung des Lichtes doch von Nutzen sein, denn die Lichtintensität der Farben ist verschieden. Der Vorteil kann ebensogut auf einer Empfindung der wechselnden Lichtstärke der Farben beruhen, ohne daß diese selbst erkannt werden.
Die Tiefseetiere haben zum Teil ganz absonderliche Körperformen. Manche haben aalartige Gestalt mit einem abenteuerlichen Kopf. Der Schnepfenaal (Nemichthys scolopaceus) hat lange dünne Kiefer, die wie ein Schnepfenschnabel aussehen. Er erreicht eine Körperlänge von fast einem Meter. Der Pelikanaal (Macropharynx longicaudatus) hat einen gewaltigen Rachen mit langen, dünnen Kiefern, mit dem er Fische verschlingen kann, die größer sind als er selbst. Auch er erreicht die stattliche Körperlänge von 1,5 m. Überhaupt zeichnen sich viele Tiefseefische durch ein mächtiges Maul aus, das häufig mit gewaltigen Zähnen bewaffnet ist. Ein solches Riesenmaul mit zahlreichen, gefahrdrohenden Zähnen besitzt der zu den Fühlerfischen gehörende Melanocetus krechi. Der erste Strahl der Rückenflosse steht bei diesem Fisch ganz vorn auf dem Kopf und ist zu einem langen Arm ausgewachsen, der auf seinem vorderen Ende ein Leuchtorgan trägt. Der Fisch kann den Arm nach vorn ausstrecken und trägt dann seine Laterne vor sich her.
Unter den Leuchtsardinen der Tiefsee befindet sich eine Art, Bathypterois atricolor, die keine Leuchtorgane besitzt, dafür aber mit besonderen Tastorganen ausgerüstet ist. Auf jeder Kopfseite stehen zwei lange Fäden, die dem Tastgefühl dienen.
Unter den niederen Tieren fallen als Bewohner der Tiefsee besonders die prächtigen Glasschwämme auf, die in den verschiedensten[S. 195] Formen, als Becher, Röhren, Kelche, Körbe oder Füllhörner auftreten. In ihren zarten Weichteilen liegt ein durchsichtiges Kieselskelett, das einem wundersamen Flechtwerk aus zarten Glasfäden gleicht. Die Grundgestalt ist zwei- bis sechsstrahlig. Die einzelnen Strahlen verzweigen sich in zahlreiche Äste, die die wunderbarsten Formen annehmen, die in ihrer Mannigfaltigkeit nur noch von der Skelettbildung der Radiolaren übertroffen werden. Sie gleichen zierlichen Sträuchern, kleinen Tannenbäumchen oder Blütenkelchen.
Tiefseetiere wurden noch in Tiefen zwischen 4000 und 5000 m aufgefunden. Aus diesen ungeheuern Tiefen holte die Valdivia-Tiefseeexpedition, die 1898 unter der Führung des Professors Chun stattfand, im antarktischen Meer Strahlentierchen und kleine Ruderfußkrebse herauf.
Das Fischen der Tiefseetiere erfolgt mit einem besonderen Netz, Dredsche genannt. Es schleift auf zwei eisernen Schlittenkufen und ist 10 m lang. Es wird mit zwei eisernen Oliven im Gewicht von zusammen 50 kg beschwert. Das Stahlkabel, an dem das Netz hängt, ist ca. 20 mm stark und hat eine Druckfestigkeit von 5000 bis 8000 kg. Die Kabeltrommel der Valdivia-Expedition faßte 10000 m Kabel.
Die Netze bestehen aus Seidengaze, die mit einem derben Überzug versehen ist. Es können also die kleinsten Lebewesen, die dem Plankton angehören, darin gefangen werden. Zum Fischen in bestimmten Tiefen werden besondere Schließnetze verwendet. Sie werden verschlossen versenkt, in einer bestimmten Tiefe, die untersucht werden soll, geöffnet und vor dem Hochziehen wieder verschlossen. Vor dem Fischen erfolgt stets eine Tiefenlotung. Sowohl das Loten wie das Fischen in großen Tiefen ist eine überaus mühevolle, sehr schwierige Arbeit, die viel Geschick für den[S. 196] Fischer und die Schiffsmannschaft erfordert, da das Schiff den Bewegungen der Apparate genau folgen muß. —
Leuchtorgane besitzen auch einige Käfer, die hiernach „Leuchtkäfer“ benannt sind. Nur die Männchen unserer Leuchtkäfer sind geflügelt, während die Weibchen nur kleine verkümmerte Flügel besitzen und ein wurmartiges Aussehen haben. Die Leuchtorgane befinden sich an den Bauchringen in verschiedener Gestalt. Sie treten als Platten, Punkte und Flecken auf. Das Leuchten beruht auf einer Zersetzung von Fettstoffen, wobei jedoch keine Wärme erzeugt wird. Sogar die Larven und die Puppen besitzen bei einigen Arten schon Leuchtorgane, und bei dem in unseren Breiten vorkommenden großen Leuchtkäfer (Lampyris noctiluca) leuchten sogar die Eier. Die Farbe des Lichtes wechselt je nach der Art zwischen einem reinen Weiß und einem grünlichen oder bläulichen Schein. Das Leuchten erfolgt entweder blitzartig mit schnellen Unterbrechungen oder, wie bei unseren Leuchtkäfern, als ein gleichmäßiges Glimmern.
Das Leuchten dient zur gegenseitigen Anlockung der Geschlechter. Sobald ein leuchtendes Männchen durch die Luft fliegt, dann werfen sich die in der Nähe befindlichen Weibchen auf den Rücken und strecken den Leib empor, um ihr Licht leuchten zu lassen und sich nach Möglichkeit dem begehrten Liebhaber bemerkbar zu machen.
Wo die Leuchtkäfer in großer Zahl auftreten, verwandeln die lebenden Lämpchen die Landschaft in ein Märchenland. Überall in Hecken, Büschen und auf dem Erdboden glühen die Lichter mit ihrem zierlichen Schein, während die geflügelten männlichen Käfer wie feine Leuchtkugeln durch die Luft schwirren — ein Zauber aus Tausendundeiner Nacht.
Wunderbar ist das Schauspiel der Leuchtkäfer in den Tropen, wo sie zu Tausenden und aber Tausenden die Berghänge und Flußufer[S. 197] bewohnen. Hier leben jene Arten, deren Leuchtorgane blitzartig aufleuchten. Die in tiefes Dunkel gehüllte Landschaft erstrahlt plötzlich in Tausenden und Millionen von Lichtern, die nach wenigen Augenblicken wieder erlöschen, ein wunderbares Spiel, das sich in kleineren und größeren Zwischenräumen die ganze Nacht hindurch wiederholt.
In Australien lebt ein herrlich gefärbter kleiner Prachtfink, den der englische Ornithologe Gould seiner Frau zu Ehren Goulds Amadine (Munia gouldiae) benannte. Dieser reizende Vogel hat einen tiefschwarzen Kopf, der mit einem kobaltblauen Bande umgeben ist. Die Brust ist lilafarben, der Leib goldgelb, die ganze Oberseite grasgrün. Schnabel und Füße sind hellrosa. Die Farben des sehr glatten Gefieders gehen nicht allmählich ineinander über, sondern sind scharf abgesetzt, so daß der Vogel wie bemaltes Porzellan aussieht. Neben den schwarzköpfigen Vögeln kommen auch Vögel mit scharlachrotem Gesicht vor, die noch schöner und farbenprächtiger aussehen und die man daher „Wunderschöne Amadine“ genannt hat. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß beide Formen nicht verschiedene Arten sind, sondern nur Mutationen, d. h. willkürliche Abänderungen ein und derselben Art. Die Mutationstheorie wurde zuerst von dem Botaniker de Vries im Jahre 1901 aufgestellt. Die Mutation, d. h. die plötzlich bei einer Tierart auftretende Veränderung ist eine erbliche Eigenschaft, die zu einer Umwandlung der Art führen kann. Die verschiedenen Formen werden wissenschaftlich „Mutanten“ genannt. Die schwarzköpfige und rotköpfige Form der Gouldsamadine sind also keine verschiedenen Arten, sondern Mutanten derselben Art.
Was hat nun die Gouldsamadine, die in ihrer Farbenpracht eine Schöpfung des Sonnenlichtes in wahrer Bedeutung ist, mit einem Leben in Nacht und Finsternis zu tun?
[S. 198]
Im Schnabelwinkel der jungen Nestvögel befinden sich eigentümliche, etwa hirsekorngroße halbkuglige Gebilde, über deren Bedeutung man sich lange Zeit im unklaren war, bis der Leipziger Zoologe Chun entdeckte, daß diese Gebilde Leuchtorgane sind. Die Leuchtkraft beruht aber nicht auf eigner Lichtproduktion, sondern sie wird durch auffallende Lichtstrahlen, die zurückgeworfen werden, erzeugt. Die Leuchtkörperchen wirken also als Reflektor. Der Vorgang ist derselbe wie bei den Augen der Katze, die keine eigene Lichtquelle haben, sondern im Halbdunkel durch Lichtreflex glühen. Die Leuchtorgane der Gouldsamadine bestehen aus verdicktem Bindegewebe von bläulichem Seidenglanz mit einer dahinterliegenden dunkeln Pigmentschicht. Eine Drüsenbildung, welche nach Art der Tiefseefische ein leuchtendes Sekret absondert, ist nicht vorhanden, woraus mit Sicherheit hervorgeht, daß das Leuchten kein chemischer Prozeß sein kann.
Die Gouldsamadinen bauen ein überwölbtes Nest. Die Jungen wachsen also im Halbdunkel heran. Ihre Leuchtorgane dienen daher den Vogeleltern bei der Atzung als Wegweiser, wohin sie das Futter zu richten haben. Auch andere junge Prachtfinken besitzen diese Laternen im Rachen.
Die Prachtfinken gehören zu den Sperlingsvögeln, d. h. zu den Vögeln, deren Junge bei der Atzung „sperren“. Sie recken, um das Futter von den Eltern zu empfangen, Hals und Kopf in die Höhe und sperren den Schnabel weit auf: Schnabel und Rachen bilden einen weiten Trichter, in den die alten Vögel die Atzung hineinstecken. Der Schnabelwinkel dieser „sperrenden“ Jungvögel ist mit einer weichen, dicken Haut überzogen, die eine leuchtend gelbe oder rötliche Färbung hat. Häufig ist auch der Rachen gelb oder rot gefärbt, und auf der gelben oder roten Zunge befinden sich bisweilen noch lackschwarze Punkte. Diese[S. 199] auffallende Schnabel- und Rachenfärbung hat offenbar auch den Zweck, den Vogeleltern die Fütterung zu erleichtern, denn die halbkugligen, oben offenen Vogelnester stehen meist im dichten Gebüsch, in Hecken oder im schützenden Blätterdach, also im Schatten. Wenn der alte Vogel zur Fütterung seiner Kinder auf den Nestrand fliegt, dann leuchten ihm die buntgefärbten Rachen der hungrigen Jungen entgegen, auf denen gewissermaßen geschrieben steht: „Hierher das Futter.“
Außer den eigentlichen Sperlingsvögeln, die ihren Namen nach dem „Sperren“ der Jungen tragen, haben noch einige andere Formen in der Jugend hellgefärbte Wülste am Schnabelrande, wie z. B. der Wiedehopf und der Kuckuck, die sich ebenfalls mit weit aufgesperrtem Schnabel atzen lassen. Andere Jungvögel nehmen das Futter den Alten ab, was z. B. bei allen Raubvögeln der Fall ist, oder sie stecken ihren Schnabel in den Rachen des alten Vogels, um sich dessen Kropf- oder Mageninhalt einwürgen zu lassen, wie es bei den Tauben und Pelikanen Sitte ist. Solche Jungvögel besitzen keine buntfarbigen Schnabelwinkel. —
Viele Tiere verbringen einen großen Teil ihres Daseins in einem totenähnlichen Schlaf in dunkeln Verstecken, um dem verderblichen Einfluß des Winters zu entgehen. Hierzu gehört der allbekannte Winterschlaf der Amphibien und Reptilien.
Die Frösche graben sich mit Eintritt der kalten Jahreszeit in den Schlamm der Teiche ein, um die Wintermonate in einem erstarrten, bewußtlosen Zustande zu verbringen, bis sie das milde Frühjahrswetter aus ihrem Totenschlafe zu einem neuen Leben erweckt. Wie mit einem Schlage erscheinen dann plötzlich die Frösche in großer Menge, woraus die alte Volkssage vom „Froschregen“ entstand. Die Kröten überwintern im Gegensatz[S. 200] zu den meisten anderen Froschlurchen nicht in der Nähe des Wassers, sondern an trockenen Orten. Sie verkriechen sich in Erdhöhlen oder Felsspalten, deren Öffnung sie mit einem Erdwall verschließen. Häufig beziehen viele Tiere denselben Schlupfwinkel zum Überwintern.
Die größte Massenvereinigung während des Winterschlafes bildet der so schön gelb und schwarz gefleckte Feuersalamander (Salamandra maculosa), der nach dem Regen die Wälder des Harzes und Thüringens so anmutig belebt. Zu Hunderten suchen die Tiere ein trockenes, frostfreies, unterirdisches Versteck in moosigen Felswänden oder in Bergwänden auf und verschlafen hier eng verschlungen die kalte Jahreszeit.
Auch die Reptilien verbringen den Winterschlaf meist gesellig in Erdhöhlen. Bei der Kreuzotter vereinigen sich häufig 10 bis 20 Tiere.
Ebenso wie Lurche und Kriechtiere im kalten Klima einen Winterschlaf halten, verbringen sie in der heißen Zone die Trockenheit in einem Sommerschlaf in unterirdischen Verstecken. Die Frösche graben sich in den Schlamm der Gewässer, solange er noch weich und feucht ist, und warten hier die Zeit der Dürre ab. Echsen und Schlangen verkriechen sich in die Erde oder in Felshöhlen.
In den Tropenwaldungen, wo die Feuchtigkeit der Luft das ganze Jahr hindurch gleichmäßig bleibt und keine Trockenperiode eintritt, halten Lurche und Kriechtiere keinen Sommer- und Winterschlaf, sondern bleiben ohne Unterbrechung rege.
Während des Winter- und Trockenschlafes wird die Lebenstätigkeit wesentlich eingeschränkt, aber nicht völlig unterbrochen, wie der Laie vielfach glaubt. Herzschlag und Blutzirkulation werden bedeutend langsamer, die Atmung hört fast ganz auf, ein Stoffwechsel findet nicht statt. Die Ernährung des Körpers wird[S. 201] durch das vor dem Schlaf reichlich angesetzte Fett besorgt. Während des Schlafes verliert der Körper erheblich an Gewicht.
Auffallend ist, daß die Tiere nach dem Erwachen nicht etwa schwach und matt sind, sondern gleich sehr regsam und frisch. Sie nehmen sofort Nahrung zu sich und bewegen sich in gewohnter Weise. Die Landschildkröten, welche sich ziemlich tief in die Erde eingraben, haben sogar eine nicht unerhebliche Kraftprobe zu leisten, um sich aus der Erde wieder zur Oberfläche emporzuarbeiten.
Die Dauer des Winterschlafes ist je nach dem Klima verschieden. In nördlichen Gegenden, wo der Winter sehr streng ist und lange anhält, währt auch der Winterschlaf sehr lange und dehnt sich unter Umständen über ein halbes Jahr hinaus aus. Nach Simroth verbringt die lebendiggebärende Bergeidechse (Lacerta vivipara), deren Verbreitungsgebiet sich in Europa und Asien bis zum 70. Grad nördl. Br. erstreckt, in der nördlichen Zone ihrer Heimat 9 Monate im Winterschlaf zu. Sie befindet sich also während des größten Teils ihres Lebens in einem erstarrten Zustande der Lethargie.
Ein Winter- bzw. Sommerschlaf kommt auch bei den Fischen vor, was im allgemeinen weniger bekannt ist. Wir lernten die Tiefseefische als stenotherm kennen, d. h. sie sind einer bestimmten Temperatur angepaßt, da die Temperatur der Tiefsee konstant ist. Stenotherm sind ferner die Fische der Polarmeere und der Tropengewässer, in denen ebenfalls keine großen Temperaturunterschiede sich geltend machen. Die anderen Fische sind eurytherm, d. h. sie können bis zu einem gewissen Grade erhebliche Wärmeschwankungen vertragen.
Für jede Fischart gibt es eine bestimmte Normaltemperatur, unter der ihr Körper die größte Leistungsfähigkeit bekundet, was sich in gesteigerter Freßlust und im Laichgeschäft zeigt. Die Normaltemperatur[S. 202] der einzelnen Fischarten ist sehr verschieden. Die Temperaturzone wird nach oben durch eine Maximaltemperatur, nach unten durch eine Minimaltemperatur begrenzt. Innerhalb dieser Grenzen bleibt die Lebenstätigkeit ungestört. Werden die Grenzen überschritten, so erleiden Körper und Organe eine Einbuße an Aktivität, und bei weiterer Steigerung wird der Tod herbeigeführt.
Ein Sinken der Wassertemperatur unter die niedrigste Grenze der Temperaturzone ruft bei den Fischen einen Zustand hervor, der sich mit dem Winterschlaf der Amphibien und Reptilien vergleichen läßt. Die Fische vergraben sich dann im Grunde, nehmen keine Nahrung mehr zu sich, und die Lebenstätigkeit wird eingeschränkt. Sie verfallen in einen erstarrten Zustand, in dem die Herztätigkeit von 20–30 Schlägen in der Minute auf 1–2 Schläge zurückgeht. Ebenso wie bei den Reptilien erfolgt der Bedarf des Stoffwechsels aus dem aufgespeicherten Fett. Die im Frühjahr steigende Wassertemperatur ruft die schlafenden Fische zu neuem Leben wach. Sehr niedrige Kältegrade vertragen die wenigsten Fische. Eine Ausnahme macht der Karpfen, der sich nicht in den Schlamm eingräbt, sondern im Eis einfrieren läßt und Kälte bis zu 20 °C erträgt. Eingefrorene Fische bleiben jedoch nur so lange lebensfähig, als das Blut in den Adern flüssig bleibt und nicht gefriert. Ebenso muß das Auftauen sehr allmählich vor sich gehen. Andernfalls bildet der schmelzende Zellsaft destilliertes Wasser, das den Organismus vergiftet.
In der heißen Zone halten die Fische einen Sommerschlaf, wenn in der Zeit der Dürre das Wasser austrocknet. Sie vergraben sich vorher in den Schlamm und verfallen, sobald sich eine harte Kruste darüber gebildet hat, in Erstarrung, welche die Atmung völlig unterbricht.
[S. 203]
Die in den Gewässern des tropischen Afrikas lebenden Molchfische hüllen sich im Sommerschlaf in eine Kapsel aus Schlamm ein, von der eine röhrenförmige Öffnung nach der Oberfläche führt. Das untere Ende dieses Luftschachtes mündet vor dem Maul des Fisches, dem hierdurch dauernd Luft von außen zugeführt wird. Eine Sauerstoffzufuhr durch die Luft kann nur einem Lungenatmer dienlich sein, aber nicht einem Fisch, der durch Kiemen im Wasser atmet, und da sehen wir nun bei den Molchfischen die eigenartige Erscheinung, daß seine Kiemen sehr zurückgebildet sind und die Schwimmblase zur Lunge geworden ist. Sie sind also befähigt, auch in der Luft zu atmen, und erinnern daher an die Molche, die trotz ihres Lebens im Wasser Lungenatmer sind. Bei den Molchfischen wird also während des Sommerschlafes die Atmung nicht eingestellt, sondern sie erfolgt durch die als Lunge funktionierende Schwimmblase. Auch im Wasser kommen die Molchfische öfters an die Oberfläche, um Luft zu schöpfen, da die unvollkommene Kiemenatmung ihnen nicht genügt. Eine nah verwandte Art des afrikanischen Molchfisches ist der Schuppenmolch, der den Amazonenstrom bewohnt und dieselbe Lebensweise führt.
Auch andere Fische besitzen die Fähigkeit, den zum Leben notwendigen Sauerstoff nicht allein aus dem Wasser, sondern auch aus der atmosphärischen Luft zu schöpfen. Hierzu gehören die Labyrinthfische der tropischen Gewässer Afrikas und Asiens. Die Labyrinthfische besitzen außer den Kiemen noch ein besonderes Organ, das Labyrinth, welches zur Luftatmung dient. Das Labyrinth ist ein sackartiges Gebilde im Kopf, das mit den Kiemen und der Rachenhöhle in Verbindung steht und von einer blutgefäßreichen Haut umgeben ist. Der Fisch füllt das Labyrinth durch Schnappen mit dem Maul mit Luft. Es findet ein lebhafter Gaswechsel zwischen dem Blut und der Luft statt. Das Labyrinth erfüllt[S. 204] also die Tätigkeit einer Lunge. Die Luftatmung durch das Labyrinth ist für die Labyrinthfische nicht nur ein zeitweiser Ersatz für die Kiemenatmung, sondern geradezu eine Notwendigkeit. Sie sterben in kurzer Frist, wenn man sie gewaltsam verhindert, an die Oberfläche zu kommen und Luft zu holen. Ihre Fähigkeit, Luft zu atmen, nutzen die Labyrinthfische im weitgehendsten Maße aus. Der indische Schlangenkopf (Ophiocephalus striatus) unternimmt weite Wanderungen auf dem Lande, wobei er sich schlängelnd fortbewegt und sich mit Hilfe der Brustflossen und Schwanzflosse vorschiebt.
Der ebenfalls in Indien heimische Kletterfisch (Anabas scandens) geht nicht nur zeitweise ans Ufer, sondern steigt sogar auf schräg aus dem Wasser herausragende Baumstämme.
Zu den Labyrinthfischen gehören ferner die Guramis, Kampffische und Makropoden, welche in der Aquarienliebhaberei heute eine große Rolle spielen und auch teilweise in Gefangenschaft zur Fortpflanzung schreiten.
Die Labyrinthfische halten in der Trockenzeit einen Sommerschlaf im Schlamm, wobei ihnen die Labyrinthatmung zugute kommt.
Auch unter unseren einheimischen Fischen gibt es einige Arten, die einen Sommerschlaf halten. Schleie und Schmerlen verfallen bei allzu großer Wasserwärme in einen lethargischen Zustand, den man „Wärmestarre“ nennt. Die Schmerlen vergraben sich hierbei in den Schlamm, die Schleie legen sich auf dem Grund auf die Seite. —
Ein Winterschlaf, in dem der Körper erstarrt und die Lebenstätigkeit vermindert wird, kommt nicht nur bei den kaltblütigen Tieren vor, die eine sehr zähe und widerstandsfähige Natur haben, sondern sogar bei den Warmblütern.
[S. 205]
Die kleine Haselmaus baut sich im Moos und Laub auf der Erde aus Gräsern und feinen Reisern, die mit Speichel fest ineinander verkittet werden, ein kugelrundes Nest, in dem sie sich zusammenrollt und die kalten Wintermonate verschläft. Die Haselmaus ist ein ausgesprochenes Baumtier, lebt von Nüssen, Eicheln und anderen harten Früchten, sowie von Beeren und Blattknospen und klettert außerordentlich gewandt in den Zweigen umher. Der nah verwandte Gartenschläfer und ebenso der Siebenschläfer halten in einem aus Moos und Laub errichteten Nest in einer Baumhöhle, Felsspalte oder in altem Gemäuer einen tiefen und langen Winterschlaf. Das Alpenmurmeltier überwintert familienweise in einem etwa 1–1½ m unter der Erde liegenden, selbstgegrabenen und mit Heu ausgepolsterten Kessel. Die Heuernte des Murmeltiers beginnt bereits im August. Die Tiere beißen dann das Gras ab, lassen es trocknen und tragen es in die für den Winterschlaf angelegte Behausung.
Die Fledermäuse überwintern in Kellern, Dachgiebeln, Höhlen und hohlen Bäumen. Sie hängen sich zu ihrem langen Schlaf an den Hinterfüßen auf und wickeln sich ganz in die Flughäute ein. Sie hängen entweder frei an der Decke oder krallen sich an den Wänden an. Viele Arten vereinigen sich zum Winterschlaf in großen Gesellschaften, häufig zu vielen Hunderten und hängen dann in Klumpen dicht neben- und übereinander. Eigentümlich ist die verschiedene Haltung der Ohren während des Schlafes. Manche Fledermäuse strecken die Ohren weit heraus, andere rollen sie zusammen oder verbergen sie mit dem Kopf ganz unter der Flughaut.
Die meisten winterschlafenden Säugetiere, wie Haselmaus, Hamster, Siebenschläfer, Gartenschläfer und Ziesel, füllen ihre Schlafkammern mit Futtervorräten an, von denen sie besonders[S. 206] in der ersten Zeit, wenn sie ihr zurückgezogenes Dasein beginnen, leben, und die ihnen nach ihrem Erwachen die erste Nahrung spenden.
Der Schlaf dieser Tiere ist nicht anhaltend wie bei den Reptilien und Amphibien, sondern er wird hin und wieder unterbrochen.
Genaue Untersuchungen sind in neuerer Zeit über den Verlauf des Winterschlafes beim Murmeltier angestellt worden. Sobald das Murmeltier sich in seine winterliche Behausung zurückgezogen hat, fällt es nicht sogleich in festen Schlaf, sondern es schläft nur zeitweise. Die Dauer des Schlafes wird allmählich länger, die Zeit des Wachseins kürzer, bis nach etwa 2 Wochen der eigentliche, tiefe Winterschlaf beginnt, der jedoch alle 3–4 Wochen von einem kurzen, etwa zwölfstündigen Erwachen unterbrochen wird. Am Schluß der Überwinterung, die etwa 5–6 Monate dauert, folgt wieder eine zweiwöchentliche Periode des Halbschlafs, in der die Pausen zwischen Schlafen und Wachen immer kürzer werden und die Schlafdauer abnimmt, bis schließlich das Tier sein Winterlager verläßt. Auch Haselmaus, Siebenschläfer, Hamster und Ziesel unterbrechen zeitweise ihren Schlaf. Hamster und Ziesel verlassen sogar an milden Wintertagen auf kurze Zeit ihren Bau, um ihn freilich sehr bald wieder aufzusuchen und den Schlaf von neuem zu beginnen.
Bei den Fledermäusen, die keine Vorräte eintragen, scheint der Schlaf schneller einzusetzen und auch fester und anhaltender zu sein. Freilich erwachen auch sie hin und wieder und fliegen dann in dem Keller oder Gewölbe, in dem sie Unterschlupf suchten, umher, scheinen aber auch häufig die ganze Zeit des Winterschlafes in Erstarrung zu verbringen.
Ebenso wie bei den Kaltblütern wird auch bei den Säugetieren im Winterschlaf die Lebenstätigkeit herabgesetzt. Die Atmung[S. 207] wird auf ein Minimum beschränkt, die Bluttemperatur nimmt erheblich ab, der Stoffwechsel wird bedeutend verringert, ohne jedoch völlig aufzuhören. Schlafende Murmeltiere atmen nur zwei- bis sechsmal in der Minute, im wachenden Zustande aber fünfzig- bis sechzigmal. Beim Ziesel folgen die Atemzüge im Winterschlaf in Abständen von 50–56 Sekunden, während im Wachen die Atmung 25mal so schnell vonstatten geht. Noch viel langsamer ist die Atmung der erstarrten Fledermäuse, die nur alle Viertelstunde einen Atemzug tun. Die verlangsamte Atmung bedingt einen geringen Stoffwechsel und eine Abnahme der Bluttemperatur. Beim Murmeltier beträgt der Sauerstoffverbrauch während des tiefsten Schlafes nur ¹⁄₄₀–¹⁄₃₀ des Normalverbrauchs im wachen Zustande. Das Blut wird konzentrierter und reicher an Kohlensäure. Ferner nimmt das Azeton im Blute des schlafenden Tieres zu, wodurch nach Dubois die Wirkung eines Schlafmittels erzeugt wird. Dubois betrachtet daher den Winterschlaf als eine Autonarkose durch Kohlensäure und Azeton.
Der Körper der schlafenden Tiere ist kalt und starr. Die Temperatur sinkt beim tief schlafenden Ziesel bis auf 2 °C herab. Sie beträgt bei Fledermäusen etwa 7 °C, bei Haselmäusen 9–14° gegen 35° bei wachenden Tieren. Beim Erwachen tritt eine auffallend schnelle Steigerung der Temperatur ein. Nach den von Pembrey ausgeführten Messungen steigt die Temperatur bei der Haselmaus innerhalb einer Minute von 13,5° auf 35,75 °C, bei der Fledermaus in 14 Sekunden um 22,25° und beim Murmeltier um 12°. Der Vorderkörper erwärmt sich schneller als der Leibesteil. Eine so schnelle Erwärmung bedingt einen starken Verbrennungsprozeß organischer Substanz, der sich in einer ungeheuer großen Kohlensäureproduktion auswirkt. Die Kohlensäureausscheidung[S. 208] beträgt pro Stunde und Kilogramm 2200 mg und ist mehr als doppelt so groß wie im Normalzustand. Ferner ist beim Erwachen die Verbrennung von Kohlehydraten sehr groß, die sich im Körper während des Schlafens in Form von Glykogen aufgespeichert haben, da in dieser Zeit nur Fette verbrannt werden.
Die Außentemperatur ist nur von geringem Einfluß auf die Temperatur des winterschlafenden Tieres. Die Verminderung der Bluttemperatur wird vielmehr durch die Veränderung des Organismus selbst erzeugt, die durch das Aufhören der Ernährung, die Unbeweglichkeit, die herabgesetzte Atmung und den Mangel an Sauerstoff hervorgerufen wird. Da die Abnahme der Temperatur die charakteristischste Eigenschaft der Winterschläfer ist, so meint man, daß diese allmählich einsetzende Körperbeschaffenheit den Zustand des starren Schlafes erzeugt, den andere Forscher, wie oben gesagt wurde, für eine Autonarkose durch Kohlensäure und Azeton halten. Soviel scheint jedenfalls festzustehen, daß der Schlaf der Säugetiere ebenso wie der Schlaf der Kaltblüter nicht allein durch äußere Temperatureinflüsse hervorgerufen wird, sondern seine Ursache auch im Innern des Organismus hat. Hierfür spricht ferner die Erfahrung, daß Haselmäuse und Fledermäuse auch im warmen Zimmer in Schlaf fallen, der freilich nicht so tief und anhaltend ist wie im Freien. Andererseits leiden die Tiere sehr darunter oder sterben, wenn sie künstlich wachgehalten werden. Der Winterschlaf ist also ein notwendiges Lebensbedürfnis.


Daß Kälte allein nicht den Schlaf hervorruft, geht ferner daraus hervor, daß mitunter auch ein Sommerschlaf stattfinden kann. Bei Forel schlief ein Siebenschläfer im Sommer vom Mai bis zum August, und umgekehrt ließen sich Ziesel im Sommer durch[S. 209] künstlich erzeugte hohe Kälte nicht zum Schlafen bringen. Eine Vorbedingung zum Schlaf scheint eine starke Anhäufung von Fett zu sein. Alle Säugetiere setzen vor dem Winterschlaf ein Fettpolster an, das häufig umfangreicher ist als die Muskulatur, und von dem sie in dem Zustande der Lethargie zehren. Allzu reichliche Fettbildung scheint daher den abnormen Sommerschlaf hervorzurufen, da solche Tiere stets einen ungewöhnlichen Fettansatz besaßen. Andererseits fielen magere Tiere in Gefangenschaft im Winter nicht in Schlaf, sondern blieben trotz niedriger Außentemperatur wach und rege.
Wenn auch die Erzeugung des Schlafes von der Außentemperatur wenig abhängig ist, so läßt sich doch eine gewisse Grenze erkennen, die nicht überschritten werden darf, um den Schlaf zu erhalten. So stellte Pflüger durch Versuche fest, daß Murmeltiere bei einem Sinken der Außentemperatur unter 4° erwachten.
Eine eigentümliche Erscheinung ist das periodisch sich einstellende Erwachen während des tiefen Schlafes. Es dient hauptsächlich der Harn- und Kotentleerung, die im Winterschlaf nicht unterbrochen werden, wenigstens nicht bei allen Tieren. Man hat diesen Vorgang beim Murmeltier näher beobachtet und dabei festgestellt, daß der Druck der angefüllten Blase Zuckungen hervorruft, welche die Atmungsbewegungen reflektorisch beschleunigen und hierdurch das Erwachen des Tieres veranlassen. Werden diese Zuckungen der Blase pathologisch unterbrochen, so schläft das Tier weiter, bis es stirbt.
Während des schlafenden Zustandes sammelt sich das Blut im Herzen und in den großen Gefäßen in der Brust und im Leibe, während das Gehirn fast blutleer wird. —
Das Körpergewicht nimmt im Winterschlaf bedeutend ab. Die Tiere verlassen ziemlich abgemagert ihr Lager.
[S. 210]
Die Zeit des Winterschlafes ist verschieden und richtet sich nach der geographischen Lage der Heimat. Im hohen Norden währt der Schlaf bedeutend länger als im gemäßigten Klima. Die Schlafzeit schwankt zwischen 2 und 7 Monaten. Am längsten dauert sie bei den Fledermäusen und dem Murmeltier, die etwa ein halbes Jahr im Winterschlaf verbringen.
Die starke Abkühlung der Körpertemperatur macht die schlafenden Säugetiere den kaltblütigen Tieren ähnlich, was auch in einer großen Lebenszähigkeit hervortritt. Das herausgenommene Herz schlägt bei Aufbewahrung in kühler Temperatur noch mehrere Stunden. Schneidet man schlafenden Fledermäusen den Kopf ab, so treten noch nach einer Stunde Reflexbewegungen auf.
Weniger fest als bei den bisher genannten Tierarten ist der Winterschlaf des Dachses und des Bären. Der Dachs bezieht seinen für den Winterschlaf gut ausgepolsterten Bau mit Eintritt der kälteren Jahreszeit, lebt hier zunächst noch einige Zeit von den aufgestapelten Vorräten und rollt sich erst mit Eintritt des Frostes zum Schlaf zusammen, den er jedoch öfters unterbricht. In milden Wintern verläßt er auch zeitweise in der Nacht seinen Bau, um zu trinken und Nahrung zu sich zu nehmen. Die Ernährung erfolgt jedoch hauptsächlich durch die reiche Fettschicht, die er sich im Laufe des Sommers und Herbstes angemästet hat. Gänzlich abgemagert kommt er dann im Frühjahr zum Vorschein.
Noch weniger fest als der Dachs schläft der Bär. Erst mit Eintritt der Kälte und nach starkem Schneefall bezieht er sein Winterlager, das sich in Erdhöhlen, hohlen Bäumen, im Gestrüpp oder unter Wurzelhöhlen befindet und stets vor den rauhen Nord- und Ostwinden geschützt ist. Die Bärin bezieht im allgemeinen ihr Winterlager früher als der Bär und polstert es auch[S. 211] mit Moos und Laub aus, in dem sie während des Winterschlafes 1–3, bisweilen auch 4 Junge wirft. Während des Werfens ist die Bärin wach, schläft aber nachher wieder ein.
Der Bär legt zu seinem Winterlager häufig weite Wanderungen zurück, die sich über 200–300 km erstrecken können. Nur sehr alte Bären nehmen hiervon Abstand und schlagen sich in der Nähe ihres Aufenthaltsorts ein. Selten begibt sich der Bär auf geradem Wege zur Lagerstätte, in der Regel macht er zahlreiche Widergänge und Sprünge nach verschiedenen Richtungen, die manchmal 4–6 m weit sind, um seine Spur zu verwischen. Ja, die Vorsicht geht sogar bisweilen so weit, daß der Bär manche Strecken rückwärts schreitend zurücklegt, um seine Fährte zu verwischen und sein Winterlager zu verheimlichen.
Der Bär versinkt nicht wie andere Winterschläfer in einen völlig starren, lethargischen Zustand, sondern befindet sich nur in einem Halbschlaf, aus dem er schon durch geringe Geräusche und Störungen leicht erweckt wird. Er ist dann sofort rege und flüchtet aus dem Lager. Infolgedessen muß das Einkreisen schlafender Bären sehr vorsichtig und ruhig geschehen, damit der Bär nicht vorzeitig das Lager verläßt und den Schützen entgeht. Manche Bären verlassen auch freiwillig ihren Schlafplatz, wandern umher und beziehen ein anderes Lager.
Je feister der Bär ist, um so fester liegt er im Lager. Der Fettansatz scheint also wie bei den anderen Winterschläfern die Schlafsucht zu befördern.
Während des Winterschlafes nimmt der Bär keine Nahrung zu sich, nicht einmal die Bärin, obwohl sie ihre Jungen säugen muß. Auch scheint keine Harn- und Kotentleerung stattzufinden, denn der Bär fastet schon 2 Wochen vor dem Beziehen des Winterlagers.
[S. 212]
Beim Bären wird im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren, die im Winter schlafen, der Schlaf allein durch die Kälte veranlaßt, aber nicht durch innere physiologische Vorgänge; denn im milden, frostfreien Winter schlägt er sich überhaupt nicht ein, sondern bleibt dauernd rege. Auch gefangene Bären halten meist keinen Winterschlaf und bleiben trotzdem gesund bis ins hohe Alter. Der Winterschlaf ist also für den Bären keine Lebensnotwendigkeit.
Wenn der Bär im Frühjahr das Winterlager verläßt, dann gebraucht er zunächst eine gründliche Abführkur, um Magen und Gedärme wieder in Ordnung zu bringen. Zu diesem Zwecke verzehrt er Moos und Moosbeeren, die die Verdauung günstig beeinflussen.
Einen Winterschlaf halten nur die Landbären, aber nicht der Eisbär, obwohl er die kalte Zone bewohnt. Er fühlt sich in der Region des ewigen Eises im Sommer wie im Winter wohl.
[3] Mk bedeutet Meterkerze, d. h. die Lichtintensität in Meterentfernung von einer Normalkerze.
[S. 213]
Die Urahnen des Menschengeschlechts wohnten nach Art wilder Tiere in natürlichen Felshöhlen. Erst die fortschreitende Entwicklung des menschlichen Geistes weckte im Menschen den Gedanken, sich eigene Wohnstätten zu erbauen und sich in bestimmten Gegenden, die günstige Lebensbedingungen gewährten, anzusiedeln. So bildeten sich die ersten menschlichen Niederlassungen. Die allmählich erwachende Kultur, die eine Folge des Ackerbaues und der Ansiedlung der Menschen war, verwandelte die ersten, primitiven Laubhütten in feste Gebäude, die einen hinreichenden und dauernden Schutz gewähren sollten gegen die Unbilden der Witterung, die Gefahr durch wilde Tiere und nicht zum mindesten gegen die Angriffe, die die Menschen selbst gegeneinander führten. Es entstanden Steinbauten, massive Wohnhäuser, Burgen und Festungen.
Diese Errungenschaften der Kultur sind jedoch nicht das alleinige Vorrecht des Menschen geblieben. Wir finden sie, wenn auch nicht in gleicher Vollendung, so doch in ähnlicher Weise sogar in der Tierwelt. Obwohl Kultur, Kunst und Wissenschaft der Tierseele fremd sind, so wissen die Tiere dennoch, kunstvolle Bauten für ihre Unterkunft und ihr Heim herzustellen, deren Ausführung unsere Bewunderung erregen muß.
Ein vollendeter Baukünstler unter den Säugetieren ist der Biber. Er errichtet sich feste Burgen und baut sogar Staudämme im Wasser nach allen Regeln der Wasserbautechnik.
[S. 214]
Die Behausungen der Biber liegen teils im Wasser, teils werden sie am Ufer auf dem Lande oberirdisch oder unterirdisch angelegt. Die unterirdischen Uferbauten bestehen in einem größeren Kessel, der höher als der Wasserspiegel liegt. Von ihm führen mehrere Gänge zum Wasser, die unter dem Wasserspiegel münden, so daß der Biber seine Wohnung ungesehen, unter Wasser schwimmend, erreichen und verlassen kann. Der Wohnraum ist mit Holzspänen ausgelegt. Häufig besteht die ganze Anlage nicht aus einem, sondern aus mehreren Kesseln, die durch Röhren miteinander verbunden sind.
Steigt bei anhaltendem Regen das Wasser sehr hoch, so daß der Uferbau überschwemmt wird und die Wohnräume unter Wasser stehen, dann legen die Biber weiter entfernte Notbaue an. Sie errichten auf dem Lande Hütten aus Reisern und trockenem Laub, die sie so lange beziehen, bis der Wasserstand gefallen ist und die Uferbaue wieder bewohnbar werden. Die verlassenen Hütten liegen dann ziemlich weit vom Wasser entfernt und ihre Zugangsröhren münden auf dem Lande.
Wenn dagegen umgekehrt in trockenen Jahren der Wasserstand so weit fällt, daß die unter Wasser mündenden Zugangsröhren der Uferbauten trocken gelegt werden, dann verkleiden die Biber die Öffnungen der Röhren durch Vorbauten aus Reisig, die laubenartig zum Wasser führen, so daß sie wieder, ohne ans Land steigen zu müssen, ihre Wohnungen erreichen können.
Außer den Uferbauten und den Hütten errichten die Biber noch eine dritte Art von Bauten, die sogenannten Burgen. Sie bestehen aus Knüppeln, zernagten Baumstämmen und Ästen, die mit Erde, Schlamm, Lehm und Sand verschmiert und verkleidet werden. Die Burgen haben die Form einer Kuppel. Sie stehen entweder auf dem Lande in der Nähe des Ufers oder mitten im[S. 215] Wasser. Die Zugänge führen stets unterhalb des Wasserspiegels ins Wasser. Im Innern der Burg befindet sich ein Kessel als Wohnraum und meist noch einige Vorratskammern. Die Luftzufuhr nach dem Kessel erfolgt von oben her durch die dünne Decke. Bisweilen ist auch ein Luftschlot vorhanden. Ob dieser Luftschacht absichtlich vom Biber angelegt wird, oder ob er von selbst durch eine Senkung der dünnen Oberlage entsteht, ist noch nicht aufgeklärt. Wird die Öffnung zu groß, dann wird sie durch übergelegte Reiser verschlossen.
Die Wasserburgen sind die ursprünglichen Bauten des Bibers, die er jedoch heute nur noch dort anlegt, wo er völlig ungestört lebt, wie im Urwalde Kanadas, während die Biber an der Elbe und Mulde hauptsächlich in unterirdischen Röhrenbauen wohnen und nebenbei noch Reisighütten und Landburgen errichten. Die norwegischen Biber bauen hauptsächlich Landhütten, in denen sich auch das Fortpflanzungsgeschäft abspielt, und nur junge Tiere graben sich Erdröhren als Schlupfwinkel. In Frankreich dagegen, wo der Biber noch vereinzelt im Rhonedelta vorkommt, legt er sich meist Erdbaue im Steilufer an. Jeder Uferbau enthält zwei Räume, von denen der größere als Vorratskammer dient, der kleinere den Wohnraum und die Wochenstube bildet. Die Baue der Biber sind also je nach der Örtlichkeit verschieden.
Die merkwürdigsten Bauten des Bibers, gegen die die Burgen und Hütten ganz zurücktreten, sind die Dämme, mit denen die Tiere das Wasser anstauen, um zu verhindern, daß der Wasserstand in trockenen Zeiten zu niedrig wird und die Zugänge zu ihren Bauten freigelegt werden. Zu diesem Zweck stecken die Biber starke Ast- und Baumstücke, die etwa 1–2 m lang sind und einen Durchmesser von 10–15 cm haben, senkrecht in den Grund des Flusses. Die dicht nebeneinander stehenden Pfähle[S. 216] werden mit Reisern und Zweigen fest verbunden, und das Ganze wird mit Schilf, Schlamm, Lehm und Erde verdichtet. Die Seite des Dammes, die der Strömung entgegengerichtet ist, bildet eine senkrechte Wand, während die andere Seite eine schräge Böschung darstellt. Hierdurch leistet der Damm dem Wasserdruck den kräftigsten Widerstand. Die stärksten und größten Dämme des amerikanischen Bibers sind 150–200 m lang, 2–3 m hoch, am Grunde bis zu 6 m und oben bis zu 2 m dick. Es sind also ganz gewaltige, leistungsfähige Wasserbauten, die imstande sind, selbst reißende große Ströme in ihrem Lauf aufzuhalten und anzustauen. Die Dämme werden entweder in gerader Linie von Ufer zu Ufer durch das Wasser geführt oder auch stromaufwärts etwas gebogen. Schadhafte Stellen werden sofort sorgfältig ausgebessert. Bei Hochwasser überwachen die Biber die Dämme sehr eifrig und geben darauf acht, daß kein Durchbruch entsteht. Reißt die Flut den Damm ein, so wird der Schaden sogleich wiederhergestellt.
In der amerikanischen Wildnis, wo der Biber noch in großen Kolonien lebt, geben die Dämme der Landschaft mit der Zeit ein ganz anderes Gepräge. Durch die Anstauung des Wassers entstehen Teiche, die allmählich immer größer werden und sich über die angrenzende Landfläche ausbreiten. Mehrere Dämme einer größeren Biberkolonie in einem Flußgebiet verursachen eine Kette von Teichen, die terrassenförmig übereinanderliegen.
Werden solche Stellen später von den Bibern verlassen, so verfallen die Dämme, die Teiche trocknen aus, und es entstehen sumpfige und morastige Flächen, die mit einer üppigen Vegetation bewachsen. Einzelne Dämme in Amerika werden von den Bibern seit Jahrhunderten erhalten, wie man aus den Torfschichten, die den unteren Teil der Dämme überlagern, schließen kann.
[S. 217]
Das Material für seine Bauten holt sich der Biber aus dem Walde, wo er sich unablässig damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Das Fällen geschieht in der Weise, daß der Biber in sitzender Stellung den Stamm kranzförmig von zwei Seiten, nämlich von oben und von unten benagt. Die Schnittflächen beider Kreise laufen schräg nach dem Innern des Stammes und treffen sich hier. An dieser Stelle wird der Stamm immer dünner, bis er schließlich seinen Halt verliert und umfällt. Da der Biber meist die nach dem Wasser zugewendete Seite des Baumes stärker benagt, so fällt dieser gewöhnlich nach der Wasserseite um, was den Transport des Holzes ins Wasser erleichtert. Der gefällte Baum wird dann von den größeren Ästen befreit und ins Wasser geschleift, indem der Biber das Ende des Stammes mit den Zähnen erfaßt und so den Baum vorwärts zieht, was bei schwerer Last langsam und ruckweise mit großer Anstrengung erfolgt. Im Wasser wird dann die Rinde vom Stamm geschält und das Holz zerkleinert und gebrauchsfähig gemacht. Für die Bauten werden nur Holzstücke verwendet, die der Rinde völlig entkleidet sind. Die zerkleinerten Stämme werden als Pfähle für den Bau der Dämme und Burgen verwendet, die Zweige dagegen zur Verkleidung und Befestigung des Bauwerks. Für seine Arbeiten wählt der Biber am liebsten Weiden, sowie Pappeln, Birken und Eschen, wagt sich aber auch an Eichen und andere Bäume mit hartem Holz heran. Etwa armdicke Stämme, die er in kurzer Frist durchnagt, sind ihm besonders willkommen, er scheut aber auch nicht davor zurück, dicke Bäume von 30, ja 60 oder 70 cm Durchmesser zu fällen. Am Großkühnauer See bei Dessau haben die Biber sogar eine Silberpappel gefällt, deren Umfang fast 2 m betrug. Für diese Riesenarbeit, die öfters unterbrochen, aber immer wieder mit neuem Eifer begonnen wurde, gebrauchten die Tiere fast 3 Jahre.
[S. 218]
Da die Nahrung des Bibers in Baumrinde, Zweigen und Blättern besteht, so wird die Arbeit des Holzfällens das ganze Jahr eifrig ausgeübt. Auch wird beständig an den vorhandenen Bauten ausgebessert, und neue Bauten werden angelegt. Es fehlt also niemals an Arbeit, und diese ist auch notwendig, damit die in dauerndem Wachstum begriffenen Nagezähne sich ständig abschleifen.
Das Fällen der Bäume erfolgt nicht immer unmittelbar am Ufer, sondern auch in einiger Entfernung davon. Da die Biber für ihre Arbeiten mit Vorliebe dieselben Stellen aufsuchen, so entstehen mit der Zeit abgeholzte Blößen, die sogenannten „Biberwiesen“, die durch die stehengebliebenen Stümpfe mit den schrägen Schnittflächen sofort als Biberarbeit kenntlich sind.
Die Biber halten auf ihren Wegen zum Arbeitsplatz bestimmte Wechsel inne. Durch die Schwere ihres Körpers, der ein Gewicht bis zu 30 kg erreicht, und durch die Last der ins Wasser geschleiften Baumstämme bilden sich in dem weichen, morastigen Boden Rillen, die sich mit der Zeit immer mehr vertiefen und erweitern. Das Grundwasser sickert durch und füllt die Rillen allmählich an, so daß regelrechte Kanäle entstehen, welche zu dem Platz führen, wo das Holz gefällt wird, und ebenso auch zu den Hütten und Landburgen, wenn sie etwas weiter vom Ufer entfernt liegen. Die Biber haben hierdurch den Vorteil, anstatt des unbequemen Fußmarsches, den sie sehr ungern ausführen, ihre Wege schwimmend zurücklegen zu können. Die gefällten Baumstämme und Äste brauchen nicht mühsam zum Wasser geschleppt zu werden, sondern können auf den Kanälen geflößt werden, was die Arbeit wesentlich erleichtert. Früher glaubte man, daß die Kanäle von den Tieren absichtlich zu diesem Zwecke angelegt werden, dies ist jedoch, wie man neuerdings festgestellt hat, nicht der Fall, sondern sie entstehen auf die obenbeschriebene Art von selbst.
[S. 219]
Einen Winterschlaf hält der Biber nicht. Er verbringt aber die kälteste Jahreszeit, solange das Wasser zugefroren ist, in seiner Wasserburg oder in dem Uferbau. Mit Eintritt der Kälte schichtet er große Mengen von Holz und Ästen vor den unter Wasser liegenden Zugangsröhren auf, die ein schwimmendes Floß bilden und ihm im Winter zur Nahrung dienen. Von diesem Vorrat zieht er unter dem Eise den Bedarf an Holz in seine Behausung hinein. Solange die Eisdecke nur schwach ist, durchbricht er sie in der Nähe der Zugangsröhren seines Baues an einigen Stellen, um ins Freie gelangen zu können.
Früher war der Biber über Europa weit verbreitet. In der Mark Brandenburg kam der Biber noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. An der Havel und Nuthe hat er noch in den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gelebt. Die Kolonie Neu-Babelsberg bei Potsdam führt ihren Namen nach dem Biber, der dort häufig vorkam. Der Name Babelsberg leitet seinen Ursprung von „Biberberg“ her.
Heute lebt der Biber in Europa nur noch an der mittleren Elbe und Mulde in der Umgebung von Magdeburg und Dessau, ferner im Rhonedelta und im südlichen Norwegen. Jedoch ist er nirgends mehr häufig. Im Elbgebiet hat ihn nur der ihm zuteil gewordene gesetzliche Schutz vor dem Untergang bewahrt, und wir dürfen hoffen, daß der Biber als Naturdenkmal uns auch weiter erhalten bleibt. In Rußland und Asien, wo der Biber früher sehr häufig war, scheint er gänzlich ausgerottet zu sein. Zahlreich ist der Biber noch in den Waldungen des nördlichen Amerikas, besonders in Kanada, vertreten. Der amerikanische Biber unterscheidet sich vom europäischen durch ein dunkleres Fell und einen schmäleren Kopf mit stärker gewölbter Stirn. Er ist infolgedessen[S. 220] als besondere Art „Castor canadensis“ von dem europäischen Biber „Castor fiber“ abgetrennt worden.
Im Körperbau des Bibers fällt besonders der breite, flache, abgerundete Schwanz auf, der ein vorzügliches Steuerorgan beim Schwimmen ist und auf dem Lande beim Aufrichten des Körpers auch als Stütze benutzt wird. Die Hinterfüße sind mit Schwimmhäuten versehen, die jedoch den Vorderfüßen fehlen. Diese versteht der Biber sehr geschickt als Hände zu gebrauchen, und sie leisten ihm daher bei seinen Baukünsten vortreffliche Dienste. Die frühere Auffassung, daß der Biber seinen breiten Schwanz als Kelle gebraucht, wenn er die Dämme und Burgen mit Schlamm und Lehm verkittet, ist irrig. Er verrichtet diese Arbeit ausschließlich mit den Vorderfüßen.
In der Bauchhöhle des Bibers liegen zwei eigenartige Drüsen, die in der Öffnung der Geschlechtsteile münden und eine braune, stark riechende Salbe absondern. Diese Drüsen, Geilsäcke genannt, dienen offenbar zur Anlockung der Geschlechter und wohl auch zur gegenseitigen Verständigung. Der Biber entleert den Inhalt der Drüsen mit Vorliebe an seinen Ausstiegen, also an den Stellen, wo er aus dem Wasser ans Land steigt, um hierdurch andere Biber anzulocken, da er als geselliges Tier die Gesellschaft seinesgleichen liebt.
Ebenso wie der Biber gräbt sich auch der Fischotter unterirdische Wohnungen ins Ufer. Die Zugangsröhren münden wie bei den Biberbauten unter dem Wasserspiegel.
Geräumige Erdwohnungen errichten sich ferner Fuchs und Dachs. Zu dem Kessel, der das Lager bildet, führen stets mehrere Röhren, so daß der Fuchs oder Dachs, wenn er von einer Seite bedrängt wird, nach anderen Seiten ungehindert entweichen kann. In ähnlicher Weise sind auch die Erdbaue des Murmeltieres, Hamsters, Ziesels, der Ratten und Mäuse angelegt.
[S. 221]
Auch der Maulwurf baut sich in der Erde regelrechte Burgen, die ihm als Wohnung dienen. Da die Geschlechter für gewöhnlich getrennt leben, so besitzt jeder Maulwurf seine eigene Wohnstätte, in deren Umgebung sein Jagdgebiet liegt, das er täglich mehrmals durchstreift. Die Anlage der Wohnungen ist recht verschieden. Sie liegen meist 30–60 cm unter der Erdoberfläche. Von der eigentlichen Behausung, dem mit Gras und Blättern ausgepolsterten Kessel, führen mehrere horizontale Laufgänge nach verschiedenen Richtungen in das Jagdrevier, sowie Röhren nach oben zur Verbindung mit der Außenwelt. Besondere Luftschachte enthält der Bau nicht, sondern die durch die Ritzen der aufgeworfenen Erdschollen spärlich eindringende Luft gibt dem Maulwurf die notwendige Sauerstoffversorgung. Die Baue der Weibchen sind einfacher und haben weniger Röhren. Überhaupt machen sich in der Anlage der Baue große Verschiedenheiten bemerkbar. Bisweilen liegen die Laufröhren in 2 Stockwerken übereinander.
Der Maulwurf trinkt gern und viel und ist daher sehr darauf bedacht, daß er immer Wasser zur Verfügung hat. Befinden sich Wassertümpel oder Teiche in der Nähe seines Reviers, so verbindet er diese durch unterirdische Laufgänge mit seiner Wohnung, damit er stets schnell seinen Durst löschen kann. Ist dies nicht möglich, dann baut er sich regelrechte Brunnen. Er gräbt Schächte unter der Erde, in denen sich das in die Erde dringende Regenwasser ansammelt. Falls die Trockenheit nicht zu lange anhält, so bleiben die Brunnen stets mit Wasser gefüllt. —
Andere Säugetiere errichten sich Wohnungen über der Erde, die zum Teil an Vogelnester erinnern. Ein ganz reizendes Nest baut die zierliche Zwergmaus, das sie aus zerschlissenen Rohrhalmen und Riedgras herstellt. Das runde Nest ist oben überwölbt und hat einen seitlichen Eingang.
[S. 222]
Das Nest hängt entweder nach Art der Webervögelnester frei an einem Zweig oder Halm, so daß es in der Luft hin und her schaukelt, oder es wird in eine von den Mäusen sehr kunstvoll aus Riedgrasblättern hergerichtete Tüte gestellt, welche durch Zusammenflechten einer großen Anzahl von Gräsern angefertigt wird. Das Innere des Nestes, das lediglich als Wochenstube dient, wird mit Pflanzenwolle ausgepolstert (Abbildung 17).
Die Zwergmaus ist, wie ihr Name sagt, die kleinste aller Mäusearten und erreicht nur eine Körperlänge von kaum 6 cm. Sie lebt in Europa von den Mittelmeerländern bis zum hohen Norden und in Sibirien, soweit der Ackerbau reicht, denn Getreide bildet ihre Hauptnahrung. Sie ist oben hellbraunrot und unten weiß gefärbt, klettert sehr gewandt in Halmen und Zweigen umher und schwimmt auch vorzüglich. Ihr Aufenthalt sind die Felder sowie das Röhricht in Brüchen und Sümpfen. Obwohl sie durchaus nicht selten ist, wird sie doch wegen ihrer Kleinheit und ihrer versteckten Lebensweise leicht übersehen.
Von allen Nagetieren ist die Zwergmaus für die Gefangenschaft besonders geeignet. Sie ist sehr sauber, verbreitet nicht den unangenehmen Geruch, der anderen Mäusen anhaftet, und ist sehr lebhaft. Wenn man ihren Käfig mit Halmen und Zweigen ausstattet, so richtet sie sich bald häuslich ein und erfreut ihren Pfleger durch den fleißigen Bau der reizenden Nester. Sie ist ein außerordentlich interessantes Tier, dessen Beobachtung ebenso lehrreich wie anmutig ist. —
Ein sehr hübsches, rundliches, überdachtes Nest, mit seitlichem Eingangsloch, das dem Nest des Zaunkönigs ähnlich ist, baut der zu den Beuteltieren gehörende Ringelschwanz-Phalanger (Pseudochirus peregrinus) aus Australien.
Freistehende Nester baut auch das allbekannte Eichhörnchen.[S. 223] Das Nest, in dem das Eichhorn seine Jungen großzieht, wird aus Ästen und Laub hergestellt. Es ist sehr dicht und fest, oben überdacht und besitzt ein halbmondförmiges Schlupfloch. Das Nest steht entweder in einer starken Astgabel, angelehnt an den Hauptstamm des Baumes, oder auch in einer Baumhöhlung. Sehr gern benutzen die Eichhörnchen auch alte Raubvogel- oder Krähenhorste als Unterlage für ihren Nestbau. Außer diesen „Hauptnestern“ baut das Eichhörnchen noch „Notnester“ aus Laub in den Baumkronen, in die es seine Jungen trägt, wenn das Hauptnest gefährdet ist. Außerdem errichtet das Eichhorn in den äußersten Zweigen der Bäume sogenannte „Lustnester“, die weniger fest und liederlicher gebaut sind und anscheinend nur aus Spielerei und zur Befriedigung der Baulust hergestellt werden. Eine vierte Art von Nestern sind die „Fangnester“. Sie haben ein sehr großes Eingangsloch und bestehen im Innern aus zwei durch eine Scheidewand getrennte Räume. In der Scheidewand befindet sich ein Durchschlupf, der durch eine bewegliche Klappe verschlossen ist. Diese Fangnester stellen eine regelrechte Vogelfalle dar. Meisen, Zaunkönige und andere Kleinvögel, die gern Schlupfwinkel aufsuchen, kriechen hinein und werden dann von dem außen auf einem Ast auf der Lauer liegenden Eichhörnchen in dieser Falle gefangen.
Die Kunst des Fallenstellens wird auch von anderen Tieren geübt. Die Spinnen weben Netze, in denen sie Fliegen und Mücken, die ihre Nahrung bilden, fangen. Die Form dieser Fangnetze ist je nach der Art der Spinne verschieden. Die Kreuzspinne webt ein radförmiges, vertikal stehendes Netz, indem sie zuerst den äußeren Rahmen herstellt, der zwischen zwei übereinander befindlichen Zweigen oder im Winkel eines Gebäudes befestigt wird. Dann zieht sie im Durchmesser des Kreises einen Faden, begibt sich in den Mittelpunkt und zieht von hier aus zahlreiche Strahlen nach[S. 224] der Peripherie, wobei sie stets den zuletzt gesponnenen Faden zur Rückkehr nach dem Zentrum benutzt. Zum Schluß werden die Strahlen durch eine Anzahl parallel laufender Kreise verbunden (Abbildung 18). Der mittlere Raum des Netzes bildet später den Aufenthaltsort der Spinne, wo sie beim Insektenfang auf der Lauer liegt. Er besteht aus trockenen Fäden, während die übrigen Fäden des Netzes zahllose, kleine Knoten enthalten, die einen klebrigen Stoff absondern, der dazu dient, die sich fangenden Insekten festzuleimen und zu verhindern, daß sie sich aus dem Netz befreien. Sobald sich eine Fliege gefangen hat, stürzt sich die Spinne auf ihr Opfer, beißt es tot und verzehrt es, oder spinnt um die Fliege eine feine Hülle von Fäden, um sie als Mundvorrat für spätere Zeit aufzubewahren. Fängt sich eine Wespe oder ein anderes der Spinne nicht zusagendes Insekt, so befreit sie das Tier, indem sie das Spinngewebe in dessen Umgebung zerbeißt. Nicht immer sitzt die Spinne in der Mitte des Netzes, sondern bisweilen, besonders bei ungünstiger Witterung, verkriecht sie sich in einem Schlupfwinkel in der Nähe des Fangnetzes, mit dem sie aber durch den Spinnfaden ihres Leibes verbunden bleibt. Die Erschütterung des Netzes beim Fang einer Beute wird der Spinne durch den Faden fühlbar gemacht, der gewissermaßen als Telegraph wirkt. Die Spinne begibt sich dann zunächst in den Mittelpunkt des Netzes, um von hier aus die Beute zu ergreifen.
Die Baldachinspinne spinnt als Fangnetz eine wagerechte Decke und zieht darüber schräge Fäden nach allen Richtungen. Die Beute fängt sich zunächst in diesen Fäden, gerät dann auf die darunter befindliche Decke, in deren Mitte die Spinne, mit dem Rücken nach unten hängend, lauert.
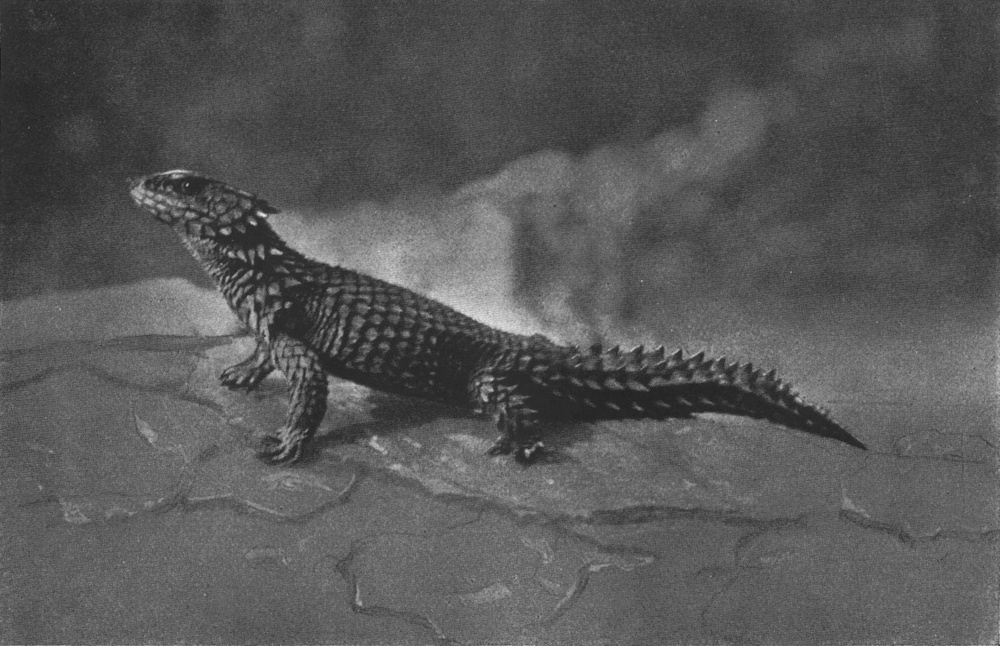
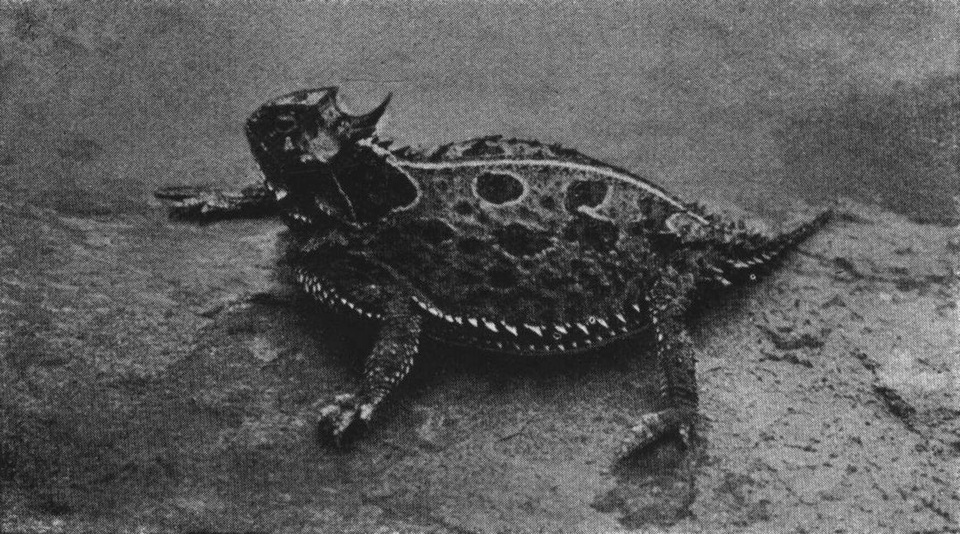
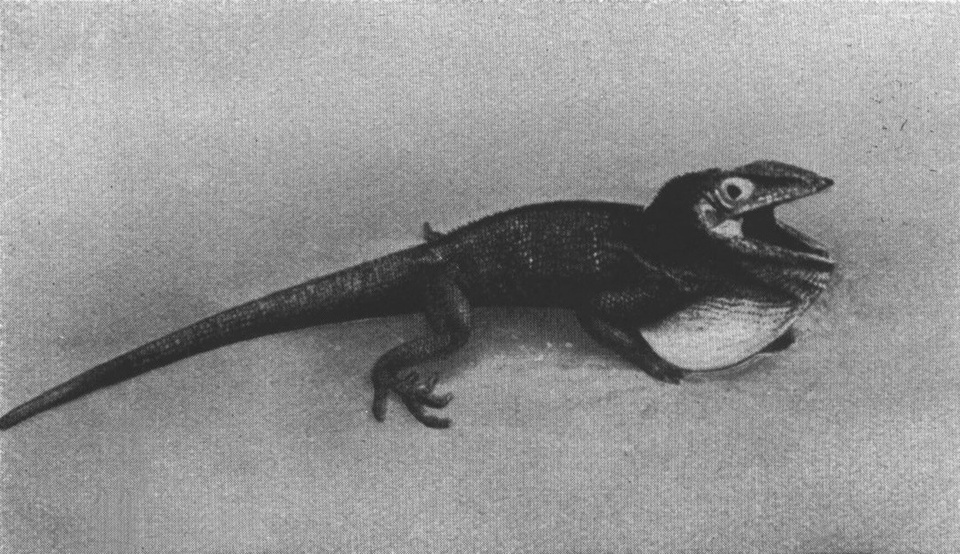
Die Labyrinthspinne stellt ein wagerechtes Fangnetz her, das wie eine Hängematte in niedrigem Buschwerk oder zwischen Kräutern[S. 225] ausgespannt ist. Die eine Seite des Netzes endigt in einer mehrfach gewundenen Röhre, in die oben, zum Schutz gegen Regen und Sonnenstrahlen, ein Blätterdach hineingewebt ist. Diese Röhre bildet die Warte der Spinne, in der sie auf Raub lauert.
Die in den Mittelmeerländern beheimatete Minierspinne gräbt in die Erde einen etwa ½ m langen Gang und tapeziert dessen Wandung mit Spinngewebe aus, um ihm Halt und Festigkeit zu geben. Die Öffnung der Röhre wird durch eine ebenfalls aus Gewebe hergestellte bewegliche Klappe, die oben in einem Scharnier hängt, verschlossen. Diese Tür fällt durch ihre Schwere von selbst zu, wenn sie geöffnet worden ist. Dies Verließ mit der selbsttätigen Tür dient der Spinne nicht als Fangvorrichtung, sondern lediglich als Schlupfwinkel am Tage, den sie nur in der Nacht verläßt, wenn sie auf Raub ausgeht. Jedem Versuch, die Tür von außen zu öffnen, leistet die Minierspinne nach Kräften Widerstand, indem sie die Klappe von innen mit den Füßen festhält und sich dabei gegen die Wand ihrer Behausung stemmt.
Die Wasserspinne errichtet an Wasserpflanzen eine Fangglocke aus Luftblasen, die vermittels eines klebrigen Sekretes ihrer Spinndrüsen aneinander geheftet werden. Der etwa walnußgroße Bau, der mit seinem unten liegenden Eingange einer umgestülpten Glocke ähnlich ist, wird noch durch Spinnfäden verstärkt und gefestigt. Von der Öffnung aus werden einzelne lange Fäden nach allen Richtungen ins Wasser gezogen, die als Fallstricke für die in der Nähe vorüberschwimmenden Wasserinsekten dienen. Die auf diese Weise gefangene Beute wird dann in die Glocke gezogen und verspeist, oder wenn der Hunger gestillt ist, hier mit einem Faden aufgehangen, um für spätere Zeit aufgehoben zu werden.
[S. 226]
Der Faden, mit dem die Spinnen ihr Gewebe herstellen, entsteht aus einer zähen Flüssigkeit, die in Drüsen in der Leibeshöhle gebildet wird und aus den siebartig durchlöcherten Spinnwarzen abgesondert wird. An der Luft erhärtet diese Masse zu einem trockenen oder auch klebrigen Faden.
Die Spinne benutzt den Spinnfaden nicht nur zur Herstellung ihres Fangnetzes, sondern auch um schnell und bequem eine Ortsveränderung vorzunehmen. So läßt sie sich an dem wie von einer Spule ablaufenden Faden aus der Höhe zur Erde herabgleiten, ist auch imstande, an dem Faden wieder in die Höhe zu klettern, wobei sich dieser nicht, wie man früher glaubte, wieder in den Leib zurückzieht, sondern um die Füße gewickelt wird. Wenn es gilt, einen weit entfernten Gegenstand zu erreichen, dann schwingt sich die an einem langen Faden hängende Spinne so lange hin und her, bis sie Fuß fassen kann. Der Faden dient also auch als Schwebeseil. Schließlich spielt die Spinnkunst eine große Rolle bei der Fortpflanzung. Die weibliche Spinne baut für die Eier, die sie sorgsam behütet, und die Jungen ein Nest aus Spinnfäden, das sie entweder mit sich herumträgt oder in einem Versteck unterbringt. —
Eine regelrechte Falle zum Fang von Beute fertigt sich auch der Ameisenlöwe an, ein zu den Netzflüglern gehörendes Insekt. Seine Larve gräbt in den Sand einen Trichter, der 5 cm tief ist und am oberen Rande 7–8 cm weit ist. Dieser Trichter ist eine Fanggrube, auf dessen Grunde der Ameisenlöwe auf Beute lauert, um Ameisen oder andere Insekten, die hineinfallen, mit den zangenförmigen Kiefern zu erfassen und zu verzehren. Zum Bau des Trichters gräbt das Insekt zuerst mit den Füßen eine kreisförmige Rille und schaufelt dann den in der Mitte stehenbleibenden Sandhügel mit seinem breiten, flachen Kopf heraus, wobei durch[S. 227] Drehen des Körpers eine trichterförmige Mulde entsteht. Da sich hauptsächlich Ameisen in der Grube fangen, so führt der kleine geschickte Fallensteller den Namen „Ameisenlöwe“.
Eine eigenartige Kunst betreiben die in den Mittelmeerländern, besonders in Ägypten heimischen Pillendreher. Sie gehören zur Familie der Mistkäfer und zeichnen sich durch einen großen halbkreisförmigen Kopf aus, dessen vorderer breiter Rand gezackt ist. Die Pillendreher entfalten bei der Fortpflanzung eine höchst sonderbare Kunst. Sie drehen, wie ihr Name sagt, Pillen als Hülle für die Aufbewahrung der Eier. Mit Hilfe des zackigen Kopfschildes wird aus einem Haufen Kuhdünger ein Stück abgesondert und mit den Füßen zusammengeballt. Das Weibchen legt dann ein Ei hinein. Jetzt rollen beide Ehegatten den Dungteil hin und her, indem der eine Käfer mit den Beinen nach vorn zieht, während der andere mit dem Kopf von hinten schiebt. Durch dieses Rollen erhält der Dung allmählich die Gestalt einer Kugel, die bei den größeren Pillendreherarten einen Durchmesser von fast 5 cm hat. Ist die mühevolle Arbeit des Pillendrehens vollendet, dann graben die Käfer eine Röhre in den Erdboden, versenken darin die Dungkugel mit dem Ei und schütten die Öffnung zu. Haben die Käfer eine größere Anzahl Eier auf diese Weise eingebettet, gehen sie an Erschöpfung zugrunde. Wie so viele Insekten, besiegeln auch sie die Liebe mit dem Tode.
Die Dunghülle dient später der ausgeschlüpften Larve zur Nahrung, die sich innerhalb mehrerer Monate zum Käfer entwickelt, der dann das unterirdische Verließ verläßt, um die kurze Zeit seines Daseins mit der mühevollen Arbeit des Pillendrehens zu verbringen, bis auch er wieder der Erschöpfung von all der Arbeit erliegt. Wenn die Käfer ihr oberirdisches Leben beginnen, dann ist von ihren Eltern und Vorfahren niemand mehr am[S. 228] Leben, der sie in der eigenartigen Technik des Pillendrehens unterweisen kann, und doch fertigen sie die Dungkugeln genau nach allen Regeln der Kunst an und versenken sie in die Erde, wie es einst ihre Erzeuger getan haben — ein Beweis, daß diese Verrichtungen mit Intelligenz und Verstand nichts zu tun haben, sondern angeborene Triebhandlungen sind, die reflektorisch zur Geltung kommen.
Die Pillendreher haben noch eine andere Berühmtheit erlangt. Sie spielten in dem Tierkultus der alten Ägypter eine große Rolle. Diese sahen in der eigenartigen Gestalt des Käfers und seinem wundersamen Treiben das Symbol der Erde und Sonne. Das Bildnis des Käfers wurde in gewaltiger Größe in Stein gemeißelt und als Schmuck in den Tempeln und den Gräbern der Pharaonen aufgestellt. Diese „Skarabäen“ geben noch heute beredtes Zeugnis von jenem Volk, das vor Jahrtausenden an den Ufern des heiligen Nil eine so hohe Kultur entwickelt hatte.
Viele Insekten legen ihre Eier an Aas ab, das den später ausschlüpfenden Larven zur Nahrung dient. Ein kleiner schwarzer Käfer mit zwei orangefarbigen Binden auf den Flügeldecken, der Totengräber (Necrophorus vespillo), vergräbt kleine Tierleichen, wie Maulwürfe, Mäuse, Vögel oder Frösche in die Erde. Die Käfer sammeln sich in größerer Anzahl an einer Leiche, kriechen darunter und scharren die Erde fort, so daß der tote Körper allmählich versinkt. Die aufgeworfene Erde fällt wieder über das Grab, und bald ist von dem bestatteten Tier nichts mehr zu sehen. Die Käfer legen dann an der vergrabenen Leiche ihre Eier ab. Die Larven leben von den Verwesungsstoffen und verpuppen sich später in der Erde.
So findet sogar der traurige Beruf des Totengräbers eine Nachahmung in der Tierwelt. —
[S. 229]
Bewundernswerte Baukünstler sind die Bienen, Wespen und Hornissen. Die sechseckige Form der Zellen, die die Honigbiene für den Bau ihrer Waben wählt, stellt die bestmögliche Ausnutzung des Raumes dar.
Die Mauerwespe gräbt ein etwa 10 cm tiefes Loch in eine Lehmwand. Der ausgehobene Lehm wird mit Speichel angefeuchtet und erweicht und für den Bau einer Röhre, die sich von der Öffnung der Höhlung aus schräg nach unten neigt, verwandt. Den Innenraum des Nestes füllt die Mauerwespe mit Larven und kleinen Raupen aus, die vorher durch einen Stich betäubt und gelähmt werden und später der Wespenmade zur Nahrung dienen. Dann legt die Wespe ein Ei in den Brutraum und verschließt ihn mit Lehm. In dem Brutraum verbringt die nach wenigen Tagen ausschlüpfende Made ihr Larvenstadium, lebt von dem aufgespeicherten Vorrat, um im nächsten Frühjahr nach vollzogener Metamorphose als Wespe ihre unterirdische Wohnung zu verlassen.
Sehr kunstvolle, papierdünne Nester aus Tonerde, Bast, verfilzten Tierhaaren und anderen Stoffen bauen die Papierwespen. Die Nester haben die Gestalt einer Kugel, Halbkugel, eines Kegels oder Zylinders und hängen an Zweigen oder Blättern.
Sehr geschickte Baumeister sind die Ameisen. Sie errichten ihre Wohnungen in der Erde, in hohlen Baumstümpfen und unter Steinen oder schichten auch aus Reisern, Tannennadeln, Steinchen und Sand einen hohen Haufen zusammen. Das Gebäude besteht aus zahlreichen Gängen und mehreren Stockwerken mit vielen Räumen, die ihre besondere Bestimmung haben. Da gibt es Vorratskammern, Versammlungssäle, Zufluchtsräume für den Aufenthalt bei schlechter Witterung, Bruträume für die Eier und Puppen und Schlafkammern, in denen die kalte Winterzeit verbracht[S. 230] wird. Auch die über der Erde in Form großer Haufen angelegten Behausungen sind stets unterkellert und reichen mitunter bis zu ½ m tief in das Erdreich hinab. Von der Wohnstätte aus werden zahlreiche Straßen angelegt, die in die weitere Umgebung führen, und auf denen die Ameisen das Baumaterial, das für eine beständige Ausbesserung und Erweiterung des Baues notwendig ist, herbeischaffen. Eine ausländische Ameise (Atta fervens) baut von ihrer Behausung aus unterirdische Tunnel von 150 m Länge, an deren Ausgang sich noch eine etwa 50 m lange oberirdische Straße anschließt. Einige amerikanische Ameisenarten überdachen die über der Erde angelegten Wege. Überhaupt finden wir gerade in den Tropen, der eigentlichen Heimat der Ameisen, außerordentlich viel Abwechslung in der Art und Weise der Herstellung ihrer Bauten. Eine südamerikanische Ameise errichtet in den Zweigen der Bäume große Nester, die wie Körbe herunterhängen. Eine australische Ameise legt ihre Ansiedlung in die hohlen Äste und Zweige der Cecropienbäume an.
Eine Ameise, die im brasilianischen Tropenwald lebt, übt sogar die Gärtnerkunst aus. Sie schichtet im Gipfel der Bäume Erdteilchen auf, die schließlich einen großen Klumpen bilden, der ihre Behausung ist. Auf der Erde wuchert in kurzer Zeit ein üppiger Pflanzen- und Blumenwuchs, und es entsteht in luftiger Höhe ein prächtiger hängender Garten.
Die in den Tropenwaldungen Amerikas lebenden blattschneidenden Ameisen der Gattung Atta legen sich regelrechte Pilzkulturen an. Zu diesem Zweck suchen die Tiere in großen Scharen Bäume und Sträucher auf und schneiden mit ihren scharfen Kiefern kleine Stückchen aus den Blättern heraus. Dann begibt sich die ganze Kolonne im geschlossenen Zuge heimwärts. Jede Ameise trägt ein Blattstückchen, das größer ist als sie selbst und sie wie ein[S. 231] Schirm bedeckt, was einen höchst sonderbaren Eindruck macht. Zu Haus werden die Blätter zerkleinert und in Haufen aufgeschichtet, auf denen dann sehr bald ein Pilz wuchert, der den Ameisen zur Nahrung dient. Die Pilzkulturen werden sorgsam gepflegt, mit dem eigenen Mist gedüngt und von Unkraut und anderen Pilzarten gesäubert. Man kann also bei den Blattschneiderameisen von einer wirklichen Gartenbaukunst sprechen.
Den Ackerbau betreibt die in Texas heimische Ernteameise (Pogonomyrmex barbatus). Sie bewohnt dürre Gegenden mit nur spärlichem Graswuchs und lebt von dem Samen des sogenannten Ameisengrases (Aristida fortida). Die Tiere sammeln reiche Vorräte von dem Samen ein. Die Körner beginnen zu keimen, und es entsteht auf dem Ameisenhaufen mit der Zeit ein üppiger Graswuchs, dessen Samen den Tieren willkommene Nahrung spendet. Es ist freilich zweifelhaft, ob es sich hier wie bei den Pilzkulturen der Blattschneiderameisen um einen zielbewußten Ackerbau handelt. Das Einsammeln von Grassamen hat anscheinend nur den Zweck, Vorräte für kärgliche Zeiten anzulegen, erfolgt jedoch nicht zur Bebauung des Landes. Der Graswuchs ist vielmehr eine unbeabsichtigte Nebenerscheinung, die freilich den Tieren sehr zustatten kommt. —
Vollendete Baumeister sind die Termiten, die nicht zu den Ameisen gehören, sondern eine besondere Ordnung in der Klasse der Insekten bilden und sich den Schaben anreihen. Sie bewohnen die heißen Länder. Die Termitenhügel bestehen im Innern aus einer aus Holz gefertigten Masse, die äußerlich mit einer Erdkruste umkleidet ist. Die einzelnen Teile des Baues werden mit einem aus dem Vordarm kommenden Sekret aneinandergefügt. Das Sekret erhärtet sehr schnell und wirkt wie Zement, wodurch der ganze Bau eine ungeheure Festigkeit erhält. Er ist[S. 232] so stark, daß er selbst den strömenden Regengüssen der Tropen, Sturm, ja umstürzenden Bäumen Widerstand leistet und sogar mit Hacke und Beil nur schwer zu zertrümmern ist. Bisweilen ist die Widerstandsfähigkeit so groß, daß eine gewaltsame Zerstörung nur mit Anwendung von Sprengstoffen möglich wird.
Die Bauten der afrikanischen Termiten sehen wie große Heuschober aus und erreichen eine Höhe bis zu 3 m. Die australischen Termiten führen schlanke, turmartige Bauten auf, die oben spitz zulaufen, bis 6 m hoch und etwa 1,5 m breit sind.
Bei den Insekten, und besonders bei den Ameisen, Bienen und ihren nächsten Verwandten, ist unter allen Tieren der Sinn für die Baukunst zur höchsten Entwicklung gelangt. Sie errichten für ihr geregeltes Staatenleben wahre Prachtbauten, die stolzen Burgen und trutzigen Festungswerken gleichen, wie sie die Kultur des Menschengeschlechts in aufblühender Kunst und Wissenschaft geschaffen hat.
Vollendete Meister in der Bautechnik sind auch die Vögel, die durch das eigenartige Federkleid, das in keiner anderen Tiergruppe wiederkehrt, und durch die Umbildung der Kiefer zum Schnabel eine fest in sich abgeschlossene Reihe im Reich der Tiere bilden.
Alle Handwerke, die menschlicher Erfindungsgeist ersann, werden auch von den Vögeln ausgeübt. Die Vögel errichten ihre Bauten lediglich zum Zweck der Fortpflanzung. Das Nest ist der Brutraum für die Eier und die Wiege für die Nachkommenschaft.
Wie überaus mannigfaltig ist die Bauart der Niststätte! Bienenfresser, Eisvogel und Erdschwalbe führen Minierarbeiten aus und graben sich tiefe Erdhöhlen. Die Spechte sind die Zimmerleute im wahren Sinne des Wortes. Sie meißeln mit ihrem harten, scharfkantigen Schnabel birnenförmige Höhlungen in die Baumstämme[S. 233] und schaffen dadurch zugleich anderen Höhlenbrütern, wie Wiedehopf, Hohltaube und Blaurake, die nicht imstande sind, solch grobe Arbeit zu verrichten, passende Niststätten. Wie abhängig diese Vögel von der Zimmerarbeit der Spechte sind, geht am besten daraus hervor, daß Wiedehopf, Blaurake und Hohltaube, die bei uns in Deutschland recht selten geworden waren, wieder erheblich zugenommen haben, seitdem der Schwarzspecht, dessen verlassene Wohnungen sie mit Vorliebe beziehen, in den letzten Jahrzehnten zahlreicher geworden ist.
Das Töpferhandwerk üben unsere Schwalben aus, die aus Lehmklümpchen, welche sie mit ihrem Speichel zusammenleimen, ihre Nester bauen.
Der Kleiber mauert den Zugang zu seiner Nisthöhle mit Lehm zu, wenn er zu weit ist, um sich vor den Angriffen von Eichkätzchen und anderem Raubzeug zu schützen.
Eine kunstvolle Burg mauert der südamerikanische Töpfervogel, ein etwa stargroßer, rotbrauner Sperlingsvogel. Er errichtet auf einem dicken, wagerechten Ast eine Lehmburg von ca. 16 cm Höhe, 20 cm Länge und 11 cm Tiefe. Die Wände sind 2–4 cm dick. Der fertige Bau wiegt 8–9 Pfund. Innen ist der Raum durch eine Scheidewand, die halb so hoch wie der ganze Bau ist, in zwei Abteilungen getrennt, von denen die hinterste der Nistraum ist. Den Zugang bildet eine runde Öffnung an einer Längsseite.
Buchfink und Zeisig filzen ihre halbkugligen Nester aus Spinnengeweben und Flechten zusammen.
Die Webekunst in höchster Vollendung betreiben die Webervögel, die ihren Namen hiernach erhalten haben. Sie flechten und weben ihre Nester aus Bastfäden und Grashalmen zusammen. Diese haben die Form einer Kugel, eines Beutels oder[S. 234] einer Retorte und hängen frei an einem Zweige. Der Eingang ist stets nach unten gerichtet.
Pfahlbauer sind die Rohrsänger, welche napfförmige, tiefe Nester aus Rohr und Schilf zwischen senkrecht stehenden Rohrstengeln über dem Wasserspiegel errichten.
Schwimmende Nester, die gewissermaßen ein Floß darstellen, bauen die Taucher und das Wasserhuhn im Wasser. Die Nester sind an festgewachsenen Rohrhalmen verankert, so daß sie von der Strömung nicht fortgetrieben werden können.
Sogar das Schneiderhandwerk ist in der Vogelwelt vertreten. Die in Indien und auf den Sundainseln heimischen Schneidervögel nähen mit einem aus Pflanzenwolle selbst gedrehten oder aufgefundenen Bindfaden ein oder auch mehrere Blätter zu einer Tüte zusammen, in die sie das Nest stellen. Der Vogel sticht hierbei mit dem Schnabel Löcher in den Rand der Blätter und zieht den Faden sehr geschickt hindurch. Auch der in Südeuropa lebende Cistensänger näht sich aus Blättern eine Nesthülle. Er bereitet sich den Faden aus Spinngewebe und Pflanzenwolle.
Ähnlich wie der Schneidervogel treiben es auch manche Ameisen. Die in den Tropen der Alten Welt wohnenden Webeameisen (Oecophylla) spinnen in Büschen und Bäumen Blätter zusammen, um ihre Nester darin zu errichten. Ist der Zwischenraum zwischen zwei Blättern zu groß, um diese zusammenzuziehen, so bilden die Ameisen eine lebende Brücke. Eine Ameise faßt eine zweite mit ihren Greifzangen um den Leib, diese hält in derselben Weise eine dritte, diese wieder eine vierte usw., bis schließlich die ganz vorn schwebende Ameise imstande ist, das Nachbarblatt zu erfassen und heranzuziehen. Zum Zusammenspinnen der Blätter benutzen manche Arten ihre Larven, welche den Spinnfaden absondern. Die Larven spinnen aber nicht selbsttätig, sondern werden[S. 235] von den Ameisen mit den Zangen erfaßt und als „Webeschiffchen“ verwendet, indem sie schnell zwischen den Rändern der Blätter hin und her bewegt werden. Diese Webekunst der Ameisen, bei denen die Larven das Handwerkzeug bilden, ist eine der wunderbarsten Erscheinungen im Zauber des Tierlebens.
Manche Raubvögel, wie der Fischadler und der Wespenbussard, haben die Gewohnheit, ihre aus Ästen und Reisig hergestellten Horste mit frischen, grünen Zweigen zu belegen, um den Nistplatz unkenntlich zu machen und zu verblenden. —
Die kunstvollen Bauten, welche Säugetiere, Vögel und Insekten ausführen, müssen um so mehr unsere Bewunderung erregen, als die kleinen Baukünstler ohne Werkzeuge und ohne Gerät ihre Arbeiten ausführen. Die Natur gab ihnen die notwendigen Werkzeuge mit auf den Lebensweg, indem sie ihren Körper entsprechend ausrüstete und dem Gebrauch der Organe zugleich die notwendige Geschicklichkeit verlieh. Der Vogel trägt das Material für den Nestbau mit seinem Schnabel herbei und benutzt diesen als Pfriemen, Nadel, Zange oder Meißel, wobei auch die mit Krallen bewehrten Füße zum Festhalten des Baustoffes gute Dienste leisten. Nagetiere, wie Biber und Eichhörnchen, besitzen in den scharfen, langen Nagezähnen vorzügliche Werkzeuge zum Zerkleinern von Holz und wissen außerdem ihre Vorderfüße sehr geschickt als Hände zu gebrauchen. Die Ameisen tragen mit ihren zu Zangen umgebildeten Kiefern den Baustoff herbei und schichten ihn sachgemäß auf. Die Schienen an den Hinterbeinen der Arbeitsbiene sind flach, etwas ausgehöhlt und mit Borsten besetzt. In diesen natürlichen „Körbchen“ sammelt die Biene den Blütenstaub, aus dem das für die Ernährung so wichtige „Bienenbrot“ bereitet wird.
[S. 236]
Ein äußerst praktisches Werkzeug ist das Stachelkleid des Igels. Wird er von einem Feind bedroht, so rollt er sich zur Kugel zusammen. Kopf, Füße und Leib sind dann völlig in dem Stachelpanzer verborgen, der wie ein Verhau aus Stacheldraht den ganzen Körper schützt. Aber der Igel weiß die Stacheln noch in anderer Weise sehr praktisch zu benutzen. Sie dienen ihm als Gerät zum Fortschaffen von Gegenständen. Wenn er sich sein Winterlager bereitet, dann wälzt er sich im trockenen Laub. Die Blätter bleiben an den Stacheln haften, und er trägt sie dann auf dem Rücken nach seiner Behausung. Im Sommer und Herbst verzehrt der Igel mit Vorliebe Obst. Findet er unter einem Baum reichliches Fallobst, dann wälzt er sich auf dem Boden, spießt die Früchte hierdurch auf und trägt sie huckepack nach einem Versteck.
Aber auch Tiere, denen derartige natürliche Werkzeuge fehlen, wissen sehr kunstvolle Bauwerke zu errichten. Es gibt Fische, die für die Brutpflege Nester bauen, die kaum weniger kunstvoll sind als die Nester der Vögel, obwohl sie keine Gliedmaßen haben, die als Hand oder Werkzeug verwendet werden können.
Die meisten Fische legen ihren Laich einfach im Wasser ab und kümmern sich nicht um die Entwicklung der Jungen, die nach dem Ausschlüpfen auf sich selbst angewiesen sind und sich vom ersten Tage ihres Lebens an allein durch die Welt schlagen müssen. Einige Fischarten bauen jedoch regelrechte Nester zur Eiablage und unterziehen sich später mit großer Fürsorge der Erziehung der jungen Brut, und zwar ist es meist das Männchen, dem die Aufgabe des Nestbaus und die Führung der Jungen zufällt. In keiner Klasse der Wirbeltiere beteiligen sich die Männchen so eifrig und hingebend an der Erziehung der Nachkommenschaft als gerade bei jenen Fischarten, die sich durch Nestbau und Brutpflege auszeichnen.
[S. 237]
Die Europas Küsten bewohnende Meergrundel (Gobius minutus) errichtet unter einer leeren Muschelschale eine Vertiefung im Sande, indem sie diesen mit dem Maul fortschafft und durch wirbelnde Schläge mit den Flossen fortweht. Liegt die Muschelschale nicht mit der hohlen Seite nach unten, so packt sie der Fisch mit dem Maul und wirft sie durch einen kräftigen Ruck herum. Die Oberseite der Muschel wird dann ebenfalls durch Befächeln mit den Flossen mit Sand überschüttet, so daß der Nistplatz völlig verdeckt und unkenntlich gemacht wird. In dies von ihm erbaute Nest treibt das Männchen mehrere Weibchen zur Eiablage hinein, die dann später von dem Männchen befruchtet werden. Solange Eier im Nest sind, hält das Männchen treulich Wache am Nest und vertreibt jeden Feind aus seiner Nähe. Mit dem Ausschlüpfen der Jungen hört die Brutpflege des Männchens auf, das sich um seine Kinder nicht weiter kümmert.
Einen sehr eigenartigen Nestbau vollbringt der chinesische Großflosser (Macropodus viridiauratus), ein kleines, nur etwa 8 cm langes Fischchen, dessen blaugrüner Körper schön kupferfarben quergestreift ist. Der Fisch zeichnet sich durch unverhältnismäßig große, breite Flossen aus, die schön rotbraun gefärbt sind und bei dem größeren Männchen bedeutend stärker entwickelt sind, als bei dem kleineren, auch unscheinbarer gefärbten Weibchen. Zur Laichzeit baut das Männchen an der Oberfläche des Wassers ein Nest aus Luftblasen, die es ausspeit und die mit einer feinen schleimigen Schicht überzogen sind, wodurch die luftige Wiege eine gewisse Dauerhaftigkeit erhält. Unter innigem Liebesspiel, wobei sich die Gatten mit den Lippen erfassen und wirbelnd herumdrehen, erfolgt die Ablage der Eier unter dem Nest. Sie steigen in die Höhe und bleiben an dem Schaumnest kleben. Das Männchen übernimmt allein die Brutpflege und bewacht sorgsam[S. 238] das Nest mit dem Laich, sowie später die jungen Fischchen, die in den ersten Lebenstagen noch im Nest bleiben. Verläßt ein Jungfisch die Wiege, so wird er vom Vater mit dem Maul erfaßt und wieder in die schützende Wohnung hineingespien. Schwächliche Junge hüllt der fürsorgende Vater in eine Luftblase ein, um ihnen auf diese Weise reichlicheren Sauerstoff zuzuführen. So groß die Liebe des Makropodenmännchens zu seiner Nachkommenschaft auch ist, so hält sie doch nur solange an, als die Jungen der Führung und Aufsicht bedürfen. Ist diese Zeit vorüber, dann erlöscht der Bemutterungstrieb und das Männchen, das noch kurz zuvor ängstlich auf das Wohl seiner Kinder bedacht war, trägt kein Bedenken, diese zu verspeisen, falls sie sich nicht rechtzeitig aus seiner Nähe entfernen. Wir sehen hieraus, wie rein triebmäßig und automatisch das Tier handelt. In dem Augenblick, wo der angeborene Trieb zur Brutpflege erloschen ist, weiß der Fisch offenbar gar nicht mehr, daß die bei ihm weilenden kleinen Fischchen seine eigenen Jungen sind. Er betrachtet sie einfach als willkommene Beute. Ohne Verstand und ohne Überlegung befriedigt er ganz maschinenmäßig den angeborenen Trieb!
Ein äußerst geschickter Baumeister unter den Fischen ist der europäische Stichling (Gasterosteus aculatus), ein etwa 8 cm langes, buntfarbiges Fischchen, dessen Rücken mit drei kräftigen Stacheln bewehrt ist, mit denen die sehr erregbaren und eifersüchtigen Männchen erbitterte Zweikämpfe ausfechten, indem sie sich gegenseitig die Stacheln in den Leib zu bohren suchen. In der Fortpflanzungszeit baut das Männchen zwischen Wasserpflanzen ein etwa faustgroßes, länglichrundes, überdachtes Nest aus Pflanzenteilen, die es mit dem Maul abbeißt und herbeischleppt. Das Nest hat zwei Öffnungen. Bei der Auswahl des Baumaterials geht der Fisch ganz planmäßig zu Werke. Er prüft das Gewicht[S. 239] des Materials, indem er es fallen läßt, und wählt nur die schweren Stücke, die untersinken, während die leichten Teile, die zur Wasseroberfläche emporsteigen, keine Beachtung finden. Die Stoffe werden sorgfältig zusammengeschichtet, ungeeignetes Material wird entfernt und durch neues ergänzt. Die einzelnen Teile werden mit einem aus der Harnblase abgesonderten Nierensekret zusammengeklebt, wodurch der Bau Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluß des Wassers erhält. Das Zusammenleimen erfolgt in der Weise, daß der Fisch mit dem Leib über den Bau hinweggleitet und dabei einzelne Tropfen des Klebstoffs ausscheidet und auf das Baumaterial fallen läßt. Die äußeren Umrisse des Nestes werden in wenigen Stunden hergestellt. Die Vollendung des Baues dauert einige Tage. Dann begibt sich der Stichling auf die Brautschau. Er treibt mehrere Weibchen nacheinander in das Nest, wo sie ihren Laich ablegen. Nun hält das Männchen treulich Wacht und verteidigt den Brutplatz mit größtem Mut gegen sich nähernde Feinde. Jede schadhafte Stelle des Nestes wird sofort ausgebessert. Ferner begibt es sich häufig in das Nestinnere, um durch zitternde Bewegungen mit den Brustflossen das Wasser in Fluß zu bringen und zu erneuern, wodurch den Eiern der für ihre Entwicklung so notwendige Sauerstoff zugeführt wird. Die ausgeschlüpften Jungen werden vom Vater geführt und beschützt, bis sie so weit herangewachsen sind, daß sie sich allein ernähren können.
Wenn wir die kunstvollen Bauten der Biber und anderer Nager, der Vögel, Fische und Insekten betrachten, so stehen wir bewundernd und staunend vor den Leistungen der Tiere, die den kühnsten Erfindungen des Menschengeistes kaum nachstehen. Dürfen wir diese Handlungen, die uns wie ein Zeichen von Kultur anmuten, auf Intelligenz, auf Verstand und Überlegung zurückführen?
[S. 240]
Je mehr man sich mit der Beobachtung der Tierseele beschäftigt, um so mehr gewinnt man den Eindruck, daß das Tier in der Hauptsache von angeborenen Trieben beherrscht wird, die seine Handlungsweise bestimmen.
Als Ornithologe habe ich mich viel damit befaßt, junge Nestvögel aufzuziehen, um ihre körperliche und vor allem ihre seelische Entwicklung kennenzulernen. Da wundert man sich immer wieder, wie der junge Vogel ohne Pflege seiner Eltern, ohne von diesen Unterricht und Anweisung zu erhalten, in kurzer Frist seine Selbständigkeit erlangt und alle Lebensverrichtungen, wie sie für seine Art typisch und notwendig sind, sich aneignet. Der junge Vogel braucht das Fliegen, Laufen oder Schwimmen nicht erst zu erlernen. Sobald seine Schwungfedern ausgewachsen sind, weiß er seine Flügel zu gebrauchen. Er erhebt sich vom Nestrand in die Luft und schwingt sich in den freien Äther, ohne daß ihm von seinen Eltern gezeigt wird, wie man die Flügel zu bewegen hat, wie man den Schwanz zum Steuern gebrauchen muß, wie man den Körper um seine Längsachse drehen und wenden muß, um Schwenkungen auszuführen. Alles dies sind für den jungen Vogel, der seine ersten Flugversuche macht, sozusagen selbstverständliche Dinge, die er nicht erst mühsam zu erlernen braucht, sondern die die Natur als Erbstück ihm mit auf den Lebensweg gab.
Die kleine Ente und jeder andere Schwimmvogel begeben sich gleich nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei ins Wasser und schwimmen und tauchen lustig in dem nassen Element, als ob sie es nie anders gekannt hätten.
Das junge Hühnchen, welches in einer Brutmaschine die Eischale verließ und niemals mit seiner Mutter oder anderen Hühnern in Berührung kam, läuft sehr bald hurtig umher und pickt[S. 241] die Körner, die es findet, auf. Ein angeborener Trieb sagt ihm, wie es sich zu ernähren hat.
Der Neuntöter oder Rotrückige Würger hat die Gewohnheit, seine Nahrung, die in Insekten, kleinen Fröschen und jungen Nestvögeln besteht, auf einem Dornzweig aufzuspießen, um sich einen Vorrat zu sichern. Wenn wir einen jungen, erst wenige Tage alten Würger dem Nest entnehmen und im Zimmer aufziehen, so beginnt er, sobald er selbständig geworden ist, Mehlwürmer oder kleine Fleischstücke auf einen Nagel oder Dornzweig, den wir in seinem Käfig angebracht haben, aufzuspießen und legt sich genau ebenso einen Galgen an, wie es seine Artgenossen in der Freiheit tun, obwohl er es niemals gesehen hat.
In meiner Schrift „Das Leben der Vögel“[4], die auch das Seelenleben der Vögel eingehend behandelt, habe ich darauf hingewiesen, daß dem Baumfalken, der ebenso wie der Wanderfalk nur von Vögeln lebt, die er fliegend fängt, sogar das Beutemachen im Fluge angeboren ist. Ein von mir erzogener junger Baumfalk beobachtete meine im Käfig befindlichen Zimmervögel gar nicht, sobald ich aber einen Vogel im Zimmer frei fliegen ließ, fing er ihn sofort sehr geschickt im Fluge mit den Fängen, fußte dann mit seiner Beute auf einem Schrank oder anderem hohen Sitzplatz auf, tötete das Opfer durch einen Biß in den Schädel, rupfte die Federn und begann dann zu kröpfen. Genau ebenso verfährt der Baumfalk in der Freiheit, und der junge Vogel, der in zarter Jugend aus dem Horst genommen und von Menschenhand aufgezogen war, tut dies genau in derselben Weise, ohne einen Unterricht von seinen Eltern erhalten zu haben. Die Vorstellung, daß die alten Vögel ihre Jungen in den für sie notwendigen Lebensverrichtungen[S. 242] unterweisen und anlernen, ist durchaus irrig. Die Lebensverrichtungen beruhen auf angeborenen Trieben, die ganz selbständig und von allein in der Vogelseele erwachen.
Sogar die Technik des Nestbaues ist dem Vogel angeboren. Der junge Vogel, der zum ersten Male zur Fortpflanzung schreitet, errichtet das Nest, wie es für seine Art typisch ist, ohne jeden Unterricht, ohne Kenntnis von den Gesetzen der Schwere, von geometrischen und mathematischen Regeln. Der Töpfervogel baut seine Lehmburg, der Schneidervogel näht Blätter zusammen, der Webervogel flechtet ein Hängenest, ohne in diesen Künsten unterrichtet zu werden. Wir sehen hieraus, daß der Nestbau weiter nichts ist als eine Triebhandlung, die der Vogel vollbringt, ohne sich selbst über seine Handlungsweise im klaren zu sein. Die Ausführung erfolgt vielmehr ganz mechanisch und automatisch, im Unterbewußtsein, wie es für die Triebhandlungen charakteristisch ist.
Ebenso wie mit dem Nestbau der Vögel verhält es sich auch mit den Bauten der Biber, Eichhörnchen und aller anderen Tiere. Wir dürfen sie nicht als das Ergebnis hoher Intelligenz, nicht als Auswirkungen verstandesmäßigen, logischen Denkens auffassen, sondern können hierin nur angeerbte, automatische Triebhandlungen erblicken. Dies zeigt sich am besten darin, daß die Tiere ihre Kunst lediglich nur so weit ausüben, als sie für ihre Lebensbedürfnisse in der Natur notwendig sind, jedoch nicht imstande sind, sie bei anderen Gelegenheiten zweckentsprechend anzuwenden. Der gefangene Biber denkt nicht daran, einen Haufen aus Reisern oder Ästen aufzuschichten, um die Einfriedigung seines Käfigs übersteigen zu können und sich einen Weg zur Freiheit zu verschaffen. Der gekäfigte Buntspecht zermeißelt die in seinem Gewahrsam aufgestellten Aststücke lediglich, um seinen[S. 243] angeborenen Trieb, nach im Holz verborgenen Larven zu suchen, zu befriedigen, wird aber niemals planmäßig und zielbewußt einen starken Holzpfeiler zertrümmern, um sich in den Besitz der Freiheit zu setzen. Solange ihm kein anderes Holz als der Pfeiler seines Käfigs zur Verfügung steht, hämmert er freilich an diesem umher. Er untersucht aber immer wieder andere Stellen und arbeitet ganz planlos daran herum, kommt aber nicht darauf, an einer bestimmten Stelle ein großes Loch zu meißeln, durch das er seinen Körper hindurchzwängen kann, und doch wäre dies für ihn ein leichtes, denn in der Freiheit stellt er ja solche Löcher her, wenn er einen Brutraum zimmert.
Die großen Papageien, wie Araras und Kakadus, sind imstande, mit ihrem harten, scharfkantigen Schnabel gewaltige Zerstörungen anzurichten. Sie zernagen nicht nur dicke Holzstämme in kurzer Zeit, sondern durchschneiden sogar Eisendraht und durchbohren starkes Blech. Ich habe sehr viel Papageien für tierpsychologische Untersuchungen in Gefangenschaft gehalten, aber niemals beobachten können, daß die Tiere ihre Zerstörungskunst mit Überlegung anwendeten, um sich zu befreien. Der auf einem Ständer mit einer Kette angefesselte Papagei würde sich unschwer befreien können, wenn er seine Sitzstange, an die die Kette mit einem Ring befestigt ist, an einer Stelle durchnagen würde. Dies tut er aber nicht, sondern er nagt an dem Holz der Stange nur aus Zeitvertreib und reiner Zerstörungslust bald an dieser, bald an jener Stelle, so daß es häufig sehr lange dauert, bis er die Sitzstange zerstört hat. Ist dies wirklich geschehen, dann kommt er nicht auf den Einfall, den Ring der Kette abzustreifen und sich zu befreien, sondern bleibt ruhig auf seinem gewohnten Sitz, um die Stange an einer anderen Stelle von neuem zu zerstören.
[S. 244]
Alle diese Beispiele, die man noch beliebig vermehren könnte, zeigen immer wieder, daß das Tier nicht überlegt und nicht verstandesmäßig handelt, sondern lediglich automatisch seinen angeborenen Trieben folgt. So dürfen wir auch in den so sinnreich erscheinenden Kunstbauten, welche die Tiere errichten, keine Leistungen hohen Verstandes und großer Intelligenz erblicken, sondern können sie nur als mechanische Handlungen, die reflektorisch von angeborenen Trieben ausgelöst werden, bewerten.
Der Ausspruch der alten Römer „animal non agit, sed agitur“ hat hier seine volle Berechtigung.
So sehr die angeborenen Triebe auch im Vordergrunde der Tierseele stehen, so beherrschen sie andererseits das Tier doch nicht völlig. Das Tier hat bis zu einem gewissen Grade auch die Fähigkeit, sich geistig über diese Triebe zu erheben. Die Affekte, Zorn, Freude, Trauer, Mut und Furcht, sind der Tierseele ebenso eigen wie dem Menschen. Wir wissen ferner, daß das Tier durch Erfahrung lernt, und daß es imstande ist, die Erfahrungen, die es gemacht hat, zweckentsprechend zu verwerten. Dort, wo die Tiere durch den Menschen verfolgt werden, werden sie scheu und furchtsam, wo sie Gutes von ihm empfangen, begegnen sie dem Menschen mit Vertrauen und Sorglosigkeit. Falsch wäre es aber, hieraus schließen zu wollen, daß das Tier verstandesmäßig handelt, daß es überlegt, logisch denkt und Schlußfolgerungen ableitet. Die moderne Tierpsychologie hat nachgewiesen, daß die geistigen Fähigkeiten der Tiere, die der Laie so gern überschätzt, kaum über die Funktion der Assoziation hinausgehen, die die Elementarstufe der höheren Geistestätigkeit darstellt. Die Assoziation beruht nicht auf Urteilskraft und logischem Denken, sondern sie ist nur die rein mechanische Verknüpfung zweier Ereignisse in der Weise, daß bei Wiederholung des einen das andere,[S. 245] auch wenn es nicht in Erscheinung tritt, unwillkürlich mitempfunden wird. Empfängt ein Tier an einer bestimmten Örtlichkeit Gutes und Wohltaten vom Menschen, so wird es hier zahm und zutraulich, weil es die Wohltaten mit dem Menschen an der betreffenden Stelle in Verbindung bringt — ein Vorgang, der sich im Rahmen der Assoziation abspielt.
Das Zustandebringen von Assoziationen setzt ein gutes Gedächtnis voraus, und gerade das Gedächtnis ist bei vielen Tieren hervorragend ausgebildet, was auch wieder ein Beweis ist, daß das Tier nicht nur Reflexmaschine ist, sondern auch zu einer höheren geistigen Funktion befähigt ist.
Die geistigen Eigenschaften der Tiere sind sowohl artlich wie individuell sehr verschieden. Von einer Lurche, einem Fisch oder einem Wurm können wir nicht dieselben geistigen Eigenschaften verlangen wie von einem Hund oder einem Affen. Wir müssen also die verschiedenen Klassen, Ordnungen und Arten der Tiere nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch ganz verschieden bewerten.
Häufig macht sich bei ganz nah verwandten Formen ein großer Unterschied in geistiger Beziehung bemerkbar. Dies ist z. B. bei der Nachtigall und dem Rotkehlchen der Fall, worauf ich schon in meinem „Leben der Vögel“ hingewiesen habe. Eingehende Versuche, die ich mit Nachtigall und Rotkehlchen ausgeführt habe, bewiesen, daß das Rotkehlchen ein bedeutend höher entwickeltes Seelenleben besitzt als die Nachtigall. Das Rotkehlchen assoziiert sehr schnell und vielseitig und zeigt sich Herr in jeder Lage. Die Nachtigall ist viel einseitiger veranlagt, ihre Assoziationsbegabung ist nur gering entwickelt. Bei einer Ordnung der Vögel nach dem Maßstabe der Intelligenz würden also Nachtigall und Rotkehlchen, die nach ihrem Körperbau eine nahe Verwandtschaft zeigen[S. 246] und daher systematisch zu derselben Gattung gehören, in voneinander weit entfernten Gruppen einzureihen sein.
Auch individuell tritt ein großer Unterschied in der geistigen Begabung hervor. Während der eine Hund sehr schnell lernt und sich mühelos abrichten läßt, begreift ein anderer Hund derselben Rasse nur schwer, was sein Herr verlangt. Ein Papagei lernt sehr leicht und fast ohne besonderen Unterricht sprechen, indem er Redensarten, die er öfters hört, von allein auffaßt, ein anderer begreift trotz sorgsamen Unterrichts und aller Mühe, die man sich mit dem Vogel gibt, nur wenig oder gar nichts.
Unter den Vögeln übertreffen nach meinen Erfahrungen die Papageien alle anderen Vögel in geistiger Veranlagung. Sie gleichen hierin mehr den höherstehenden Säugetieren als den Vögeln, deren seelische Funktionen im allgemeinen nicht bedeutend sind. Im Gegensatz zu den Säugetieren ist bei den Vögeln die graue Rinde des Gehirns nur sehr wenig ausgebildet, so daß sie für die psychische Tätigkeit fast gar nicht in Betracht kommt. Selbst bei den Papageien, die das vollkommenste Gehirn unter den Vögeln besitzen, ist die graue Rinde nur schwach entwickelt. Wenn trotzdem ihre geistigen Fähigkeiten nicht unbedeutend sind, so ist dies ein Beweis, daß die graue Rinde allein für die Seelentätigkeit nicht maßgebend ist.
Unter den Säugetieren stehen in geistiger Veranlagung die Affen, und von diesen wieder die Menschenaffen, obenan.
Sehr wertvolle Aufklärung über das Seelenleben der Menschenaffen verdanken wir Köhler, dem Leiter der von der deutschen Akademie der Wissenschaften vor dem Weltkriege auf Teneriffa begründeten Anthropoidenstation, die leider, wie so viele andere Kulturwerke, ein Opfer des Krieges geworden ist.
Aus den wertvollen Versuchen, die Köhler mit Menschenaffen[S. 247] ausführte, geht hervor, daß besonders der Schimpanse geistig sehr hoch steht (Abbildung 29 u. 30). Köhlers Schimpansen errichteten sich aus Kisten, die sie übereinander auftürmten, eine Leiter, um eine in der Kuppel ihres Käfigs unerreichbar aufgehängte Banane herunterzuholen. Freilich ging ihr Verstand nicht so weit, daß sie die Kisten zielbewußt in richtiger Lage, wie sie für ein Gleichgewicht notwendig ist, aufeinander stellten, sondern sie verfuhren hierbei planlos, so daß die Kisten häufig wieder herabstürzten, und es mitunter längere Zeit dauerte, bis der Bau gelang. Ebenso verstanden sie es sehr geschickt, mit einer langen Stange eine an der Zimmerdecke hängende Frucht herunterzuschlagen, oder sie benutzten die Stange als Kletterbaum, indem sie diesen senkrecht hinstellten, schnell hinaufkletterten und die Frucht ergriffen, bevor die Stange das Gleichgewicht verlor und umfiel. Eine außerhalb des Käfigs hingelegte Banane holten die Schimpansen mit einem Stab heran, ja sie schoben sogar mehrere Stäbe, die eine Vorrichtung zum Ineinanderstecken hatten, zusammen, wenn der einzelne Teil zu kurz war, um die außerhalb des Käfigs liegende Frucht zu erreichen. Zu diesen Leistungen waren die Affen nicht etwa besonders abgerichtet, sondern sie vollführten sie von selbst. Es waren ihre eigenen Erfindungen.
Aus diesen sehr interessanten Versuchen geht hervor, daß der Schimpanse zur Erreichung eines bestimmten Zieles, z. B. um sich in den Besitz von Nahrung zu setzen, zielbewußt zweckmäßige Werkzeuge benutzt, ja sogar mehrere Werkzeuge miteinander verbindet. Köhler schließt hieraus, daß der Schimpanse innerhalb gewisser Grenzen einsichtiger Handlungen fähig ist, d. h. ein gewünschtes Ziel durch eine mehrere Teilhandlungen umfassende, aber einheitlich zusammenhängende Handlung erreichen kann.
[S. 248]
Ähnliche Vorgänge kann man auch an anderen Affen beobachten. Die Kapuzineraffen schlagen mit Steinen die harte Schale von Nüssen auf. Im Berliner Zoologischen Garten lernen es die Kapuzineraffen sehr bald, in Ermanglung von Steinen die Falltür, welche den Außen- und Innenkäfig verbindet, zu diesem Zweck zu benutzen. Sie legen die Nuß an den unteren Rand der Türöffnung und schlagen dann mit der Hand die Falltür so lange auf und zu, bis die Nußschale zertrümmert wird.
Einen Gebrauch von Werkzeugen finden wir auch bei den Pavianen, die Steine von den Bergwänden herabschleudern, wenn sie angegriffen und verfolgt werden.
Im Berliner Zoologischen Garten lebte vor Jahren ein Makak, der Leute, welche ihn neckten oder ärgerten, mit Sand bewarf. Der Affe nahm eine Handvoll Sand und schleuderte ihn durch das Gitter des Käfigs gegen seinen Widersacher.
Nach den Berichten von Zenker, der den Gorilla (Abbildung 28) im afrikanischen Urwald eingehend beobachtet hat, bricht sich dieser Affe Zweige von den Bäumen ab, um sich mit ihnen die lästigen Fliegen abzuwehren. „Das wäre ganz unzweifelhaft Gebrauch von Werkzeugen auch im Freileben eines Tieres, wo von Nachahmung des Menschen und Anregung durch diesen keine Rede sein kann“, sagt mit Recht Heck in der vierten, neubearbeiteten Auflage von „Brehms Tierleben“.
Eine äußerst interessante Beobachtung des Gebrauchs eines Werkzeuges durch einen Menschenaffen konnte ich vor kurzem im Berliner Zoologischen Garten machen. Ich stand im Affenhause vor dem Käfig des etwa achtjährigen Orang-Utan. Der rotbehaarte Menschenaffe saß mit verschränkten Armen im Halbschlaf in seinem Käfig. Plötzlich erhob er sich langsam mit der seiner Sippe eigenen Behäbigkeit, kletterte zur Kuppel des Käfigs herauf,[S. 249] deren Stabgitter mit einem engmaschigen Drahtgeflecht überdeckt war, um ein Durchgreifen des Affen zu verhindern. Hier erfaßte der Orang das überstehende Drahtende einer schadhaften Masche und drehte es ab. War es schon auffallend, daß der Affe den Draht offenbar zielbewußt abdrehte, indem er stets nach derselben Seite die drehenden Handbewegungen ausführte, so war doch das, was nun folgte, geradezu verblüffend. Der Affe begab sich mit dem abgerissenen Drahtstück zum Boden und steckte den Draht in ein kleines, nur stecknadelkopfgroßes Loch, das sich in dem Zinkbelag seines Käfigs befand. Jetzt erweiterte er das Loch systematisch durch fortgesetztes Drehen des Drahtes und hatte es in kurzer Zeit so weit vergrößert, daß er mit der Fingerspitze hineinfassen konnte, um den Belag aufzureißen. Auch hierbei zeigte er wieder verblüffenden Verstand. War ein Stück abgerissen, dann schob er zunächst den Draht unter den noch fest aufliegenden Belag, um die Kante etwas hochzuheben und einen Angriffspunkt zu erhalten. Schließlich versuchte er mit den Zähnen den Belag aufzureißen. Aber die scharfen Kanten des Metalls verursachten seinem Mund Schmerzen. Nun holte er seine Schlafdecke, wickelte sie um den mit der Hand hochgehobenen Rand des Zinkbelags und faßte diesen dann mit den Zähnen. Das war eine Glanzleistung von zielbewußter Handlungsweise. Man hatte das erhabene Gefühl, daß sich hier in der Tierseele der Beginn alles höheren Denkens regte. Der zielbewußte Gebrauch von Werkzeugen trat hier in seinen ersten Anfängen zutage, man glaubte sich um Jahrmillionen zurückversetzt in jene alte Zeitepoche, wo ein Pithecanthropus oder Australopithecus die ersten Werkzeuge in die Hand nahm und den Grundstein zur späteren Kultur des Menschen legte.
[S. 250]
Ein Zeichen derartig hoher Intelligenz finden wir unter den Tieren nur bei den Affen, und besonders bei den Menschenaffen. Freilich ist das Gehirngewicht im Verhältnis zum Körpergewicht auch bei den Menschenaffen noch bedeutend geringer als beim Menschen, der unter allen Lebewesen das höchstentwickelte Gehirn besitzt, dessen Leistungsfähigkeit ihn weit über die Tiere, auch über die Menschenaffen erhebt. Ein großer Unterschied zwischen dem Menschen- und Tierhirn besteht darin, daß der wichtigste Teil des menschlichen Hirns, das Sprachzentrum, den Tieren, auch den Menschenaffen völlig fehlt. Ein Vergleich zwischen zwei entsprechenden Hirnwindenfeldern beim Menschen und beim Menschenaffen zeigt, daß beim Menschenaffen nur etwa ein Sechstel der Zentren vorhanden sind, die die verschiedenen Gehirnleistungen verursachen. Der Abstand zwischen Menschenhirn und Affenhirn ist also sehr groß. Dank seines hochentwickelten Gehirns ist der Mensch allein imstande, in logischer Gedankenfolge Schlüsse zu ziehen und abstrakt zu denken. Diese Fähigkeit gab ihm allein die Möglichkeit, sich zu Kultur emporzuschwingen, sich die Erde mit all ihren Lebewesen untertan zu machen und selbst die geheimnisvollsten Kräfte der Natur, Elektrizität und Magnetismus, in seinen Dienst zu bannen. Als glänzendes Zeugnis menschlichen Geistes und menschlicher Erfindungsgabe zieht heute das lenkbare Luftschiff, das ein Zeppelin ersann, durch den blauen Äther und müssen die Schallwellen im unermeßlichen Weltenraum über Land und Meer den Weg nehmen, den der Menschenwille ihnen vorschreibt. Gegen solche Taten bleiben die Handlungen der Menschenaffen, so sehr wir sie auch als tierische Leistung bewundern, weit zurück. Gerade daß wir darüber staunen, daß ein Tier, wie der Schimpanse oder Orang, überhaupt befähigt ist, ein Werkzeug in primitiver Weise zu gebrauchen, zeigt am[S. 251] besten, wie gering die geistigen Fähigkeiten der Tiere zu bewerten sind. —
Aus den Versuchen Köhlers geht ferner hervor, daß der Schimpanse ein ganz vortreffliches Gedächtnis besitzt. Eine Birne, die vor den Augen der Tiere in die Erde gegraben war, wurde von ihnen am folgenden Tage sofort herausgeholt. Die Schimpansen untersuchten stets sogleich die richtige Stelle, die sie sich genau gemerkt hatten. Ein ebenso vorzügliches Gedächtnis besaß ein Maki, den ich längere Zeit in Gefangenschaft hielt. Fand er bei seinen Spaziergängen im Zimmer ein Stückchen Apfel, das ich irgendwo versteckt hatte, so suchte er später die betreffende Stelle sofort zielbewußt wieder auf, wenn er in dasselbe Zimmer kam, auch dann, wenn Tage oder Wochen dazwischen lagen. Nicht nur die Affen, sondern fast alle Tiere, auch solche, die geistig nicht hochstehen, haben bekanntlich ein gutes Ortsgedächtnis und behalten solche Stellen, wo sie Nahrung gefunden haben, lange in der Erinnerung.
So gut das Erinnerungsvermögen des Schimpansen an die Vergangenheit auch ist, so scheint ihnen anderseits eine zielbewußte Berücksichtigung der Zukunft nicht eigen zu sein. Wohl schleppten Köhlers Schimpansen Futtervorräte mit sich, wenn sie während des Fressens in einen anderen Raum getrieben wurden, aber dies Verhalten läßt sich auch auf eine augenblickliche Futtergier, also auf eine Gegenwartsempfindung zurückführen, und es muß daher sehr zweifelhaft erscheinen, ob es sich hier um eine zielbewußte Sorge für die Zukunft handelt.
Der Begriff der Zukunft scheint der Tierseele überhaupt zu fehlen. An meinen gefangenen Vögeln, selbst an den geistig so regsamen Papageien konnte ich immer wieder beobachten, daß sie beim Entleeren ihres Kotes niemals darauf Rücksicht nahmen,[S. 252] ihr Futter- und Wassergefäß sauber zu halten. Sie begriffen es selbst in jahrelanger Gefangenschaft nicht, daß das Trinkwasser durch den Kot verdirbt und ungenießbar wird. Ebenso zernagt ein Papagei immer wieder seine hölzerne Sitzstange, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, daß er hierdurch seine bequeme Sitzgelegenheit verliert.
Andere Tiere, wie Hamster, Biber, Kleiber und Meisen, sammeln Nahrungsvorräte für den Winter ein. Aber auch hierbei fehlt den Tieren offenbar das Verständnis dafür, daß es sich um eine Sorge für die Zukunft handelt. Hamster, Kleiber und Meisen, die man in ganz jugendlichem Alter in Gefangenschaft aufzieht, legen sich im Herbst auch im Käfig Vorratskammern an, obwohl sie niemals eine Wintersnot kennengelernt haben und auch keine Anleitung älterer, erfahrener Artgenossen erhalten haben. Hieraus geht hervor, daß das Einsammeln von Nahrung nur auf Grund eines angeborenen Triebes erfolgt, der automatisch in der Tierseele erwacht. Wir können daher in dem Anlegen von Wintervorräten keine zielbewußte Vorstellung von der Zukunft erblicken.
Die Erinnerung der Tierseele an vergangene Geschehnisse braucht nicht auf Verstandesleistung zu beruhen, sondern läßt sich auch durch die einfache seelische Funktion der Assoziation erklären. Die Wiederkehr eines Ereignisses, das mit einem anderen in Verbindung steht, löst die Erinnerung an dieses aus. Das Tier empfindet dann das, woran es sich erinnert, nicht als etwas Vergangenes, sondern als etwas Gegenwärtiges. Die Vergangenheit wird dadurch in der Tierseele wieder zur Gegenwart. Ebenso wie dem Tier die Vorstellung von der Zukunft unbekannt ist, scheint es auch zweifelhaft, ob das Tier imstande ist, die Vergangenheit im Geiste bewußt zu durchleben.
[S. 253]
Wir dürfen daher vermuten, daß das Tier keine Vorstellung von der Zeit besitzt. Es kennt nur die Gegenwart, aber nicht die Begriffe der Vergangenheit und Zukunft. Hieraus würde sich als weitere Folge ergeben, daß das Tier kein Ichbewußtsein hat, denn das Bewußtsein des eigenen Ich beruht darauf, daß man sich selbst in Gegensatz zur Zeitfolge stellt. Die klare Vorstellung von der Vergangenheit, die Erkenntnis der Gegenwart und die zielbewußte Berücksichtigung der Zukunft heben die eigene Person aus der Außenwelt heraus und verleihen ihr im Ichbewußtsein eine Sonderstellung. —
Den Forschungen auf der Anthropoidenstation in Teneriffa verdanken wir ferner interessante Aufklärung über das soziale Leben des Schimpansen. Da der Schimpanse im Freien stets in Familien oder Gruppen lebt, ist sein Geselligkeitstrieb sehr ausgeprägt. Dies äußert sich besonders darin, daß ein einzelnes Tier, das gewaltsam von der Gruppe abgesondert wird, unter der Trennung sehr leidet. Es schreit und jammert und macht alle Anstrengungen, wieder zu der Gruppe zu gelangen. Wesentlich anders benehmen sich aber die Tiere in der Gruppe. Sie empfinden die Trennung von ihrem Genossen nur sehr wenig und zeigen nur dann eine vorübergehende und auch nur geringe Teilnahme, wenn dieser sehr schreit. Sie unternehmen aber niemals Versuche, das getrennte Tier zu befreien und es der Gruppe wieder zuzuführen. Wir sehen hier wieder, daß es sich nur um die automatische Befriedigung eines angeborenen Triebes handelt, nämlich des Geselligkeitstriebes. Das abgesonderte Tier leidet unter der Isolierung, weil es den Geselligkeitstrieb nicht befriedigen kann, während die anderen Tiere dies Empfinden nicht haben, solange sie in der Gruppe leben. Die Befriedigung des eigenen Wohlbefindens steht also allein im Vordergrunde.
[S. 254]
Wesentlich anders verhalten sich die Schimpansen, wenn ein Tier in der Gruppe vom Menschen angegriffen und bedroht wird. Dann stürzen sie sofort herbei, um ihrem bedrängten Kameraden zu helfen und ihn zu verteidigen. Ob es sich hier wirklich um eine zielbewußte Absicht zur Hilfe handelt, d. h. um eine edle, selbstlose Tat, muß immerhin zweifelhaft erscheinen. Der Anblick des Kampfes eines Artgenossen löst wohl bei den übrigen Tieren ebenfalls eine Wut- und Kampfesstimmung aus, die sie zum Angriff veranlaßt. Es kann sich also ebensogut um eine rein automatische Übertragung einer Gemütsstimmung handeln, und wir sind kaum berechtigt, hier etwa von ethischen oder moralischen Empfindungen zu sprechen. Gerade bei den Tieren wird noch mehr wie bei den Menschen die Gemütsstimmung ungeheuer leicht übertragen. Wenn sich z. B. zwei Hunde beißen, so stürzen alle in der Nähe befindlichen Hunde herbei und beteiligen sich an der Rauferei nur aus Lust am Beißen und Streiten, aber nicht in der Absicht, einem Kameraden zu helfen. Sie beißen dann sinnlos sowohl auf den Angreifer wie auf den Bedrängten los. —
Die Schimpansen haben einen gewissen Sinn für Kunst und Schönheit. Sie belustigen sich damit, einen Reigen aufzuführen. Sie gruppieren sich kreisförmig um einen Baum oder irgendeinen Gegenstand und trotten unter eigentümlichen, rhythmischen Bewegungen einer hinter dem anderen her. Bei diesem sonderbaren Tanz behängen sie sich gern mit Gegenständen, wie Lappen, bunten Fäden oder Strohhalmen, die sie sich um die Schultern, über den Hals und die Ohren legen. Auch einzelne Tiere schmücken sich in dieser Weise und stolzieren in ihrer Zierde gefallsüchtig umher. Man kann also geradezu von einem Kunst- und Schönheitssinn sprechen.
Etwas Ähnliches finden wir auch in der Vogelwelt. In Australien lebt ein den Staren nahverwandter Vogel, der Laubenvogel[S. 255] (Ptilonorhynchus violaceus), der sich für sein Liebesleben überdachte Lauben baut. Diese werden aus Reisern und Laub auf dem Erdboden hergestellt. Sie haben eine längliche Gestalt und zwei Eingänge. Den Innenraum schmücken die Vögel mit bunten Vogelfedern und farbigen Gegenständen aus und legen auch außen vor die Eingänge Muscheln und bunte Steinchen. Diesen Vögeln ist also ein gewisser Schönheitssinn eigen, der sich in der Freude an bunten Gegenständen ausdrückt.
Die Liebeslauben sind der Ort, an dem die Geschlechter vor der eigentlichen Brutzeit miteinander tändeln und sozusagen die Flitterwochen verleben. Sie dienen aber nicht als Nistplatz, sondern die Vögel errichten später ein Nest in Bäumen, in dem sie die Eier erbrüten und die Jungen erziehen.
Die Freude des Schimpansen und der Laubenvögel an Schmuck und bunten Gegenständen dürfen wir wohl als den Anfang eines Kunstsinnes ansehen, der sich später beim Menschen zur höchsten Vollkommenheit entwickelt hat. So finden wir auch hier wieder unverkennbare nahe Beziehungen zwischen Mensch und Tier. —
[4] Friedrich von Lucanus, Das Leben der Vögel, Verlag Scherl 1925.
[S. 256]
Ein schöner Sommertag ladet uns zu einem Besuch des Zoologischen Gartens in Berlin ein. Wir durchwandern die herrlichen, parkartigen Anlagen und erfreuen uns an dem reichen Tierbestand, der dank der eifrigen Fürsorge des langjährigen, verdienstvollen Direktors, Geheimrats Heck, die schweren Gefahren der Inflationszeit glücklich überwunden hat und wieder auf einer Höhe steht, die dem alten Ruhm dieses Instituts volle Ehre macht. Zum Schluß betreten wir das Aquarium, um die reichhaltige Sammlung an Reptilien, Amphibien und Fischen, die alle Weltteile und Weltmeere umfaßt, kennenzulernen. Im obersten Stockwerk befindet sich das Insektarium. Wir stehen vor einem großen Glasbehälter, der mit frischen Zweigen ausgeschmückt ist und einem kleinen Wald gleicht. Die Aufschrift des Namensschildes lautet: „Indische Stabheuschrecken“.
Wir sehen zunächst kein Tier. Erst bei näherer Betrachtung fällt uns plötzlich die Bewegung eines Gegenstandes auf, den wir bisher für einen Zweig hielten. Langsam lösen sich lange, spinnenartige Füße aus dem Blätterwerk, die einen langgestreckten, dünnen Körper tragen, der einem Pflanzenstengel gleicht. Jetzt erblicken wir in dem dichten Blättergewirr überall solche eigenartigen Tiergestalten, deren Körper so sehr einem Zweig gleicht, daß er in der Umgebung völlig verschwindet. Die Wirkung wird noch durch die braungrüne Farbe der Tiere erhöht.
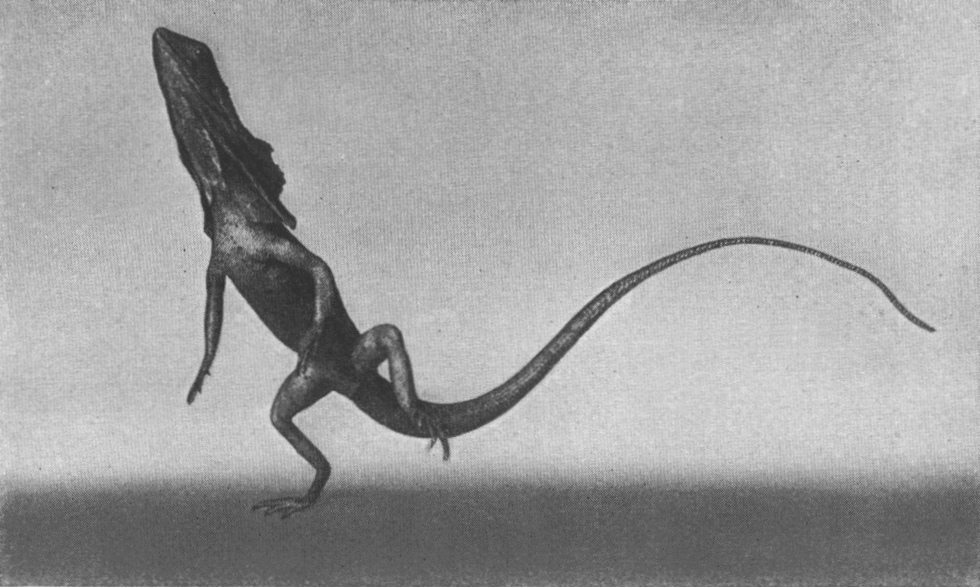
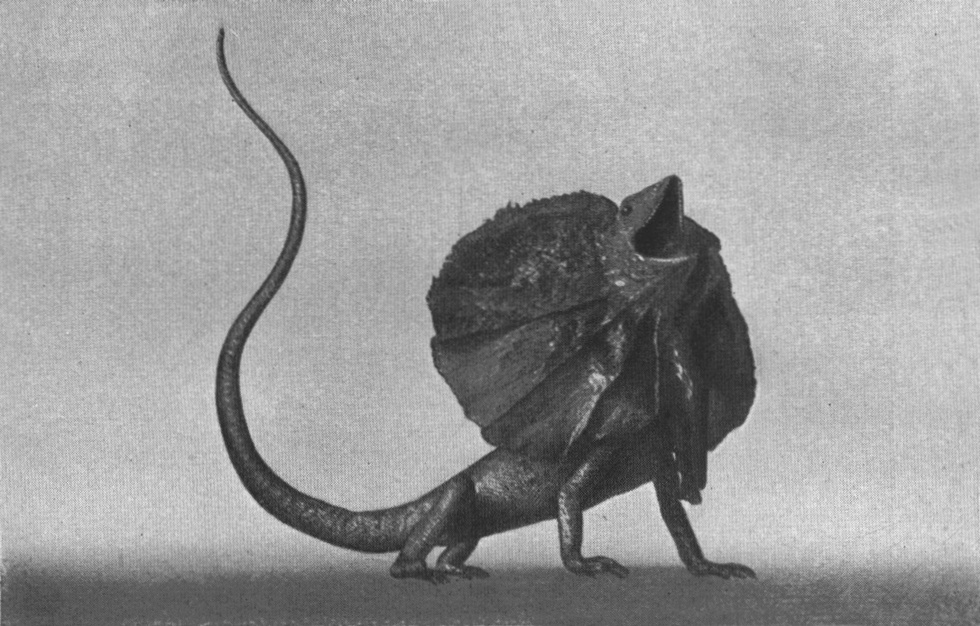
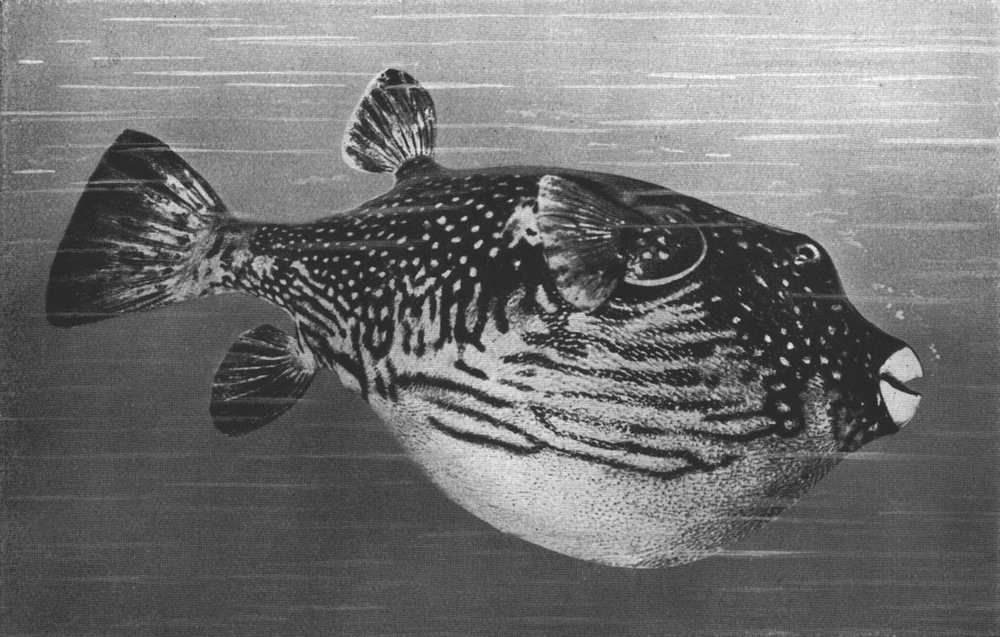
Diese eigenartige Anpassung von Tieren an Gegenstände ihrer Umgebung, die sie unsichtbar macht, heißt wissenschaftlich „Mimikry“[S. 257] (Nachahmung). Der große Nutzen der Mimikry besteht darin, daß das Tier hierdurch vor den Nachstellungen seiner Feinde geschützt ist. Es wird in der Ruhe nicht erkannt und infolgedessen übersehen.
Die Mimikry ist besonders verbreitet unter den Insekten. Ein Seitenstück zur Stabheuschrecke ist das Wandelnde Blatt (Phyllium siccifolium), das in seinem Aussehen völlig einem grünen Blatt gleicht. Die Flügeldecken zeigen sogar die Rippen und Verästelung der Struktur eines Blattes. Infolgedessen herrscht bei den Eingeborenen Indiens, der Heimat dieses merkwürdigen Tiers, der Glaube, dies entstehe aus einem Blatt, das durch Wunder und Zauber Füße erhalte.
Auf Madagaskar gibt es einen kleinen Käfer, der einer Baumflechte täuschend ähnlich ist und auf mit Flechten bedeckten Zweigen lebt, wo er dann völlig unsichtbar ist.
Viele Schmetterlinge gleichen in der Ruhe mit aufgerichteten, zusammengelegten Flügeln einem welken Blatt. In vollendetster Weise tritt dies bei den in Afrika und Asien verbreiteten Arten der Gattung Callima hervor. Bei einer indischen Art (Callima inachis) ist die Unterseite der Flügel rötlichgelb gefärbt. Die Ähnlichkeit mit einem welken Blatt wird noch durch schwarze Tupfen, wie sie absterbende Blätter haben, und durch dunkle Linien, die den Blattadern gleichen, erhöht. Der hintere Rand der Hinterflügel läuft in einen langgezogenen Fortsatz aus, der sich auf den Ast, auf dem der Schmetterling ruht, anlegt und den Stiel des durch die zusammengelegten Flügel gebildeten, welken Blattes vortäuscht. —
Die Mimikry besteht nicht nur in einer Nachahmung der Umgebung, sondern bisweilen auch in der Ähnlichkeit mit einem anderen Tier, das gefürchtet ist und von den Feinden des harmlosen[S. 258] Verstellungskünstlers gemieden wird. Unter der abschreckenden Maske ist dann das Tier vor den Nachstellungen seiner Feinde geschützt. Der in Europa und Asien verbreitete Hornissenschwärmer (Aegeria apiformis) hat, wie der Name sagt, das Aussehen einer Hornisse. Der gelb und braun gestreifte Körper trägt glasartige durchsichtige Flügel. Beim Fliegen läßt dieser kleine, harmlose Schmetterling, der im Kleide der gefürchteten Hornisse die Mitwelt irreführt, ebenso wie sein Vorbild einen surrenden Ton hören, wodurch der Betrug noch vervollständigt wird. Die Flügel des jungen, aus der Puppe schlüpfenden Schmetterlings sind noch nicht durchsichtig, sondern mit braunen Schuppen bekleidet, die aber sehr lose sitzen und gleich beim ersten Flug durch den Luftzug abgestreift werden. Der Hornissenschwärmer ist ein sehr schädliches Insekt, da die Raupe sich in den Stamm der Bäume einfrißt und hier einen fast ¼ m langen Gang aushöhlt, um sich zu verpuppen. Die Arbeit beansprucht sehr viel Zeit. Es dauert über ein Jahr, bis die mühsame Bohrarbeit vollbracht ist. Erst im Herbst des zweiten Lebensjahres spinnt sich die Raupe aus zernagtem Holz ihr Puppengehäuse, aus dem im darauffolgenden Frühjahr der fertige Schmetterling ausschlüpft. Der Larven- und Entwicklungszustand währt also fast 2 Jahre. In neuerer Zeit macht sich der Hornissenschwärmer auch in Südamerika bemerkbar, wohin er wahrscheinlich durch den Holzhandel verschleppt ist.
Als Wolf im Schafpelz tritt die Teufelsblume (Idolum diabolicum) auf, die unsere ehemalige Kolonie Deutsch-Ostafrika bewohnt. Sie gehört zu den Fangschrecken oder Gottesanbeterinnen. Das grün gefärbte Insekt besitzt vorn zwei lange Fangarme, die am Grunde blattartig erweitert und weiß und lila gefärbt sind. Mit hoch emporgestreckten Armen, die einer prächtigen Blüte[S. 259] gleichen, sitzt das raubgierige Tier an einer Pflanze und lauert auf Fliegen und Schmetterlinge, die der verführerischen Blume einen Besuch abstatten wollen. In dem Augenblick, wo das Tier sich auf den „Blütenkelch“ niederläßt, wird es von dem trügerischen Insekt ergriffen und erbarmungslos verspeist.
Eine andere Fangschrecke (Empusa egena), die im Gebiete des Orangeflusses lebt, besitzt weiße, rosa geränderte Flügel, die von dem beutelauernden Tier nach oben entfaltet werden und wie eine zarte Windenblüte aussehen. Nähert sich ein Insekt, so wiegt die Fangschrecke ihren Leib leise hin und her und schaukelt die Blütenflügel wie eine vom Winde bewegte Blume, um das Opfer vollends zu täuschen und anzulocken.
Eine nahe Verwandte dieser eigenartigen Fangschrecken, die im harmlosen Kleide der lieblich duftenden Blüten auftreten, aber innerlich wie „reißende Wölfe“ sind, ist die europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Sie entbehrt zwar der trügerischen Anlockungsmittel ihrer Verwandten, wird aber durch ihre grüne Farbe im Busch so unkenntlich gemacht, daß sie von den Beutetieren, denen sie auflauert, nicht bemerkt wird. Sie ist besonders raubgierig und mordlustig und stellt nicht nur anderen Insekten, sondern sogar kleinen Wirbeltieren nach, die sie sehr vorsichtig beschleicht.
Die Wildheit der Gottesanbeterin zeigt sich in abstoßender und sadistischer Weise in der Liebe. Nach vollzogener Paarung ergreift das Weibchen das kleinere und schwächere Männchen mit den Fangarmen, aber nicht im Gefühl der Liebe und Wollust, sondern — um es zu erwürgen und zu verspeisen. So ist es Sitte bei den Gottesanbeterinnen, diesen raubgierigen und blutdürstigen Insekten, bei denen nicht einmal die Liebe zarte Empfindungen und Gefühle auslöst.
[S. 260]
Der Name „Gottesanbeterin“ erklärt sich aus der Gewohnheit dieser Tiere, bei der Lauer auf Raub die Fangarme wie „ein betender Priester“ zum Himmel emporzustrecken. —
In den Meeren Australiens lebt ein wundersamer Gesell, dessen bizarre Körperformen ohnegleichen sind. Es ist der den Seepferdchen nah verwandte Fetzenfisch (Phyllopteryx eques). Der Körper dieses Knochenfisches ist mit langen, stachel- und bandartigen Fortsätzen bedeckt, die nach allen Richtungen wirr abstehen. Der Fisch hält sich im Tang und Seegras auf und verschwindet hier durch seinen zerfetzten Körper völlig. Die Fetzenfische sind zum Teil sehr lebhaft gefärbt. Sie tragen auf rotem Grunde blaue, gelbe und weiße Abzeichen, die als Streifen und Flecke auftreten. Die bunte Farbe ist aber durchaus nicht unvorteilhaft, sondern erhöht noch die täuschende Wirkung der zerfetzten Gestalt in dem bunten Pflanzengewirr.
Viele Tiere sind ohne Rücksicht auf die Körperform nur durch ihre Farbe der Umgebung vortrefflich angepaßt, so daß sie in der Ruhe völlig verschwinden. Zweifellos liegt hierin ein guter Schutz gegen die Nachstellungen ihrer Feinde. Das bekannteste Beispiel ist der grüne Laubfrosch auf dem grünen Blatt. Die Wüstenbewohner, wie Wüstenfuchs, Springmaus, Wüstenlerche, Steinschmätzer und Echsen tragen ein rötlichgelbes Haar-, Feder- oder Schuppenkleid, das der Farbe des Wüstensandes gleicht. Im hohen Norden tritt weiße Farbe auf. Schneehuhn und Wiesel legen im Winter ein weißes Kleid an, das zu der Schneedecke vorzüglich paßt. Der Eisbär, der die Region des ewigen Winters bewohnt, ist dauernd in Weiß gekleidet. Unter den Vögeln sind vor allem die Bodenbrüter durch eine Schutzfarbe ausgezeichnet, und zwar sind es vornehmlich die Weibchen, die diesen Vorteil genießen, um während des Brütens möglichst wenig aufzufallen.
[S. 261]
Die Fasanenhenne, die Stockente und alle anderen weiblichen Enten haben ein düsteres, bodenfarbiges Gefieder. Die Männchen dagegen prangen in einem buntfarbigen Federkleid, das aber für die Erhaltung der Art keinen erheblichen Nachteil hat, da sie sich am Brutgeschäft und der Erziehung der Jungen nicht beteiligen. Im Gegensatz dazu sind beim Rebhuhn, dem Brachvogel und den Lerchen beide Geschlechter mit einer Schutzfarbe versehen, und dies erscheint auch notwendig, da bei diesen monogam lebenden Vögeln das Männchen ebenso wie das Weibchen für die Nachkommenschaft sorgt.
Bei den Enten weicht der Verlauf der Sommermauser insofern von anderen Vögeln ab, als die Schwungfedern nicht allmählich, sondern fast zu gleicher Zeit ausfallen, wodurch der Vogel unflugfähig wird. Nun haben wir hier die höchst sonderbare Erscheinung, daß die Erpel in dieser Zeit ein erdfarbenes Kleingefieder anlegen, das dem Federkleid der Ente gleicht, und erst später wird durch eine zweite Mauser das Prachtkleid angezogen. —
In besonders hohem Maße ist die Schutzfarbe bei den Fischen entwickelt. Alle Fische, welche im klaren Wasser leben und unweit der Oberfläche umherschwimmen, haben silberglänzend gefärbten Bauch und Seiten, dagegen einen dunklen Rücken. Die düstere Rückenfarbe schützt gegen Feinde, die sie von oben aus der Luft angreifen, da sich der Fisch von dem dunklen Untergrunde des Gewässers nicht abhebt. Die hellglänzende Unterseite dagegen ist ein gutes Schutzmittel gegen Raubfische, die auf dem Boden liegend ihrer Beute auflauern und den schwimmenden Fisch von unten sehen, denn in der von unten gesehenen, glitzernden Wasserfläche verschwindet der glitzernde Fischleib. Ferner spiegelt die silberfarbene Unterseite der Fische im Wasser, so daß sie durch den Reflex des Lichtes die jeweilige Farbe des Wassers erhält.
[S. 262]
Der Körper des Hechtes ist dunkel quergestreift, was eine ausgezeichnete Anpassung an seinen Lebensaufenthalt ist. Der Hecht steht gern im Röhricht und lauert hier unbeweglich auf Beute. Die Querstreifung ahmt die Rohrhalme nach und entzieht dadurch den Räuber den Blicken seiner Opfer. Wir sehen hieraus, daß der Zweck einer Schutzfärbung nicht nur darin besteht, ein Tier vor den Nachstellungen seiner Feinde zu schützen, sondern daß hierin auch eine Erleichterung des Beutemachens liegt, indem die Mimikry den lauernden Räuber unsichtbar macht.
Denselben Vorteil genießt auch die Gottesanbeterin von ihrer grünen Farbe, die sie im Blätterwerk unkenntlich macht. Hier ist die Färbung ebenso wie beim Hecht weniger eine Schutztracht gegen feindliche Angriffe, als eine Tarnkappe beim Beutemachen.
Bei den Grundfischen ist die ganze Oberfläche des Körpers, also Rücken und Seiten, dunkel gefärbt und häufig durch Flecken und Streifen verziert. Hierdurch sind die Fische dem Untergrunde angepaßt, wie z. B. der Wels, der Schlammbeißer, die Schmerle, die Forelle und unter den Seefischen vor allem die Plattfische, Seezunge, Flunder und Steinbutt. Letztere haben sogar die Fähigkeit, ihre Körperfarbe dem jeweiligen Untergrunde, auf dem sie ruhen, anzupassen. Auf sandigem Boden nimmt der Flachfisch eine Sandfarbe an, auf dunklem Grunde eine dunkle Farbe. Ja die Anpassung geht so weit, daß sogar ein Muster nachgeahmt wird. Schollen, welche auf einem mit zerbrochenen Muschelschalen besäten Grunde liegen, erhalten große weiße Flecke. Die Farbenveränderung geht in der Weise vor sich, daß das helle und dunkle Pigment in den Farbzellen jeweilig verschieden angehäuft wird, so daß also bald diese, bald jene Farbe hervortritt oder auch aus beiden Farben ein Muster zusammengestellt wird. Der Reiz für diese Farbenveränderung geht von den Augen aus, denn durch[S. 263] Versuche wurde nachgewiesen, daß geblendete Fische ihre Farbe nicht mehr der Umgebung anpaßten. Es handelt sich also um einen optisch-physiologischen Vorgang. Außerdem spielt auch das Gefühl hierbei eine gewisse Rolle, denn wenn der Wassergrund mit einer Glasfläche abgedeckt wird, so wird die Farbenanpassung beeinträchtigt. Der Fisch unterscheidet also den hellen, sandigen Grund von dem dunklen, steinigen Grund nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Gefühl. Lebt der Fisch dauernd, oder lange Zeit auf dem gleichen Untergrund, so erfolgt eine Vermehrung der hierzu passenden Pigmente, und die anderen Pigmente nehmen im gleichen Verhältnis ab, wodurch die Fähigkeit der Farbenveränderung sich verliert.
Ein Tier, das seit langen Zeiten durch seinen Farbenwechsel allgemein bekannt ist und daher sprichwörtlich geworden ist, ist das Chamäleon (Abbildung 21). Der Farbenwechsel des Chamäleons ist aber durchaus nicht, wie man vielfach glaubt, eine Anpassung an die Umgebung, sondern wird von ganz anderen Faktoren hervorgerufen. Licht und Temperatur, sowie die Gemütsstimmung und jeweilige Körperbeschaffenheit rufen die Farbenveränderung hervor. Die Lederhaut des Chamäleons besitzt gelbe, rote und braune Farbzellen, die durch Kontraktion der farblosen Oberhaut genähert oder von ihr entfernt werden können. Im letzteren Falle sieht das Tier sehr hell, bisweilen fast weiß aus, im ersteren Falle treten die Farben mehr hervor. Die Farbzellen können ferner ihre Lage zueinander verändern. Sie können über- oder nebeneinander liegen, wodurch die verschiedenen Farben und Farbenschattierungen erzeugt werden. Auf diese Weise wechselt die Färbung zwischen weiß, gelb, braun, grau, blau, rostrot und grün und den dazwischenliegenden Abstufungen. Auf der Grundfarbe treten meist noch Zeichnungen hervor, wie Flecke,[S. 264] Tupfen und Streifen von mehr oder weniger unregelmäßiger Form. Die gewöhnliche Farbe ist ein schönes Grün oder Braungrün und paßt sehr gut zu der Umgebung der auf Bäumen lebenden Tiere. Lebhafte und dunkle Farbe ist ein Zeichen des Wohlbefindens, während helle Farbe meist mit einem krankhaften Zustand verbunden ist. Vor dem Tode wird das Chamäleon gelbweiß oder grauweiß. Wenn man das Chamäleon nur auf einer Seite belichtet oder erwärmt, so verändert nur diese Seite die Farbe, während die andere Seite nicht darauf reagiert, woraus der große Einfluß des Lichtes und der Wärme auf den Farbenwechsel hervorgeht.
Eine weitere Eigentümlichkeit des Chamäleons ist die unabhängige Bewegung der beiden Augen. Während das eine Auge nach oben gedreht wird, kann zu gleicher Zeit das andere nach unten oder nach der Seite gestellt werden. Zu der Beweglichkeit der Augen gesellt sich noch als dritte Eigentümlichkeit die Art der Ernährung. Das Chamäleon lebt von Insekten, hauptsächlich von Fliegen. Seine sehr langsamen und unbeholfenen Bewegungen würden ihm den Fang der beweglichen Kerbtiere sehr erschweren, ja fast unmöglich machen, wenn es nicht eine besondere Vorrichtung hierfür hätte in Gestalt der Zunge, die etwa 15 cm weit vorgeschnellt werden kann, die erspähte Beute anleimt und in den Rachen führt. Die Zunge wird also als Pfeil gebraucht, mit dem das Opfer aus der Ferne gewissermaßen geschossen wird. Die Mechanik der beweglichen Zunge ist folgende: die kurze, dicke und kolbenförmige Zunge ist vermittels einer Scheide mit dem Zungenbein verbunden. Die Scheide steckt wie eine Röhre auf dem Zungenbein und ist in der Ruhe harmonikaartig gefaltet. Durch Vorstrecken des Zungenbeines wird die kolbenartige Zunge wie eine Kugel im Blasrohr nach vorn geschleudert. Sie zieht[S. 265] dabei die bewegliche Scheide mit sich, deren zusammengelegte Falten sich zu einem langen Rohr ausdehnen. Infolge großer Muskelkraft wird die ganze Bewegung blitzartig schnell ausgeführt. Das Insekt wird durch den Klebstoff, der vorn an der Zunge sitzt, angeleimt (Abbildung 21).
Ein gewisser Farbenwechsel läßt sich auch beim Laubfrosch wahrnehmen. Die Farbe kann zwischen dem bekannten Blattgrün und einem schmutzigen Braungrün wechseln. Die Veränderung der Farbe wird durch den Tastreiz hervorgerufen. Befinden sich Bauch und Saugscheiben der Zehen auf glattem Grunde, so tritt die rein grüne Farbe hervor, während eine Berührung mit rauher Fläche die dunkle Färbung hervorruft. Der Lichtreiz spielt dabei keine Rolle, da der Farbenwechsel bei geblendeten Fröschen in derselben Weise erfolgt. So erklärt es sich, daß Laubfrösche, die auf rauher Rinde sitzen, dunkel sind, während der Frosch auf einem glatten Blatt grün ist. Durch diese seltsame Einrichtung wird also automatisch eine Anpassung hervorgerufen, die dem Tier einen vorteilhaften Schutz verleiht.
Einen lebhaften Farbenwechsel zeigen auch die Anolis, welche die Wälder und Gärten Südamerikas beleben und sehr gewandt und hurtig in den Zweigen umherklettern. Die sehr bunt gefärbten Tiere verändern ihre Farbe noch auffallender und schneller als das Chamäleon, wobei es sich jedoch weniger um eine Anpassung an die Umgebung zu handeln scheint, sondern mehr die jeweilige Gemütsstimmung die Ursache ist. Die Tiere sind außerordentlich erregbar und führen erbitterte Kämpfe untereinander aus (Abbildung 24).
Eine andere Echse, der australische Moloch (Moloch horridus), besitzt dagegen ähnlich wie das Chamäleon die Fähigkeit, sich in der Farbe bis zu einem gewissen Grade der Umgebung anzupassen.[S. 266] Der auf rotbraunem Grunde gelbgestreifte Körper nimmt auf grauem Gestein eine düstere rauchgraue Färbung an.
Der Moloch besitzt aber noch eine andere vortreffliche Nutztracht, die ihn vor Nachstellungen schützt. Sein ganzer Körper ist bis auf die Unterseite mit dornartigen Stacheln bedeckt, die dem Tier ein wahrhaft fürchterliches Aussehen geben und durch ihre Gefährlichkeit den lüsternen Feinden den Appetit vertreiben.
Ein stacheliges Schuppenkleid trägt auch der südafrikanische Riesengürtelschweif, eine Echse von fast ½ m Körperlänge. Der mit wehrhaften Stacheln besetzte Schwanz, mit dem das Tier empfindliche Schläge austeilt, ist eine vorzügliche Verteidigungswaffe des sonst harmlosen Kriechtieres (Abbildung 22).
Eine ähnliche Nutztracht besitzt auch die amerikanische Krötenechse (Phrynosoma cornutum). Mit seiner breiten, gedrungenen und plumpen Figur gleicht das Tier mehr einer Kröte als einer Echse. Wie beim Moloch ist der ganze Oberkörper mit Stacheln besetzt, die am längsten auf dem Hinterkopf sind. Die Stacheln sind nicht allein ein gutes Schreck- und Abwehrmittel gegen Feinde, sondern haben auch einen praktischen Nutzen. Mit Hilfe der Kopfstacheln bohrt sich das sonderbare Tier abends in den Sand ein, um hier die Nacht zu verbringen.
Die Krötenechse hat noch eine ganz besondere Eigenschaft. Bei gelindem Druck spritzt aus der Nase und den Augen Blut heraus. Eine besondere Schutzvorrichtung scheint das Blutspritzen nicht zu sein, sondern ist wohl nur eine Folge der zarten Struktur der Blutgefäße (Abbildung 23).
Giftige Tiere sind bisweilen sehr auffallend gefärbt, so daß man dann geradezu von einer „Warnfarbe“ sprechen kann. Die auf dunklem Grunde orangegelb gemusterte Krustenechse (Xeloderma suspectum) ist die einzige Echse, welche wie die Schlangen[S. 267] Giftzähne hat. Das Gift befindet sich in besonderen Giftdrüsen und dringt beim Biß durch die gefurchten Zähne in die Wunde. Das Gift tötet Hunde und Katzen infolge Herzlähmung in kurzer Zeit, ruft jedoch beim Menschen nur vorübergehende Krankheitserscheinungen hervor. Die eigenartige Echse lebt auf der Westseite der Kordilleren.
Als Warnfarbe kann man auch die schwarzgelbe Zeichnung unseres Feuersalamanders (Salamandra maculosa) ansehen, der an den Bauchseiten und auf dem Kopf Drüsen besitzt, die ein scharfes, ätzendes Sekret absondern, das den Salamander für Tiere, welche von Lurchen leben, ungenießbar macht, ja sogar kleinere Tiere tötet. Nur die Ringelnatter ist gegen das Gift unempfindlich und scheut sich nicht, gelegentlich auch den Feuersalamander anzugreifen und zu verzehren. Auch für den Feuersalamander selbst ist das Drüsensekret unschädlich, denn größere Tiere fressen nicht selten in Gefangenschaft kleinere Genossen auf, ohne Schaden zu erleiden. Die Fortpflanzung des Feuersalamanders zeigt besondere Eigentümlichkeiten. Gewöhnlich werden die Larven lebendig geboren, d. h. sie schlüpfen bereits im Mutterleibe aus dem Ei. Bisweilen werden auch Eier abgelegt, und die Jungen schlüpfen dann sofort aus. Es handelt sich in diesem Falle gewissermaßen um eine Frühgeburt. Der vom Weibchen empfangene männliche Samen kann viele Monate in einem besonderen Behälter aufbewahrt werden, von dem aus dann eine spätere Befruchtung der Eier erfolgt. So bringt bisweilen ein einzeln gehaltenes Salamanderweibchen zur Überraschung seines Besitzers nach einem halben Jahr plötzlich Junge zur Welt, ja es kann abermals nach mehreren Monaten eine zweite Geburt folgen, ohne daß das Weibchen mit einem Männchen in Berührung kam.
Beim Feuersalamander und der Krustenechse handelt es sich nicht um eine Schutzfarbe, die als Mimikry wirkt und das Tier[S. 268] durch Anpassung an die Umgebung unsichtbar macht, sondern im Gegenteil um eine sehr auffallende Färbung, die gewissermaßen ein Aushängeschild ist und dem lüsternen Feind schon von weitem entgegenruft: „Rühre mich nicht an, ich bin giftig.“ Diese Nutztracht ist also gerade das Gegenteil der Mimikry.
Aber auch eine bunte Färbung kann unter Umständen als Schutzfarbe wirken, indem das Tier gerade durch bunt zusammengewürfelte Farben unkenntlich gemacht wird. Ich konnte diesen Vorgang zuerst an einem Kleinen Buntspecht (Dryobates minor) beobachten, dem kleinsten Vertreter der bei uns heimischen Spechte, der nicht größer als ein Sperling ist. Er trägt wie seine größeren Vettern, Großspecht und Mittelspecht, ein schwarzweiß geschecktes Federkleid und eine rote Kopfplatte, ist also ein sehr auffällig gefärbter Vogel. Ich hielt einen jung aufgezogenen Kleinspecht längere Zeit in einer Zimmervoliere und war immer wieder erstaunt, wie oft ich den Vogel übersah, auch wenn er nicht weit vor mir an einem Stamm saß, freilich ohne sich zu bewegen. Ich forschte der Ursache dieser eigentümlichen Erscheinung näher nach, bis ich schließlich die Erklärung fand. Durch die bunte, wirre Färbung werden die Umrisse des Körpers verwischt. Dieser wirkt nicht mehr als einheitliches Ganzes, sondern er wird durch die unregelmäßige Fleckung und Zeichnung aufgelöst. Ich habe auf diese Art der Schutzfärbung zuerst in einem Vortrag der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft im Jahre 1902 hingewiesen und sie „Körperauflösung“ oder „Somalyse“ genannt[5].
Die Somalyse spielt im Leben der buntgefärbten Tiere eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Jugendkleider vieler Hirscharten sind weiß gefleckt. Das Kalb drückt sich, wenn die Mutter nicht[S. 269] in der Nähe ist, bei nahender Gefahr regungslos auf den Erdboden nieder und wird infolge der Fleckung, die die Konturen des Körpers auflöst, nicht so leicht erkannt. Junge Möwen, Regenpfeifer, Strandläufer, Kiebitze und viele andere Vogelarten tragen ein unregelmäßig dunkel geflecktes und getupftes Dunenkleid, das, wenn sich die Tiere ruhig verhalten, schon auf nahe Entfernung ihre Körperform völlig unkenntlich macht. Die grün, rot und blau gefärbten Papageien verschwinden im Tropenwald weniger durch ihre Anpassung an die prächtige Blumenflora, sondern durch die Körperauflösung, welche durch die Zusammenstellung der bunten Farben hervorgerufen wird. Dies kommt am besten bei den buntgescheckten Loris zur Geltung, die, wie ich mich oft genug beim Anblick eines großen, mit diesen herrlichsten Papageien besetzten Flugkäfigs überzeugen konnte, schon aus nicht zu weiter Entfernung leicht übersehen werden, da durch die buntgescheckte Färbung der einheitliche Eindruck verlorengeht. Dasselbe ist auch bei vielen Reptilien der Fall, deren Schuppenkleid gefleckt oder gestreift ist. Die Kreuzotter mit ihrem schwarzen Zickzackstreifen auf der Oberseite ist, wenn sie zusammengerollt ruht, nur sehr schwer zu erkennen.
Bekanntlich sind Eier der meisten offen brütenden Vogelarten gefleckt. Ein auf bläulichem Grunde rötlich oder braun geflecktes Ei ist der Farbe des Nestinnern durchaus nicht angepaßt, aber es verschwindet schon in geringer Entfernung unseren Blicken, weil durch die Fleckung das Ei als solches nicht mehr zu erkennen ist. Die Eigestalt wird eben durch die Zeichnung aufgehoben.
Der Begründer der Tierphotographie Schillings, der als erster mit der photographischen Kamera ins dunkle Afrika hinauszog, um „Natururkunden“ von den Tieren der Wildnis heimzubringen, sagt in seinem vortrefflichen Werke „Mit Blitzlicht[S. 270] und Büchse“: „daß die so auffallend schwarzweiß gestreifte Färbung der Zebras ihre Träger in keiner Weise von der sie umgebenden Landschaft abhebt. Je nach der Beleuchtung sehen Zebras ganz verschieden gefärbt aus; aber selbst da, wo ihre schwarzweiße Färbung auf nächste Entfernung zur Geltung kommen könnte, verschwinden die Tiere in ganz außerordentlichem Maße mit der Färbung der Steppe.“
Die Ursache dieser eigenartigen Erscheinung, über die der berühmte Forscher seine Bewunderung ausspricht, liegt eben darin, daß die dunkle Querstreifung des hellen Felles die Umrisse des Körpers schon in großer Nähe völlig auflöst. Dieselbe Wirkung erzielt auch das gestreifte Tigerfell und die gefleckte Leopardenhaut.
Das Prinzip der Somalyse hat im Weltkriege eine große Bedeutung gewonnen. Man bemalte Geschütze, Flugzeughallen, Wagen und andere Teile der Heeresausrüstung mit bunten Farben, um ihre im Gelände sich abhebende Gestalt zu verwischen und sie für die Flieger unkenntlich zu machen.
Die Mimikry ist an eine ganz bestimmte Umgebung gebunden. Sie kommt nur dann zur Geltung, wenn das Tier sich auf dem Untergrunde befindet, dessen Farbe es angepaßt ist. Die Somalyse hat dagegen eine viel weitere, eine allgemeine Bedeutung. Sie ist völlig unabhängig von der Umgebung, denn sie beruht nicht auf einer Anpassung und auf einer Nachahmung, sondern sie wirkt ganz selbständig, einzig und allein durch eine möglichst unregelmäßige Verteilung der Farben, die die Umrisse der Gestalt verwischen und den Tierkörper in seinem Gesamteindruck auflösen.
Die Somalyse beruht auf Fleckung und Streifung, besonders Querstreifung, und zeigt uns, daß die buntfarbigen Tiere ebenso eine Schutzfarbe besitzen wie die einfarbigen Tiere, die einer bestimmten Umgebung angepaßt sind.
[S. 271]
Eine andere, sehr wichtige Frage ist die, auf welche Weise diese Schutzfarben entstanden sind.
Der große englische Naturforscher Charles Darwin, der den von Lamarck zuerst ausgesprochenen Gedanken einer allmählichen Entwicklung der Lebewesen aus einfachen, niedrigen Formen zu einer gewaltigen Lehre erhob, führt die Entstehung der Arten auf eine natürliche Zuchtwahl und Auslese zurück. Vererbung und Abänderung (Variation), beeinflußt durch den Kampf ums Dasein, der eine natürliche Auslese verursacht, sind nach Darwin die Faktoren, welche die Arten bilden und umformen.
Mit Hilfe des Darwinismus läßt sich die Entstehung jener Schutzfärbung, die wir in ihrer Anpassung als Mimikry bezeichnen, unschwer erklären.
Alle Lebewesen, sagt Darwin, variieren bis zu einem gewissen Grade. Je weiter wir in der Stammesgeschichte zurückgehen, um so größer mag die Variationsbreite gewesen sein und die Möglichkeit, sich umzubilden. Der Laubfrosch war ursprünglich nicht ausschließlich grün, sondern es kamen auch Individuen vor mit weniger ausgesprochener grüner Farbe, die vielleicht mehr eine gelbe oder braune Färbung zeigten. Alle diese vom Grün abweichenden Variationen hoben sich von dem grünen Blätterwerk mehr ab als ihre grüngefärbten Artgenossen. Sie wurden infolgedessen von den Feinden leichter erkannt und fielen diesen eher zum Opfer als die grünfarbigen Frösche mit ihrem dem grünen Laub besser angepaßten Kleid. So erfolgte im Kampf ums Dasein eine Auslese der Natur, die alles Unzweckmäßige vernichtete und eine rein blattgrüne Farbenvarietät des Laubfrosches heranzüchtete, wobei die Vererbung eine ausschlaggebende Rolle spielte.
Dies ist in kurzen Zügen, an einem einfachen Beispiel erläutert, der Gedankengang des Darwinismus. Es war nicht eine kühne,[S. 272] genial erfundene, spekulative Hypothese, die Darwin aufstellte, sondern die in seiner Heimat, in England so blühende Rassenzucht der Haustiere gab dem ernsten Forscher und Denker den Hinweis für seine neue Lehre. Durch eine künstliche Zuchtwahl vermehrten die Züchter die Tierrassen. Sie wählten zur Zucht stets nur solche Individuen aus, die die zu formenden und zu festigenden Rassemerkmale zunächst andeutungsweise und später in immer höherem Grade zeigten, bis schließlich durch eine sorgfältige Auslese, die alles Minderwertige ausmerzte, die Rasse in höchster Potenz herausgeformt und durch Vererbung konstant gefestigt war. Diese wichtigen Prinzipien der Rassenzucht übertrug Darwin auf die Natur, in der der Kampf ums Dasein auf natürlichem Wege jene Auslese erwirken soll, die der Züchter zielbewußt ausübt.
Der von Darwin neu geprägte Begriff der „natürlichen Zuchtwahl“ hat eine fundamentale Bedeutung erlangt, weil hier zum ersten Male die Bildung der Lebewesen auf einen rein natürlichen Vorgang zurückgeführt wird, ohne Zuhilfenahme übernatürlicher Kräfte, ohne Wunderglauben.
Noch mehr als die Lehre eines Kopernikus hat der Gedankengang Darwins die Weltanschauung umgestaltet, ja sie völlig aus den Angeln gehoben. Von gegnerischer Seite, besonders von der Kirche, wurde scharfer Einspruch gegen die ketzerische Lehre des britischen Forschers erhoben. Das Fundament der Religion, an dem schon ein Kopernikus, ein Lamarck gerüttelt hatten, schien völlig zusammenzustürzen. Mit aller Gewalt lehnte sich die Theologie gegen die neue Weltanschauung auf, die Moral und Ethik zu untergraben drohte. Unbeirrt der scharfen Fehde und Anfeindung ging die Wissenschaft ihren Weg weiter. Selbst der große Forscher Cuvier, der mit aller Kraft das teuflische Werk Darwins zu bekämpfen suchte und sich ganz auf den alten[S. 273] Boden der biblischen Schöpfungsgeschichte stellte, vermochte den Stein, der ins Rollen gekommen war, nicht aufzuhalten. Die Entwicklungslehre oder Deszendenztheorie blieb in der Wissenschaft anerkannt. Sie wurde von Darwins Schüler, dem Jenaer Zoologen Ernst Häckel, dem genialen Schöpfer des Biogenetischen Grundgesetzes, vollends ausgebaut und gefestigt.


Bedeutet die Entwicklungslehre, welche die allmähliche Entwicklung der Lebewesen aus gemeinsamen, niedrigen Urformen herleitet, in der Tat eine Vernichtung der christlichen Religion! Untergräbt sie wirklich Moral und ethisches Empfinden? Dies kann nur der ernstlich glauben, welcher die Dinge engherzig und laienhaft ansieht.
Was sagt doch die Schöpfungsgeschichte im 1. Buch Mose der Bibel? Das erste, was geschaffen wird, ist das Licht, das, wie die Wissenschaft uns lehrt, die Quelle alles Lebens ist. Der zweite Schöpfungstag bringt die Entstehung des Weltensystems, der am dritten Tage die Bildung der Erde mit erhärteter Oberfläche, mit Trennung von Land und Wasser folgt. Es entstehen auf der Erde als erste organische Gebilde die Pflanzen. Am vierten Schöpfungstage wird das Weltensystem durch Schaffung neuer Gestirne, deren Licht die Erde erleuchtet, vervollkommnet. Die beiden folgenden Schöpfungstage sind der Bildung der Tierwelt gewidmet. Am letzten Tage tritt dann der Mensch als Krone der Schöpfung in die Welt.
Nicht in kindlichem Aberglauben sollen wir die Schöpfungstage, wie sie uns Moses vor Augen führt, als 24-Stunden-Tage auffassen. Als große Perioden müssen wir sie ansehen, als jene gewaltigen Zeiträume von Jahrmillionen, die die Wissenschaft in der Entwicklungsgeschichte der Erde als Primärzeit, Sekundärzeit usw. unterscheidet.
[S. 274]
Die Reihenfolge der mosaischen Schöpfungsgeschichte entspricht durchaus der wissenschaftlichen Forschung, die nachgewiesen hat, daß erst die Pflanzenwelt und dann die Tierwelt entstanden ist, und daß der Mensch, dessen Dasein kaum bis in die Tertiärzeit hineinreicht, den letzten Akt der fortschreitenden Entwicklung verkörpert. Er ist, dank seines hoch ausgebildeten Gehirns, dem eine wahrhaft göttliche seelische Kraft innewohnt, der Herr der Schöpfung, der, um mit Moses zu reden, über alles Tier, das auf Erden kriechet, herrschet.
Die biblische Schöpfungsgeschichte nimmt freilich die Erschaffung jedes einzelnen Lebewesens unabhängig von der Gesamtheit an; aber in der Zeitfolge, wie das Weltsystem mit dem Planeten „Erde“ und den ihn belebenden Organismen in Erscheinung tritt, offenbart sich bereits eine allmähliche Entwicklung nach denselben Grundsätzen, wie sie die Deszendenzlehre aufstellt. Hierin liegt eine gewaltige Tiefe und Größe der biblischen Weltanschauung, die zur heutigen Wissenschaft keineswegs, wie der Laie glaubt, im Widerspruch steht, sondern mit ihr in versöhnender Harmonie ausklingt.
Der geniale Israelit, der den Schöpfungsakt Gottes niederschrieb, hat freilich von der Größe seines Gedankenganges, von dessen wissenschaftlicher Bedeutung keine Vorstellung gehabt. Er hat seine Vorstellungen mit kindlichem Gemüt niedergelegt, aber mit einem Gemüt, das eine gewaltige Geistesgröße in sich birgt. —
Wir wissen heute, daß alle Erscheinungen in der Welt unabänderlichen Gesetzen unterliegen, jenen Gesetzen, die das Weltsystem schufen, die Werden und Vergehen in eiserner Gewalt halten. Die Gesetzmäßigkeit in der Welt, in unserem Dasein kann und braucht das religiöse Empfinden nicht zu ertöten. Die berühmte Ignorabimus-Rede von Du Bois-Reymond hat auch[S. 275] heute noch trotz allen wissenschaftlichen Fortschrittes ihre Gültigkeit. Selbst wenn es dem Forscher gelänge, die Urzelle künstlich herzustellen, das Leben auf physikalisch-chemischem Wege in der Retorte entstehen zu lassen, so bleibt das Fundament der Religion dennoch bestehen. Es bleibt immer wieder ein Letztes in Dunkel gehüllt, der Ursprung jener Kräfte, die imstande sind, ein Leben zu erzeugen. Mag der Freidenker diesen Ursprung „Stoff und Kraft“ nennen, mag der Gläubige hierin „Gott“ erblicken, im Grunde genommen ist es dasselbe — ein gewaltiges Etwas, das die Welt beherrscht, dessen Wesen unsere Sinne niemals erfassen können.
Spinozas wahrer Lehrsatz: „Nach großen, ehernen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreislauf vollenden“, so unerbittlich hart er auch erscheinen mag, steht nicht im Gegensatz zum ethischen Empfinden, nicht im Widerspruch zum religiösen Gefühl.
Der Mensch mit seinen hohen Geistesgaben ist das einzige Wesen, das die Begriffe der Moral und der Ethik kennt, die der Tierseele fremd sind. Das Tier folgt automatisch im Unterbewußtsein seinen jeweiligen Trieben, die sein Wesen gesetzmäßig beherrschen. Es kann daher niemals für seine Handlungsweise verantwortlich gemacht werden. Gut und Böse, Recht und Unrecht vermag kein Tier zu unterscheiden, geschweige denn zu ahnen. Die Erkenntnis dieser Begriffe füllt nur die Menschenseele aus und macht den Menschen erst zu dem, was er ist, — zum Menschen! Darum dürstet die Menschenseele nach Höherem als nach jenem, was die nüchterne Wissenschaft uns geben kann, darum behalten die herrlichen, tiefempfundenen Worte der Bergpredigt des schlichten Galiläers, der im Stall zu Bethlehem geboren wurde und einen harten Lebensweg wandelte, ebenso[S. 276] ihre Gültigkeit wie der Korintherbrief eines Paulus, der die Liebe als höchstes menschliches Gut preist. —
Charles Darwin trug kein Bedenken, die Entwicklungslehre letzten Endes auch auf den Menschen anzuwenden und dies in seinem epochemachenden Werke „Die Abstammung der Menschen“ frei und offen der Welt zu verkünden. Hiermit trat der Mensch in die Reihe der Tiere als deren naher Verwandter.
Wohl kaum ist ein Gedanke so falsch verstanden und bewertet worden wie die tierische Abstammung des Menschen. „Der Mensch stammt vom Affen ab“, heißt es im Volksmund. Ein wie törichter Gedanke! Wer kann mit seinem Ahnen zusammen leben, das schließt der Begriff der Abstammung von vornherein aus. Die gemeinsame Wurzel liegt weit, sehr weit zurück. Die Spaltung zwischen Mensch und Affe muß sehr früh vor sich gegangen sein, es kann nur ein Wesen in Betracht kommen, das in der Entwicklung tief unter den heutigen Affen gestanden hat, und das die Fähigkeit besaß, nach der einen Seite hin sich zum Baumtier, dem Affen, auszubilden und anderseits durch stete Entwicklung des Gehirns zum Menschen zu werden. Der Gedanke der tierischen Abstammung des Menschen ist durchaus nicht entwürdigend. Er zeigt uns die gewaltige Bedeutung der Entwicklung, die es fertiggebracht hat, den Menschengeist zu einer so hohen Stufe emporzutragen, die zwischen Tierseele und Menschenseele eine gewaltige Kluft aufgetan hat. Das Verständnis für Moral, Kunst und Wissenschaft ist das alleinige und höchste Gut der Menschenseele, das den Menschen wieder aus der Reihe der Tiere heraushebt und ihn zum gottähnlichen Wesen macht.
Die Entwicklung kennt keinen Stillstand, sie geht unaufhaltsam weiter. So eröffnet die Lehre von der Entwicklung des Menschen aus niedriger Form den Ausblick auf einen weiteren Fortschritt[S. 277] jenes Organs, das den Menschen zum Menschen gemacht hat, auf eine immer höher werdende Stufe des Geistes. Der Übermensch als vollendetes Wesen, dem kein Mangel des Geistes mehr anhaftet, dem Haß, Grausamkeit und Neid fremd sind, dessen Herz allein die reine Liebe für seine Mitmenschen und alle Geschöpfe beseelt, steht vor unserem geistigen Auge als vollkommenste Entwicklungsstufe, die vielleicht in Jahrmillionen einst erreicht wird. Wahrlich ein erhebender Gedanke, dem nichts Niedriges, sondern nur Hohes und Heiliges innewohnt.
Die Auffassung von der tierischen Herkunft des Menschen gibt uns durchaus nicht das Recht, unseren unlauteren Begierden, die tierischen Ursprungs sind, freien Lauf zu lassen, wie das ungebildete Volk wohl glaubt. Im Gegenteil, sie ist nur ein Grund mehr zur Selbstzucht und Selbstbeherrschung. Wir müssen uns unserer Geisteskraft, die wir der Entwicklung verdanken, würdig zeigen. Moral und Ethik muß unser Sinnen und Trachten ausfüllen. Wer anders denkt und dies nicht tut, entwürdigt sich selbst, verleugnet seine menschliche Natur und sinkt wieder zum Tier herab, was er einst gewesen ist. —
Dissidenten und Atheisten glauben die auf den Menschen angewandte Entwicklungslehre als Beweis anführen zu können, um die Unsterblichkeit der Menschenseele zu widerlegen. Der Begriff der Unsterblichkeit läßt sich weder wissenschaftlich beweisen, noch wissenschaftlich leugnen. Keine Kraft im Weltall geht verloren. Sie setzt sich nur um und tritt in anderer Erscheinung wieder auf. So mag auch die Geisteskraft des Menschen unsterblich sein, in welcher Form dies geschieht, entzieht sich unserer Erkenntnis, und kein kirchliches Dogma kann uns hierauf Antwort geben. Es bleibt Sache des Glaubens und des religiösen Empfindens, das dem Einzelnen überlassen ist. —
[S. 278]
Nach Darwins Lehre soll die Schutzfarbe der Tiere, wie die Sandfarbe der Wüstenbewohner, die leuchtende, bunte Färbung der Tropenfauna und das weiße Haar- und Federkleid der Bewohner der Eisregion, im Kampf ums Dasein durch natürliche Auslese entstanden sein. So einleuchtend diese Theorie auch klingt, so läßt sie sich nach den neuen Forschungen in ihrem vollen Umfange nicht mehr aufrecht halten.
Wir wissen heute, daß die Färbung der Tiere auch noch von anderen, rein äußerlichen Faktoren bedingt wird. Das Klima spielt hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Außerordentlich lehrreich für die Beurteilung der Farbenbildung sind die Versuche, welche Kammerer mit Reptilien gemacht hat. Es gelang ihm durch Erhöhung bzw. Erniedrigung der Außentemperatur die Färbung von Eidechsen zu verändern.
Die auf der Oberseite herrlich grün, unterwärts gelb gefärbte Smaragdeidechse (Lacerta viridis) bildet je nach Größe und mehr oder weniger lebhafter Färbung mehrere geographische Rassen. So fehlt der größten in Kleinasien und Syrien lebenden Form (Lacerta viridis major) die schöne blaue Kehlfärbung der südeuropäischen Smaragdeidechsen, die besonders die Männchen in der Brunstzeit ziert. Durch starke Temperaturerhöhung brachte Kammerer die blaue Farbe der südeuropäischen Rassetiere zum Verschwinden und erzielte hierdurch auf künstlichem Wege die Farbe der major-Rasse. Ebenso gelang es Kammerer durch Einwirkung hoher Temperatur bei weiblichen Mauereidechsen (Lacerta muralis) eine prächtigere Färbung, wie sie nur die Männchen haben, hervorzurufen. Es entstanden an den Seiten blaue Flecke und der Bauch färbte sich rot. Eine Erhöhung der Außentemperatur in Verbindung mit Feuchtigkeit erzeugt nach Kammerer vermehrte Pigmentbildung und infolgedessen ein Dunklerwerden[S. 279] der Färbung, während niedrige Temperatur und Trockenheit Pigmentschwund und infolgedessen Aufhellung hervorbringen. Bei einigen Eidechsen entstand sogar im ersteren Falle völliger Melanismus.
Ähnliche Beispiele wie bei den Eidechsen lassen sich auch aus der Insektenwelt anführen. Geographische Rassen von Schmetterlingen lassen sich künstlich erzeugen, je nachdem man die Puppen in kalter oder warmer Temperatur zur Entwicklung bringt. Im ersteren Falle erfolgt eine Aufhellung, im letzteren ein Dunklerwerden der Färbung.
Görnitz hat den Farbstoff der Vogelfedern physikalisch-experimentell untersucht und ist hier ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, daß Kälte den dunklen Farbstoff, die Melanine, zerstört, Wärme dagegen sie fördert. Der Kleiber Sitta europaea hat in Mitteleuropa einen schmutziggelben Bauch, in Ostpreußen, Polen und den Baltischen Ländern ist der Leib rahmfarben und in Skandinavien weiß gefärbt, so daß sich verschiedene geographische Unterarten abtrennen lassen. Der Jagdfalk Falco islandicus ist in den südlichen Ländern seines Verbreitungsgebiets dunkel, im hohen Norden dagegen fast rein weiß. Unabhängig von der Temperatur üben nach Görnitz auch Trockenheit und Feuchtigkeit einen Einfluß auf die Gefiederfarbe aus. Trockenheit schränkt die Pigmentbildung ein. Die dunkelsten Farbstoffe, das schwarze und braune Eumelanin wird zerstört, während das hellere, gelbliche Phäomelanin zunimmt. Die Haubenlerche, welche das trockene Wüstengebiet der Sahara bewohnt, zeigt auf dem Rücken eine hellrötlichgelbe Farbe, weil durch die Trockenheit das Eumelanin zerstört ist, und das Phäomelanin sich ausgebreitet hat. Dagegen ist die Haubenlerche, die im feuchten Nildelta lebt, die dunkelste Form, weil das Eumelanin durch die beständige[S. 280] Feuchtigkeit des Klimas, unabhängig von der Wärme, eine starke Vermehrung erfahren hat. Die Vögel, welche das afrikanische Küstengebiet bewohnen, sind infolge des feuchten ozeanischen Klimas im allgemeinen dunkler gefärbt als ihre Artgenossen im Innern des Festlandes. Der afrikanische Raubwürger hat im Küstengebiet einen dunkelgrauen Rücken, in der Sahara dagegen einen hellgrauen. Sehr interessant ist ferner die Erscheinung, daß bei den Zugvögeln, die im hohen Norden brüten, keine Aufhellung ihres Gefieders erfolgt ist, wie man vielleicht zunächst annehmen sollte. Bei eingehender Prüfung erklärt sich aber dieser scheinbare Widerspruch von selbst. Die Zugvögel brüten im Sommer, also in einer warmen Jahreszeit im Norden, verlassen diesen noch vor Beginn der Kälte, um im warmen Süden zu überwintern. Sie leben also niemals unter dem Einfluß einer sehr niedrigen Temperatur. So sehen wir denn, daß z. B. die Graugans im höchsten Norden ihres Verbreitungsgebiets nicht heller gefärbt ist als in südlichen Gegenden. Der Alpenstrandläufer der Arktis ist auf der Oberseite ebenso dunkel gefärbt wie die Brutvögel in Holland und an den deutschen Nord- und Ostseeküsten.
Außer den äußeren Einflüssen des Klimas scheint auch die Farbe der Umgebung, in der ein Tier lebt, eine gewisse Einwirkung auf die Pigmentbildung zu haben. Versuche, die nach dieser Richtung hin mit dem Feuersalamander ausgeführt wurden, ergaben, daß die gelbe Fleckenzeichnung auf dem Körper zunahm und sich allmählich mehr verbreitete, wenn die Tiere auf hellem Untergrunde gehalten wurden, daß anderseits die gelben Flecken sich verkleinerten und die schwarze Grundfarbe mehr hervortrat, wenn man die Versuchstiere auf dunkler Erde hielt. Diese Farbenveränderung trat jedoch nicht auf, wenn die Tiere des Augenlichts beraubt waren. Hieraus geht hervor, daß es sich[S. 281] um einen optischen Reiz handelt, der sich auf die Pigmentbildung überträgt.
Alle diese Forschungen, die aus neuerer Zeit vorliegen, eröffnen für die Beurteilung der Entstehung der Färbung der Tiere eine ganz neue Perspektive, die uns zwingt, die Dinge nach ganz anderen Gesichtspunkten zu beurteilen, als man es bisher getan hat, und Darwins genial ersonnene Lehre von der Entstehung der Arten durch natürliche Auslese im Kampf ums Dasein erhält hierdurch einen empfindlichen Stoß. Die Wüstenfarbe der Springmäuse, der Wüstenlerchen und vieler anderer Wüstentiere, die ein so vortreffliches Beispiel für die Mimikry und ihre Entstehung in Darwins Sinne zu sein schien, muß mit einem Male auf eine ganz andere Ursache zurückgeführt werden. Das physikalisch-chemische Experiment lehrt uns, daß ein Kampf ums Dasein und eine Auslese gar nicht notwendig sind, um diese verblüffende Anpassung hervorzurufen. Der grüne Laubfrosch braucht nicht durch Vertilgung der unzweckmäßigen Färbung herausgezüchtet zu sein, sondern er verdankt seine dem Aufenthaltsorte angepaßte Farbe vielleicht dem Einfluß klimatischer Faktoren oder dem Reiz des grünen Lichtes, das das Blätterwerk, in dem er zu Hause ist, auf seine Sehnerven ausübt.
So schreitet die Wissenschaft unaufhaltsam vorwärts. Das Bessere ist des Guten Feind; das Alte wird beiseite getan, neue Theorien werden aufgebaut, um vielleicht in späterer Zeit wieder durch neue Ergebnisse rastlosen Forschergeistes überholt zu werden. Trotzdem wäre es ein schweres Unrecht gegen die Wissenschaft, die Hypothese, die in ernster, gewissenhafter Arbeit geschaffen wurde, etwa verächtlich abzutun, wie es leider heute bisweilen geschieht. Mag eine frühere Anschauung ihre Gültigkeit verlieren, so bleibt ihr Wert, den sie der Wissenschaft geleistet hat, dennoch[S. 282] für alle Zeiten bestehen. Auch sie bedeutete einen Fortschritt in der Erkenntnis, denn sie hat zur Klärung des Ganzen im Suchen nach der Wahrheit beigetragen und bildet daher einen wichtigen Baustein im Gebäude der Wissenschaft.
Mag Darwins Lehre von der Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl auch der heutigen Wissenschaft nicht mehr in allem standhalten, so bleibt doch der Grundgedanke seiner Lehre, die Entstehung der Arten durch allmähliche Entwicklung und Umbildung bestehen.
Mag auch die Schutzfärbung nicht durch eine Auslese im Lebenskampf hervorgerufen sein, so behalten dennoch ihr Wesen und ihre Wirksamkeit Geltung. Die Tatsache, daß der Hase im Kleide der Erdscholle, die Fasanenhenne, die Waldschnepfe im dürrlaubfarbigen Gewande und die Wüstentiere im sandfarbigen Haar- und Federkleid der Umgebung vortrefflich angepaßt sind, bleibt bestehen. Die Mimikry verliert nicht ihre Bedeutung, auch wenn sie anderen Ursprungs ist, der mit einem beabsichtigten Schutz nichts zu tun hat. Das Kleid, das sich ganz unabhängig vom Kampf ums Dasein einzig unter dem Einfluß des Klimas und anderer äußerer Einwirkungen herausgebildet hat, ist dennoch eine Tracht geworden, die seinen Träger vor den Nachstellungen seiner Feinde schützt, da sie zur Umgebung paßt. Wir sehen, wie außerordentlich fein und sinnreich die Natur arbeitet, wie ihre großen, unabänderlichen Gesetze sich nicht in Einseitigkeit verlieren, sondern wie ein gewaltiger, zielbewußter Wille zweckmäßig arbeitet.
Erfüllt die Schutzfarbe wirklich ihren Zweck? Auch hiergegen hat man versucht, Einwände zu erheben. Man hält eine Schutzfärbung für unnötig, da viele Tiere, die dieses Vorteils entbehren, trotz[S. 283] aller Nachstellungen noch nicht ausgerottet sind. Dieser Einwand entbehrt aber einer zutreffenden Begründung. Von Natur sind alle Tiere mehr oder weniger durch ihre Färbung geschützt. Selbst die buntfarbigen Tiere, bei denen man nicht von Mimikry sprechen kann, entbehren des Schutzes nicht, da auch eine bunte Zeichnung, wie wir gesehen haben, durch die körperauflösende Wirkung der Somalyse das Tier unkenntlich macht.
Man hat ferner gegen den Wert der Schutzfarbe eingewendet, daß sie nur gegen Sicht, aber nicht gegen eine Wahrnehmung mit dem Geruchssinn schützt, der gerade bei den Raubtieren so gut entwickelt sein soll. Der Fuchs spürt mit Hilfe seines Geruchs die brütende Fasanenhenne, den in der Sasse sitzenden Hasen auf, und die Schutzfärbung verfehlt ihren Zweck. So einfach läßt sich die Sache aber nicht abtun.
Zunächst findet der Fuchs mit Hilfe des Geruchssinnes nur dasjenige Wild, welches sich, wie der Jäger sagt, unter Wind befindet, dessen Witterung ihm die Luftströmung zuträgt. In allen anderen Fällen wird Reineke sein Opfer meist nicht wahrnehmen, weil es durch die Schutzfarbe seinen Blicken entzogen wird. Hieraus geht schon hervor, daß die Mimikry durchaus nicht so bedeutungslos ist, wie die Gegner vermeinen, sondern sehr wohl ihren Zweck hat.
Der durch seine populären Tierschriften bekannte Schriftsteller Zell teilt die Tiere nach der Ausbildung ihrer Sinne ein und unterscheidet Nasen- und Augentiere, d. h. Tiere, die einseitig entweder den Geruchssinn oder das Gesicht zur Erfüllung ihrer Lebensaufgaben benutzen. Diese Anschauung kann einer ernsten Kritik nicht standhalten. Die meisten Tiere sind keineswegs einseitig im Gebrauch der Sinne veranlagt, und am allerwenigsten jene Tiere, auf die Zell seine Hypothese in der Hauptsache anwendet,[S. 284] wie unser Wild und das Raubzeug. Niemand wird bestreiten, daß bei Hirsch, Reh und Wildschwein der Geruch vorzüglich ausgebildet ist. Sie nehmen auf weite Entfernung von mehreren hundert Metern die Witterung des Menschen, die ihnen der Wind zuträgt, wahr, und hierin liegt zweifellos ein vortrefflicher Schutz gegen Gefahren. Wer aber das Verhalten dieser Tiere aufmerksam beobachtet, gewinnt bald die Ansicht, daß infolge des hochentwickelten Geruchs die anderen Sinne keineswegs verkümmert sind, wie Zell meint. Außerordentlich scharf, vielleicht ebenso scharf als der Geruch ist das Gehör dieser Tiere. Wittert ein Reh oder ein Stück Rotwild Gefahr, dann richtet es nicht nur den Windfang nach dem Winde, um sich von der Nähe eines Feindes zu überzeugen, sondern gebraucht ebenso das Gehör, wie man an der fortgesetzten Drehung der hochaufgerichteten Lauscher sehen kann. Das Wild unterscheidet mit tödlicher Sicherheit die feinsten Geräusche nach ihrem Ursprung. Rutscht ein Eichhörnchen am Stamm empor, raschelt eine Maus im dürren Laub, oder schleicht ein Fuchs über den Boden, so wirft das Wild vielleicht einen Augenblick den Kopf auf, nimmt aber sofort wahr, daß es sich um ein unverdächtiges Geräusch handelt und wird wieder vertraut. Ganz anders, wenn der pürschende Jäger ein nur leises, ähnliches Geräusch verursacht. Er vergrämt das Wild sofort — ein Beweis, daß es den Unterschied des Schalls, so gering er auch ist, sofort erkannt hat.
Auch das Gesicht ist beim Wilde keineswegs so schlecht ausgebildet, wie man meist vermutet. Es steht freilich dem Geruch und Gehör nach, ohne jedoch seine Bedeutung zu verlieren. Wenn der Jäger in unauffälliger, der Umgebung angepaßter Kleidung ganz still sich verhält, wird er bei gutem Winde nicht leicht vom Wilde bemerkt, auch wenn er ganz frei und ungedeckt steht. Die geringste[S. 285] Bewegung wird aber von dem Wilde sofort wahrgenommen. Man kann bekanntlich einen Rehbock auf freier Wiese oder im Felde bis auf nahe Entfernung anpürschen, wenn man sich langsam vorwärts bewegt, sobald dieser den Kopf unten hat und äst, aber sofort zur Bildsäule erstarrt, wenn er den Kopf hebt. Der Grund liegt darin, daß das Tier den stillstehenden Jäger nicht erkennt und auch nicht imstande ist, die Veränderung der Entfernung zu beurteilen. Diese Unachtsamkeit beruht weniger auf einer schlechten Sehkraft, als auf der geringfügigen geistigen Begabung. Das Tier macht sich die Bedeutung des auf die Netzhaut geworfenen Bildes nicht bewußt klar. Es fehlt die verstandesmäßige Überlegung, die bei uns das, was wir mit den Augen wahrnehmen, zum richtigen Bewußtsein und Verständnis kommen läßt.
Die optische Schärfe des Auges ist aber beim Reh- und Rotwild durchaus nicht gering. Selbst ein unauffälliges Augenzwinkern nimmt das Tier ohne weiteres wahr und quittiert die verdächtige Erscheinung durch eine sofortige Flucht, wie ich mich auf meinen Pürschgängen oft genug überzeugen konnte.
Beim Wildschwein ist die Sehkraft freilich recht gering. Trotzdem wäre es falsch, nach dem Muster von Zell von einem Nasentier zu reden, da neben dem Geruchssinn das Gehör in höchster Vollkommenheit ausgebildet ist.
Die Bedeutung des Geruchssinnes beim Raubwild, wie Fuchs und Marder, wird sehr überschätzt. Ich habe mich auf der Jagd oft genug darüber gewundert, wie die Nase des roten Freibeuters versagte. Mehrmals erlebte ich es gelegentlich des Rehbockanstandes, daß ein Fuchs in einer Entfernung von nur wenigen Schritten ganz vertraut an mir vorüberschnürte, ohne meine Nähe zu bemerken. Mit dem Geruchssinn des Fuchses scheint es also nicht weit her zu sein. Dieselbe Erfahrung machte auch in jüngster Zeit[S. 286] mein Freund Graf Otto Zedlitz an einem zahmen Fuchs, den er in Gefangenschaft hielt. Graf Zedlitz, der um die Erforschung der afrikanischen Vogelwelt so verdiente Gelehrte und ausgezeichnete Tierbeobachter, teilte mir mit, daß er immer wieder zu seinem Erstaunen erfahren könne, wie wenig sein Fuchs vom Geruchssinn Gebrauch macht, und daß er sich ganz und gar vom Gehör und Gesicht leiten läßt.
Dieselbe Erfahrung machte ich an einem Steinmarder und an einem Edelmarder, die ich als junge Tiere erhielt und die lange Zeit meine Zimmergenossen waren. Sie waren nicht imstande, ein Stück rohen Fleisches, das ich unter einem leinenen Tuche versteckt hatte, mit dem Geruchssinn aufzufinden. Sie liefen über das Tuch hinweg, ohne den verborgenen Leckerbissen zu bemerken. Dagegen war bei ihnen das Gehör außerordentlich fein ausgebildet. Ich konnte sie in kurzer Zeit daran gewöhnen, auf ein ganz leises Knacken mit dem Fingernagel herbeizukommen, um Leckerbissen in Empfang zu nehmen.
Die Ansicht, daß die Mimikry des Hasen, des Rebhuhnes, der brütenden Lerche und vieler anderer Tiere kein Schutzmittel gegen die Angriffe des Raubzeugs sei, weil es hauptsächlich mit der Nase arbeitet, ist also durchaus hinfällig.
Jede Schutzfärbung, sowohl die Mimikry wie die Somalyse, kommen natürlich nur dann zur Geltung, solange das betreffende Tier sich völlig ruhig verhält, da die Bewegung die Wirkung der Anpassung aufhebt und das Tier verrät. Infolgedessen verhalten auch alle Tiere, die eine ausgesprochene Schutzfarbe besitzen, sich völlig ruhig, sobald sie glauben, sich nicht mehr rechtzeitig durch Flucht in Sicherheit bringen zu können. Aus diesem Grunde liegen die Rebhühner fest vor dem vorstehenden Hunde. Sie „halten“, wie der Jäger sagt. Der Hase bleibt bei plötzlicher Annäherung[S. 287] des Menschen häufig so fest in der Sasse liegen, daß man geradezu auf ihn treten kann. Das Tier hat dabei offenbar das Gefühl, daß es übersehen wird und dadurch der Gefahr am besten entgeht, jedenfalls viel besser, als wenn es zur Flucht sich erheben würde und dann leicht von seinem Verfolger ergriffen werden könnte. Dieser Instinkt, sich unsichtbar zu machen, wird sich erst im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Für seine Entstehung gibt es aber wohl kaum eine bessere Erklärung als die Theorie Darwins von der Einwirkung der Auslese im Kampf ums Dasein. So sehen wir, daß Darwins Lehre trotz der neuen Erklärung von der Entstehung der Farben durch Klima und optische Reize ihre Gültigkeit nicht ganz verloren hat.
Die Mittel, mit denen die Natur ihre Geschöpfe bildet und formt, sind überaus mannigfaltig und vielseitiger, als wir heute wissen und ahnen. —
Eine vielumstrittene Frage auf dem Gebiet der Mimikry ist die Färbung des Kuckuckseies. Das Kuckucksei variiert bekanntlich außerordentlich und zeigt den Typus der Eier zahlreicher Singvögel. Es gibt rein blaugrüne Kuckuckseier, die den Eiern des Gartenrotschwanzes völlig gleichen. Liegt ein solches Kuckucksei in einem Rotschwanznest, dann ist es von den Rotschwanzeiern äußerlich gar nicht zu unterscheiden. Andere Kuckuckseier gleichen den Eiern der Würger, Grasmücken, Fliegenfänger, Pieper und Stelzen in auffallendster Weise. Freilich liegen die Kuckuckseier nicht immer in Nestern mit entsprechend gefärbten Eiern, sondern häufig auch in solchen Gelegen, zu denen sie in der Farbe nicht passen. Trotzdem läßt sich die Mimikry des Kuckuckseies nicht verleugnen. In manchen Gegenden herrscht ein bestimmter Eityp vor, und der Kuckuck benutzt dann fast ausschließlich solche Vogelnester für seinen Brutparasitismus, zu deren Gelege sein Ei paßt. So[S. 288] sind die Kuckuckseier in Finnland vorzugsweise einfarbig blau und liegen fast immer in den Nestern des dortigen Gartenrotschwanzes. Die auffallendste Übereinstimmung zwischen Kuckucksei und Nesteiern finden wir in Japan, wo sich der Kuckuck die Schwarzkehlammer (Emberiza ciopsis) zur Bebrütung seines Eies ausgewählt hat. Geradezu verblüffend ist die Ähnlichkeit des Kuckuckseies mit den Eiern dieser Ammer. Sie sind beide auf weißlichem Grunde dunkelgefleckt, und die Fleckung bildet am stumpfen Eiende einen aus Schnörkeln gewundenen Kranz. Diese Anpassung steht einzig da und kann unmöglich eine reine Laune des Zufalls sein, sondern muß gesetzmäßig hervorgerufen sein. Hier würde die Auslese im Sinne Darwins zweifellos die beste und einzig mögliche Erklärung sein, wenn eine solche Auslese tatsächlich durch die Wirtsvögel bewirkt würde. Nimmt man an, daß die Ammern alle unähnlichen Kuckuckseier stets entfernt haben, so würde durch die Auslese im Laufe der Zeit ein Kuckucksstamm herangezüchtet sein, dessen Eier den Ammereiern gleichen. Hiermit wäre das Geheimnis der Anpassung aufgedeckt. So einfach liegt die Sache aber nicht. In meiner Schrift „Das Leben der Vögel“ habe ich darauf hingewiesen, daß die Singvögel keineswegs immer fremde Eier aus ihren Nestern entfernen, sondern sie sehr oft, auch wenn sie auffallend verschieden sind, annehmen und erbrüten. Es ist also sehr zweifelhaft, ob eine Auslese wirklich in der Natur stattfindet, und ob sie so groß ist, daß eine Mimikry zustande kommen kann. Wenn trotzdem eine Anpassung, und sogar eine geradezu verblüffend große Anpassung vorhanden ist, so legt dies den Gedanken nahe, daß es sich hier um ein uns noch unbekanntes Naturgesetz handeln muß, das zu erforschen der Wissenschaft noch vorbehalten ist.
[S. 289]
Noch vieles im Leben der Tiere ist in Dunkel gehüllt. Der geheimnisvolle Zauber, der über den Erscheinungen des Tierlebens liegt, übt immer wieder auf den Forscher wie auf den Laien eine gewaltige Anziehungskraft aus, die den, der von diesem Bann ergriffen ist, in unlösbare Fesseln schmiedet und ihm als höchstes Ideal vor Augen führt, die Wunder der Natur zu ergründen.
[5] Friedrich von Lucanus, Schutzfärbungen und Nutztrachten, Journal für Ornithologie 1902.
[S. 290]
Ein herrlicher Sommertag lockt uns in die freie Natur. Wir wandern am Waldesrand entlang. Drossel- und Amselschlag erquickt unser Herz und Gemüt. Vom nahen Felde her dringen die jauchzenden, wirbelnden Triller der Lerche an unser Ohr. Wir lassen uns am Grabenrand unter einer Dornenhecke nieder, um ein Weilchen auszuruhen und die Stimmung der Natur in vollen Zügen zu genießen. Doch was ist das? Vor uns flattert auf dem Erdboden ein kleines, graues Vögelchen, anscheinend krank und flügellahm. Wir wollen das Tier ergreifen, um es mit nach Haus zu nehmen und es zu pflegen, bis wir es gesundet der Freiheit zurückgeben können. Der arme Wicht läßt sich aber nicht so leicht fangen, wie wir glaubten. Er flattert mühsam vor uns her, und jedesmal, wenn wir mit der Hand zufassen, entgleitet er unseren Nachstellungen. In der Verfolgung entfernen wir uns immer weiter von unserem Platz, da erhebt sich der Vogel, der eben noch so matt und krank erschien, hoch in die Luft und verschwindet unseren Blicken. Es war eine Grasmücke, die in dem Dornbusch, unter dessen Schatten wir ruhten, ihr Nest mit Jungen hat. Der Vogel war nicht krank, er stellte sich nur flügellahm, um in der Sorge für das Leben seiner Kinderschar unsere Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und durch die geschickten Verstellungskünste uns von dem Nistplatz fortzuführen.
Diese Verstellungskünste zum Schutze der Jungen vollführen außer den Grasmücken auch viele andere Vögel, nachdem sie vorher ihre Jungen durch einen Warnruf zur Ruhe gemahnt haben.[S. 291] Ich habe es einst im Harz bei einer Auerhenne beobachtet, und neuerdings ist dasselbe auch bei Wildtauben festgestellt worden.
Die Kunst, den Feind durch List zu täuschen, wird hauptsächlich von solchen Vögeln angewendet, die zu schwach sind, ihre Brut zu verteidigen, während wehrhafte Vögel, wie Raubvögel, Störche und Reiher in solchen Fällen dem Feinde mutig zu Leibe gehen.
Andere Tiere üben solche Verstellungskünste zu ihrer eigenen Sicherheit aus. Die Eulen machen sich bei Gefahr ganz dünn, indem sie den Körper hochrecken und das Gefieder eng anlegen, so daß sie dann nicht mehr in ihrer Gestalt als Vogel zu erkennen sind, sondern einem dürren Ast gleichen und übersehen werden.
Die Rohrdommel sucht einer Gefahr dadurch zu entgehen, daß sie ihren Körper und Hals senkrecht in die Höhe streckt, so daß sie einem Pfahl oder einem Rohrhalm gleicht und auf diese Weise in dem dichten Röhricht verschwindet.
Der Ziegenmelker, der seinen abenteuerlichen Namen nach dem Volksglauben führt, daß er nachts in die Stallungen fliegt, um den Ziegen Milch zu rauben, was natürlich ein Märchen ist, setzt sich zur Ruhe nicht quer auf einen Ast, wie es alle anderen Vögel tun, sondern der Länge nach. Er gleicht dann dem Auswuchs eines knorrigen Baumastes und wird von seinen Feinden nicht so leicht erkannt.
Bei diesen Verstellungskünsten kommt der Eule, der Rohrdommel und dem Ziegenmelker noch die düstere, unscheinbare Färbung des Gefieders zugute, welche die Wirkung der Täuschung noch erhöht.
Der geängstigte Steinkauz macht fortgesetzt Verbeugungen, indem er seinen Körper auf und nieder schnellt. Im Halbdunkel einer Baumhöhle bewegen sich dann die leuchtendgelben, großen[S. 292] Augen rasch hin und her, wodurch vielleicht der Marder oder das Wiesel, wenn sie den harmlosen Kauz in seinem Versteck überfallen wollen, sich abschrecken lassen.
Unter den Säugetieren nehmen die Flughunde eine Schutzstellung ein, die sie als Tiere unkenntlich macht. Sie hängen sich mit den Hinterfüßen an einem wagerechten Ast auf und lassen den Körper mit engangelegten vorderen Gliedmaßen herabhängen. Hierdurch gewinnen sie das Aussehen einer am Baume herunterhängenden Frucht. Dieser Eindruck wird noch dadurch vervollkommnet, daß die gesellig lebenden Tiere in großer Anzahl nebeneinander hängen, so daß ein Schlafbaum der Flughunde wie ein mit Früchten reichbesetzter Strauch aussieht.
Der auf den Sundainseln lebende Pelzflatterer oder Kaguang (Galeopithecus volans) hängt sich beim Schlafen mit allen vier Füßen an einem Zweig auf und sieht mit seinem braunen, weiß gesprenkelten Fell wie ein Auswuchs am Ast aus. Der Kaguang gehört mit Spitzmaus, Igel und Maulwurf zur Ordnung der „Insektenfresser“. Eine zwischen den Vorder- und Hinterfüßen ausgespannte Flughaut dient dem Tier als Fallschirm bei seinen Sprüngen durch die Luft.
Auch einige Amphibien und Reptilien wenden Schreckmittel an, um sich zu verteidigen. Die Natur hat ihnen besondere Vorrichtungen verliehen, ihren Körper plötzlich zu verunstalten und dadurch den Feind abzuschrecken. Der in Südamerika lebende braunfleckige Sumpffrosch aus der Gattung Paludicola und der afrikanische Kurzkopffrosch (Breviceps mossambicus) können ihren Körper mit Luft so stark aufblasen, daß er zu einer großen Kugel wird, wodurch froschfressende Tiere abgeschreckt werden.
Auch die Chamäleons blasen bei Gefahr ihren Körper auf, der hierdurch eine dicke und pralle Gestalt erhält, die keine Angriffsflächen[S. 293] bietet, so daß die Bisse des Gegners leicht abgleiten. Außerdem nimmt das Tier durch Aufblasen des Kehlsacks und der Hautlappen, die manche Arten an den Kopfseiten tragen, ein absonderliches, abschreckendes Aussehen an. Das Aufblasen des Körpers geschieht vermittels der Lungen, die zahlreiche, schlauchartige Fortsätze haben, die sogar bis zu den Eingeweiden reichen und mit Luft gefüllt werden können. Diese „Blindsäcke“ der Chamäleons sind eine ähnliche Vorrichtung wie die „Luftsäcke“ der Vögel, welche im ganzen Körper verteilt unter der Haut liegen und ebenfalls mit den Lungen in Verbindung stehen. Es tritt hier unverkennbar die nahe Verwandtschaft der Vögel mit den Kriechtieren hervor, die die Abstammungslehre als die Ahnen der Vögel ansieht. Der Kehlsack des Chamäleons steht mit der Luftröhre, die Hautlappen des Kopfes mit den Eustachischen Röhren in Verbindung und werden von hier aus mit Luft gefüllt. Genau dasselbe zeigt auch das pneumatische System der Vögel. Die unter der Schädelhaut befindlichen Luftsäcke sind in der Regel gleichfalls an die Eustachische Röhre angeschlossen und hängen nur bei wenigen Arten mit den Lungen und Bronchien zusammen. Auch bei den Anolis dient das Aufblasen des Kehlsacks als Schreckmittel (Abbildung 24).
Die wegen ihres gefährlichen Bisses so gefürchtete indische Brillenschlange, die Kobra der Schlangenbeschwörer und Zaubrer, kann die vorderen acht Rippen ihres Leibes seitlich abspreizen, wodurch der hinter dem Kopf befindliche Körperteil die Form eines großen, breiten Schildes erhält. Die Schlange nimmt diese Stellung nur ein, wenn sie gereizt oder bedroht wird, und richtet sich hierbei senkrecht in die Höhe. Der zum Schild erweiterte Hals schützt den kleinen Kopf des Tieres und wirkt auch abschreckend auf den Feind ein. Die Brillenschlange führt ihren Namen nach[S. 294] der sonderbaren Brillenzeichnung auf der Oberseite des Halses, die bei entfaltetem Schild besonders zur Geltung kommt. Andere Schlangen, wie die afrikanischen Baumschlangen der Gattungen Dispholidus und Thelotornis, blähen den Hals ballonartig auf, um ihre Feinde abzuschrecken und einzuschüchtern. Bei der grauen Baumschlange Afrikas wird der gespensterhafte Eindruck des aufgeblasenen Halses noch dadurch erhöht, daß die teils schwarz, teils weiß gefärbte Haut zwischen den Schuppen, die in der Ruhe nicht sichtbar ist, beim Aufblasen des Halses stark hervortritt. Das Tier, welches die Schlange ergreifen will, sieht dann plötzlich anstatt des unscheinbar grau gefärbten Reptils einen schwarzweiß leuchtenden Ballon vor sich, erschrickt und ergreift die Flucht.
Die australische Kragenechse (Chlamydosaurus kingi) trägt einen 15 cm breiten Halskragen, der in der unteren Hälfte mosaikartig orange, rot, blau und braun gefärbt ist. Der Kragen kann wie ein Regenschirm zusammengelegt und aufgespannt werden (Abbildung 25). Die mit dem langen Schwanz 80 cm messende, braun und schwarz gezeichnete Echse ist sehr erregbar und spannt, wenn sie erschreckt wird, sofort den Schirm auf, wobei sie stets den Vorderkörper aufrichtet. Der Kragen dient sowohl als Schild beim Abwehrkampf, den die mutige Echse tapfer aufnimmt, wie als Schreckmittel, wobei wieder die bunte Färbung große Bedeutung hat. Die Entfaltung des Kragens erfolgt durch die in ihn hineinreichenden, sehr langen Zungenbeinhörner. Die Eidechse hat die sonderbare Gewohnheit, bisweilen in aufrechter Haltung auf den Hinterfüßen zu laufen, wobei der Schwanz als Stütze dient.
Die Unken nehmen auf dem Lande, wenn sie sich bedroht fühlen, eine ganz eigenartige Abwehrstellung ein. Sie biegen Hals und Kopf rückwärts und verschränken die Vorderfüße auf dem gekrümmten Rücken. Hierdurch treten die gelbgefärbte Unterseite[S. 295] und die hellen Fußflächen hervor, und das Tier erhält ein ganz anderes Aussehen, das eher einem verschrumpften, dürren Blatt als einem Tier ähnelt. In dieser Stellung verharrt die Unke regungslos, bis die Gefahr vorüber ist.
Manche Fische haben auf den Flossen, an den Kiemen oder in der Augengegend lange Stacheln, die willkürlich angelegt und aufgerichtet werden können. Bei Gefahr spreizt der Fisch die Stacheln und schreckt durch das so plötzlich veränderte und drohende Aussehen seinen Gegner ab. Diese Stacheln finden sich besonders bei den Barschen, beim Zander und anderen „Stachelflossern“ sowie beim Stichling. Mag dies Abwehrmittel auch in vielen Fällen erfolgreich sein, so nützt es doch nicht immer, denn gerade der Stichling wird trotz seiner wehrhaften Stacheln auf dem Rücken von größeren Raubfischen verschlungen.
Bei einigen Fischen sind die Stacheln nicht nur ein harmloses Abschreckmittel, sondern in der Tat sehr gefährlich. Sie sind giftig. An ihrem Grunde liegt eine Giftdrüse. Das Gift fließt, ähnlich wie bei den Giftzähnen der Schlangen, in einer Rille durch den Stachel in die Wunde des Gegners und tötet diesen sehr schnell. In der Nordsee gibt es zwei giftige Fischarten, das Petermännchen (Trachinus draco) und die Viperqueise (Trachinus vipera). Beide Fische vergraben sich gern in den Grund, um auf Nahrung zu lauern. Die Rückenflosse, deren Stacheln die Giftdrüsen tragen, ragen etwas heraus. Fühlt sich der Fisch bedroht, so richtet er die Giftstacheln dem Angreifer entgegen. Hierbei wird die schwarze Flosse fächerartig ausgebreitet. Sie bildet gewissermaßen ein Warnsignal vor der drohenden Gefahr der Giftstacheln. Durch Versuche wurde festgestellt, daß das Gift kleinere Tiere, wie Ratten und Meerschweinchen, je nach der Stärke der Dosis in einer oder mehreren Stunden tötet. Für den Menschen ist das Gift[S. 296] zwar nicht lebensgefährlich, ruft aber starke Entzündungen, heftige Schmerzen, unter Umständen sogar Erstickungsanfälle und Bewußtlosigkeit hervor.
Der Knurrhahn (Trigla gurnandus) breitet, wenn er erschreckt wird, seine großen buntfarbigen Brustflossen fächerförmig aus, was den Angreifer in Erstaunen setzt und seine Raublust unterdrückt. Der Knurrhahn lebt in der Nordsee und hat noch eine besondere Eigentümlichkeit. Er besitzt auf jeder Seite vor der Brustflosse drei lange, freie und bewegliche Strahlen, die er regelrecht als Füße benutzt. Mit Hilfe der Strahlen läuft der Fisch auf dem Grunde umher, indem er sich dabei auf den Schwanz stützt. Der Knurrhahn hat einen sehr großen, vierkantigen Kopf mit weit vorspringender Schnauze. Die allgemeine Annahme, daß die Fische stumm sind, wird durch den Knurrhahn widerlegt. Er kann freilich keinen Stimmlaut hervorbringen und ist insofern stumm wie alle Fische, aber er besitzt in den Kiemendeckelknochen ein Instrument zur Erzeugung von Tönen. Durch ein Aneinanderreiben der Knochen wird ein knurrender Laut hervorgerufen, den der Fisch stets hören läßt, wenn er aus dem Wasser genommen wird.
Eine höchst merkwürdige Verstellungskunst treiben die Kugelfische, welche die Meeresküsten und Flüsse warmer Gebiete bewohnen. Bei Gefahr füllen sie ihren weitwandigen Magen mit Luft an und blasen hierdurch ihren Körper zu einer dicken Kugel auf (Abbildung 26). Durch die Luftansammlung wird das spezifische Gewicht geringer. Der Fisch steigt daher zur Oberfläche des Wassers herauf und läßt sich hier auf dem Rücken liegend treiben. Der Gegner schnappt vergeblich nach der großen Kugel, die keinen Angriffspunkt bietet, und gibt schließlich die Verfolgung auf. Beim Igelfisch (Diodon hystrix), der in allen tropischen Meeren verbreitet ist, ist die schuppenlose Haut mit einem Stachelkleid umgeben,[S. 297] das den Schutz noch erhöht. Der aufgeblasene Fisch wird ebenso wie der zusammengerollte Igel zur Stachelkugel.
Sogar die Tarnkappe wird unter den Verstellungskünsten der Tiere angewandt. Die Tintenfische machen sich unsichtbar, wenn sie verfolgt werden. Sie haben in ihrem Leibe am Ausgange des Enddarms einen Beutel, der mit schwarzbrauner Flüssigkeit gefüllt ist, den sogenannten Tintensack. Das Tier kann den Inhalt willkürlich aus dem After entleeren und hüllt sich dadurch in eine schwarze Wolke ein, die es den Blicken seiner Feinde entzieht. Der Name „Tintenfisch“ ist recht unglücklich gewählt, denn das Tier gehört nicht zu den Fischen, sondern zu den Weichtieren, unter denen es die höchste Entwicklungsstufe erreicht hat. Die Tintenfische bilden die Klasse der Kopffüßler (Cephalopoda), die durch lange Fangarme am Kopf ausgezeichnet sind. Diese sind an der Innenseite mit Saugnäpfchen besetzt, welche den Zweck haben, Beutetiere zu ergreifen und festzuhalten, ferner die Fortbewegung durch Kriechen zu vermitteln und sich an Gegenständen festzuklammern. Das Sekret der Tintenfische spielt bekanntlich in der Malerei als „chinesische Tusche“ oder „Sepia“ eine große Rolle.
Die Tintenfische der Tiefsee sondern anstatt der schwarzen Flüssigkeit, die in der Finsternis der Meerestiefe nicht zur Geltung kommen würde, ein grünlich leuchtendes Sekret aus ihren Leuchtorganen ab, das als Leuchtkugeln und leuchtende Fäden sich im Wasser verbreitet und den Feind irreführt. Da viele Tiere der lichtarmen Tiefsee mit Leuchtorganen ausgestattet sind, so verfolgt der Angreifer den Lichtschein, in der Meinung, daß er von dem Tierkörper selbst ausgestrahlt würde, und der Tintenfisch kann sich unterdessen in Sicherheit bringen.
Viele Insekten, besonders Käfer, haben die Gewohnheit, bei drohender Gefahr sich von der Blüte oder dem Blatt, auf dem[S. 298] sie sitzen, herabfallen zu lassen und dann mit angezogenen Beinen und Fühlern sich völlig regungslos zu verhalten. Sie stellen sich tot und entgehen dadurch der Gefahr. Dies Schutzmittel ist besonders wirksam, wenn die Tiere ins Gras oder zwischen dürre Blätter fallen und hier gänzlich verschwinden.
Beruhen die mannigfachen Verstellungskünste, die die Tiere ausführen, auf Verstand und Überlegung? Diese Frage müssen wir nach dem Stande der modernen Tierpsychologie verneinen. Wie schon an anderer Stelle erläutert wurde, beruhen die Handlungen der Tiere, die zu ihrem Lebensunterhalt notwendig sind, auf angeborenen Trieben, die ganz reflektorisch und maschinenmäßig ausgeführt werden. Der Biber errichtet seine kunstvollen Wasserbauten und der Vogel sein zierliches Nest, ohne einer Anleitung oder Unterweisung in der Technik der Baukunst zu bedürfen. Die Ausführung dieser Arbeiten ist eine angeborene Eigenschaft, die ganz automatisch sich auswirkt. So dürfen wir auch mit Recht annehmen, daß die Verstellungskünste der Tiere nicht auf individueller Erfindungsgabe und Intelligenz beruhen, sondern ebenfalls angeborene, automatische Triebhandlungen sind. Es sind nur Reaktionen auf äußere Reize, hervorgerufen durch plötzlichen Schreck und Furcht. Das Sichtotstellen des Käfers ist weiter nichts als eine plötzliche Nervenlähmung, die eine Zeitlang anhält. Auch das Vortäuschen der Flügellahmheit einer geängstigten Vogelmutter, die Pfahlstellung der Rohrdommel, das Aufblasen des Kehlsacks beim Chamäleon und Anoli sind rein reflektorische Auswirkungen des Nervensystems. Daß nicht individuelle Einsichtshandlungen vorliegen, sondern daß es sich nur um angeborene Triebhandlungen handelt, geht am besten daraus hervor, daß alle diese Tiere gleicher Art ihre Schreckstellungen und Gebärden stets in ganz gleicher Weise und immer unter denselben[S. 299] Bedingungen und Voraussetzungen ausführen, und daß wir ein ähnliches Verhalten bei anderen Tieren vermissen, deren Verkehrsformen die Schauspielerkunst fehlt.
Der Ausspruch in Goethes Faust:
hat in diesem Falle volle Gültigkeit. Der Dresseur ist die Natur, die den Tieren diese höchst zweckmäßige Handlungsweise mit auf den Lebensweg gab.
[S. 300]
Wir wandern im Sommer bei herrlichem Sonnenschein durch ein grünes Wiesental. Zahlreiche Schmetterlinge umgaukeln mit leichtem Flug die Blumen, die in dem saftigen Grün ihre weiß, blau oder rosa gefärbten Kelche emporstrecken. Bienen und andere Insekten schwirren durch die Luft, Heupferdchen und Grillen zirpen ihr eintöniges, aber doch liebliches Lied. In inniger Harmonie leben all diese leichtbeschwingten, zierlichen Wesen zusammen, deckt doch die Allmutter Natur ihnen den Tisch so reichlich, daß Neid und Streit hier keinen Raum haben. Das blühende Gras, die endlose Fülle der Blumen spenden ihnen allen Nahrung im Überfluß, und hierin allein liegt der Grund zu dem zahlreichen Auftreten der Insektenwelt. Nicht Nächstenliebe und Freude an der Geselligkeit haben die bunten Schmetterlinge zusammengeschart, sondern die überaus günstigen Lebensbedingungen lockten sie herbei. Jedoch kümmern sich die einzelnen Tiere wenig oder gar nicht umeinander. Ähnliches finden wir auch bei anderen Tieren. An sonnigen Berghängen tritt die kleine, behende Bergeidechse häufig sehr zahlreich auf, die Sümpfe und Teiche wimmeln von Fröschen, und in düsteren Waldungen belebt nach dem Regen der gelbgefleckte Feuersalamander in Mengen die Wege. Auch hier sind es die Lebensbedingungen im Verein mit einer ergiebigen Fortpflanzung, die die Tiere auf einen verhältnismäßig kleinen Raum zusammendrängen,[S. 301] ohne daß es berechtigt erscheint, von einem Geselligkeitstrieb zu sprechen. Die Tiere haben von ihrem innigen Zusammenleben keinerlei Vorteil. —
Unser Weg führt uns weiter in einen Eichenwald, aber welch trauriger Anblick. Von dem Grün der Blätter ist fast nichts mehr zu sehen. Entlaubt recken die Eichen, dies Urbild stolzen Germanentums, ihre Wipfel zum Himmel empor. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners, die in Millionen und Myriaden hier hausten, haben das traurige Werk vollbracht. Hier hat ein soziales Leben der Insektenwelt in geradezu schrecklicher Weise gewütet.
Das Massenauftreten der Raupen beruht zunächst auf einer überreichen Vermehrung dieses schädlichen Insekts. Aber die enge Gemeinschaft der Raupen wird nicht allein hierdurch bedingt, sondern hier handelt es sich um ein wirklich soziales Leben. Die Raupen vereinigen sich zu großen Gesellschaften. Die enge Gemeinschaft mit ihresgleichen scheint den Tieren geradezu Lebensnotwendigkeit zu sein. Versuche mit gefangenen Raupen ergaben, daß die isolierten Tiere, selbst dann, wenn sie reichlich mit Nahrung versehen waren, immer das Bestreben hatten, sich zu vereinigen, und daß sie dies sofort taten, sobald sie nicht mehr daran gehindert wurden. Ein objektiver Nutzen aus diesem sozialen Leben scheint jedoch nicht vorhanden zu sein, wenigstens läßt er sich nicht erkennen, im Gegenteil, für die Ernährung ist eine Vereinigung in großen Massen ja nur unvorteilhaft. Es kann also nur ein stark ausgeprägter Geselligkeitstrieb sein, der die Tiere zusammenschart.
Der Geselligkeitstrieb äußert sich bei den Raupen in verschiedener Weise. Bei manchen Arten tritt er nur zeitweise auf. So leben z. B. die Raupen des Ringelspinners (Malacosoma neustria), die in Obstkulturen großen Schaden anrichten, nur bis[S. 302] zu ihrer letzten Häutung gesellig, dann aber zerstreuen sie sich als Einzelgänger. Die Raupen des Mondvogels (Phalera bucephala) geben ihr Gesellschaftsleben vor der Verpuppung auf, während bei anderen Raupen der Geselligkeitstrieb überhaupt nicht erlischt. Letzteres ist beim Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) der Fall. Die Raupen, die durch ihren Kahlfraß in Eichenbeständen wahre Verwüstungen anrichten, verpuppen sich in gemeinsamen Nestern. Außer ihrer großen Schädlichkeit hat die Raupe des Eichenprozessionsspinners noch eine andere, sehr unangenehme Eigenschaft. Sie ist giftig. Zwischen den langen Haaren stehen noch winzig kleine Härchen, die sehr lose sitzen und schon bei der geringsten Berührung abfallen, ja sogar vom Winde abgestoßen und fortgetragen werden. Diese Haare sind giftig und erzeugen auf der Haut eine Entzündung mit starkem Juckreiz. Der Besuch eines von diesen Raupen heimgesuchten Eichenwaldes kann daher sehr böse und unangenehme Folgen haben, da die Gifthaare durch den Wind leicht in die Augen und Atmungsorgane geweht werden.
Eine andere, nicht leicht zu beantwortende Frage ist die, auf welche Weise die Raupen bei ihrem Gesellschaftsleben sich zusammenfinden. Die Raupen haben Geruch, Sehvermögen, Geschmack, Gefühl für Temperatur und Tastsinn, jedoch kein Gehör. Für die Bildung von Gesellschaften können von diesen Sinnen nur der Geruch, das Gesicht und der Tastsinn in Frage kommen. Der Geruch ist nur sehr gering ausgebildet, ja man kann sagen fast verkümmert, so daß also ein gegenseitiges Spüren nicht möglich ist. Mit den Augen vermögen die Raupen nur sehr nahe Gegenstände, die kaum weiter als 1 cm entfernt sind, zu erkennen. Der Sinn des Gesichts kann also die Tiere ebensowenig leiten. So bleibt nur der Tastsinn übrig, der bei den Raupen außerordentlich[S. 303] fein ausgebildet ist und seinen Sitz nicht nur in den Tastern hat, sondern über den ganzen Körper verteilt ist. Besonders die Haare der behaarten Raupen sind fein organisierte Taster. Ihre Berührung löst je nach der Körperstelle eine verschiedene Wirkung aus. Während eine leichte Berührung der Tasthaare am hinteren Leibesende die Vorwärtsbewegung beschleunigt, wird die Bewegung durch ein Berühren der Haare am vorderen Körper gehemmt. Ein starker Reiz veranlaßt die Raupe, sich zusammenzurollen. Sehr empfindlich sind die Raupen des Kiefernprozessionsspinners (Thaumetopoea pinivora). Bläst man sie mit dem Munde an, so löst dies einen starken, unangenehmen Reiz auf sie aus. Sie speien ihren Kropfinhalt aus, der als grüner Tropfen aus dem Munde tritt, und biegen den Vorderleib rückwärts. Werden die Raupen aber durch einen heftigen Windstoß erschüttert, so reagieren sie nicht darauf, sondern verhalten sich völlig teilnahmslos. Die Raupen vermögen also mit ihrem Tastgefühl sehr feine Unterschiede wahrzunehmen. „Das Tastgefühl“, sagt Deegener, der sich um die Biologie der Raupen sehr verdient gemacht hat, „scheint der Raupe alle Daten zu verschaffen, deren sie bedarf, um den sozialen Zusammenhang aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen.“
Die Raupen hinterlassen auf dem Wege, den sie zurücklegen, einen Seidenfaden. Dieser Faden dient offenbar zur Orientierung für andere Raupen, denn sie folgen ihm mit Vorliebe, wobei wiederum das Tastgefühl als Vermittlerin dient. Mit dem Tastgefühl nimmt die Raupe den Seidenfaden einer Genossin wahr. So bilden zweifellos diese Seidenfäden, die die Spuren übermitteln, eine große Rolle bei dem sozialen Leben der Raupen. Dennoch sind sie nicht von ausschlaggebender Bedeutung, denn experimentell wurde nachgewiesen, daß die Raupen sich auch zusammenfinden,[S. 304] wenn keine Seidenfäden als Wegweiser vorhanden sind. Das Tastgefühl der Raupen muß so fein und so eigenartig entwickelt sein, daß es auch ohne unmittelbare Berührung zu wirken vermag. Vielleicht genügen schon geringe Schwingungen in der Luft, die durch die Bewegung der Raupen verursacht werden, um einen Empfindungsreiz auf die Tastorgane anderer Raupen auszulösen. Der Tastsinn der Raupen als Mittel für ihre Orientierung ist ein außerordentlich interessantes Problem, das noch eines gründlichen Studiums bedarf. —
Unser Weg im Walde führt uns weiter an einen See, dessen blauer Wasserspiegel im wundersamen Kontrast steht zu den düsteren Tannen, die ihn umrahmen, und zu dem hellen Grün des Schilfes am Ufer; und doch vereint sich das Ganze zu einer bezaubernden Harmonie, die unserer Seele ein so wohltuendes Gleichgewicht verleiht. Wir stehen am Ufer, blicken in das klare Wasser und sehen eine Schar kleiner Fische, die sich hurtig und munter in dem nassen Element umhertummelt.
Auch hier wieder eine Ansammlung von Tieren auf engem Raum in inniger Gemeinschaft. Die Schwarmbildung der Fische beruht auf verschiedenen Ursachen, und man kann nach Schiemenz Geschlechts-, Ernährungs-, Familien-, Winter- und Wanderschwärme unterscheiden. Geschlechtsschwärme werden gebildet durch ein Zusammenscharen zahlreicher Fische an bestimmten Stellen in Flüssen, Seen oder im Meere, um das Fortpflanzungsgeschäft auszuüben. Die Ernährungsschwärme kommen zustande durch die Anhäufung bevorzugter Nahrung in gewissen Gegenden. Besonders die Planktonfresser folgen in großen Schwärmen der jeweiligen Verbreitung des Planktons. So bildet der Hering auf seinen Beutezügen gewaltige Scharen, die aus Millionen einzelner Fische bestehen.
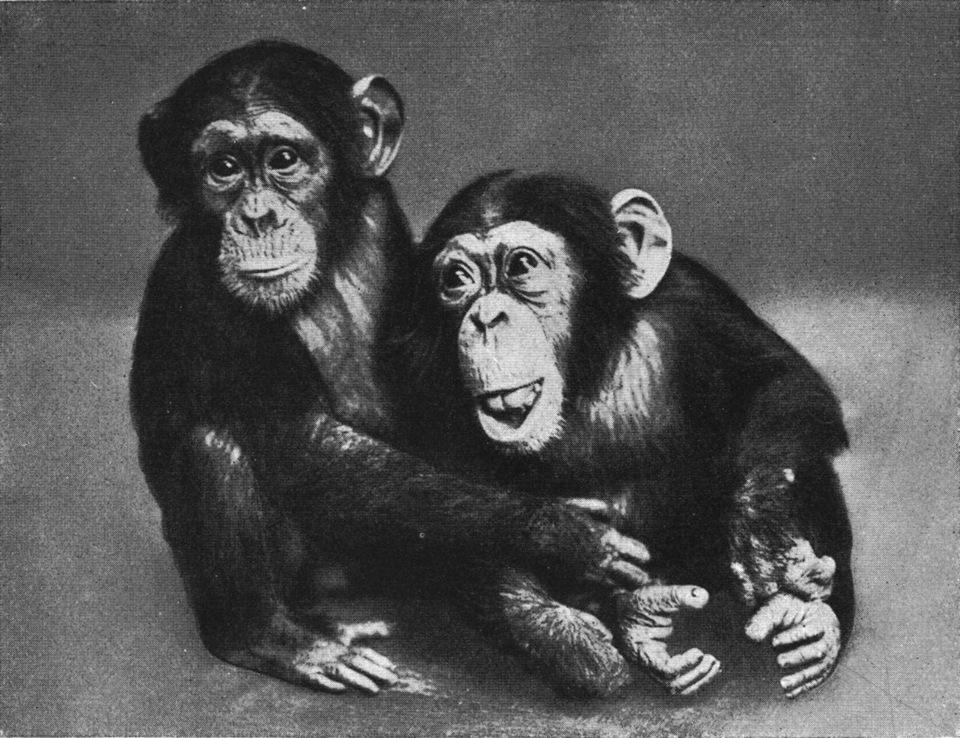
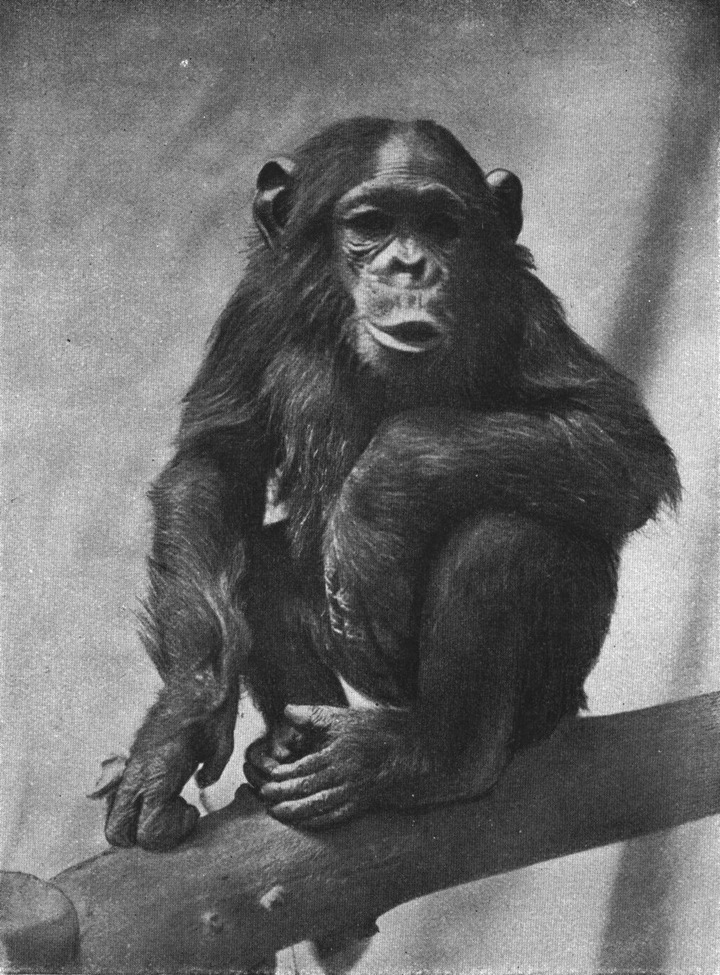
[S. 305]
Wie wir früher schon sahen, üben manche Fische eine Brutpflege aus, indem sie ihre Jungen eine Zeitlang führen und schützen. Die zahlreiche Nachkommenschaft bildet dann mit den Elterntieren einen Familienschwarm.
Bei den Winterschwärmen vereinigen sich die Fische, wie Weißfische, Aale und andere, um sich scharenweise im Schlamm zu vergraben und im erstarrten Zustande einen Winterschlaf zu halten.
Die größten Vergesellschaftungen bilden die Fische auf ihren Wanderungen, die z. B. die Lachse aus dem Meer in die Flüsse und die Aale umgekehrt aus den Binnengewässern in das Meer unternehmen, um den weitentfernten Laichplätzen zuzustreben.
Die Massenvereinigung der Fische auf ihren Wanderzügen verschafft ihnen den Vorteil, Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, wie Wehren, Stromschnellen oder Wasserfälle, leichter überwinden zu können, indem die dicht zusammengedrängte Masse der Fischleiber als ein Ganzes wirkt und so eine gewaltige Kraft entfaltet.
Außer diesen äußeren Gründen, die die Fische zur Schwarmbildung veranlaßt, spielt zweifellos auch ein ausgeprägter Geselligkeitstrieb hierbei eine große Rolle. —
Die letzten Sonnenstrahlen bedecken die Flur; die Bäume am Waldesrand, an dem wir unsere Schritte heimwärtslenken, werfen lange Schatten in abenteuerlicher Gestalt auf ein wogendes Roggenfeld. Plötzlich bleiben wir wie gebannt stehen, aus dem Walde schiebt sich langsam ein großer, dunkler Körper hervor — ein Stück Rotwild, das zur Äsung auszieht. Vorsichtig tritt es auf den Weg und verhofft mit hochgehobenem Kopf. Der Windfang, wie der Jäger die Nase des Wildes nennt, saugt begierig die leise Luftströmung ein, die ihm die Witterung des verhaßten Menschen aus weitester Entfernung zuträgt; die Lauscher drehen[S. 306] sich hin und her, um die feinsten Schallwellen aufnehmen zu können. Nach kurzer Zeit senkt das Tier vertraut den Kopf und zieht weiter. Die Luft ist rein und nichts scheint den Frieden der Natur zu stören. In wenigen Augenblicken folgt ein zweites Tier mit einem Kalb, immer mehr Wild tritt heraus. Wir zählen 7, 8, 9 Stück Rotwild, alles Kahlwild, d. h. weibliches Wild in der Weidmannssprache. Schließlich folgt ein schwacher Hirsch, ein Achtender mit noch ungefegtem Geweih. Die starken Kronenhirsche stehen in der Feistzeit im Sommer abseits vom Mutterwild (Abbildung 27). Sie hassen die Kinderstube und lieben die Einsamkeit, indem sie entweder als Einzelgänger ein heimliches Leben führen, oder zu zweien, bisweilen auch zu mehreren sich zusammentun, bis im Herbst, wenn die Blätter fallen, die Macht der Liebe sie erfaßt und sie wieder zum Kahlwild streben, um mit orgelndem Brunftschrei das Recht des Stärkeren geltend zu machen.
Das Rudel, das wir beobachteten, ist inzwischen weiter hinaus ins Feld gezogen. Das Alttier immer voran, die anderen im kurzen Abstande folgend. Nicht der Zufall, nicht äußere Gründe haben die Tiere vereint, sondern sie haben sich zusammengefunden, um gemeinsam den Gefahren, die sie bedrohen, zu begegnen. Ein altes, nicht mehr fortpflanzungsfähiges, weibliches Stück, ein Gelttier, wie der Weidmann sagt, übernimmt die Führung des Rudels. Es zieht auf dem Wechsel aus der Dickung zum Äsungsplatz an der Spitze und geleitet das Rudel, wenn die Morgendämmerung anbricht, wieder sicher in das schützende Waldesdunkel. Da das Gelttier keine Mutterpflichten mehr zu verrichten hat und ganz auf sich selbst eingestellt ist, so mögen Geruch und Gehör, die Sinne, mit denen das Wild die Gefahren wahrnimmt, bei ihm besser ausgebildet sein. Jedenfalls wird die Tätigkeit dieser Sinne durch keine anderen seelischen Gefühle und Triebe beeinflußt[S. 307] und gehemmt. Sie können also ihre Aufgabe ohne Ablenkung voll und ganz erfüllen. Das Rudel vertraut sich der Führung des Leittiers unbedingt an und fühlt sich unter seiner Obhut völlig sicher. Der große Wert des Leittiers zeigt sich so recht, wenn dieses auf einer Treibjagd zuerst abgeschossen wird. Das Rudel prellt zurück und löst sich, der Führung entbehrend, auf, so daß dann die einzelnen Stücke den Schützen vors Rohr kommen und leicht abgeschossen werden können. Dies gilt aber heute, wo unser Wildstand durch die Kriegs- und Revolutionszeit sehr gelitten hat, nicht mehr als weidmännisch. Man schießt vielmehr auch auf Treibjagden nur einzelne Stücke und knallt nicht wahllos alles nieder.
Im Unterschied zu den Gesellschaften der Schmetterlinge, Frösche und anderer Tiere, die nur durch äußere Lebensbedingungen gebildet werden, haben wir es hier mit einem wirklich sozialen Leben zu tun. Die Vereinigung erfolgt zum Zweck der persönlichen Sicherheit. Sie gründet sich auf einen gegenseitigen Nutzen.
Ebenso wie das Rotwild verfahren alle Wiederkäuer und viele andere Säugetiere. Die Antilopen und Zebras bilden große Rudel. Häufig bestehen die Antilopenrudel sogar aus verschiedenen Arten. Der wegen seiner Wildheit gefürchtete afrikanische Kaffernbüffel bildet große Herden, die in früheren Zeiten, als der Bestand der Tiere durch die Verfolgung des Menschen noch weniger gelitten hatte, nach Hunderten und Tausenden zählten. Noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden im Innern des schwarzen Erdteils Büffelherden, die aus 4000–5000 Tieren bestanden, beobachtet. Eine solche Massenvereinigung ist freilich nur denkbar und möglich in Gegenden, wo ein Überfluß an Nahrung vorhanden ist, wie in den weiten, endlosen Gebieten der afrikanischen[S. 308] Steppe. Da der einzelne Büffel durch die Stärke seines Körpers und die gewaltigen Hörner ein sehr wehrhaftes Tier ist, das sich allein gegen jede Gefahr verteidigen kann, so verfolgt die Herdenbildung weniger den Zweck, die Sicherheit zu erhöhen, sondern geschieht wohl hauptsächlich aus Geselligkeitstrieb. Das Tier bedarf anscheinend zur Herstellung seines seelischen Gleichgewichts und Wohlbehagens der Gesellschaft seinesgleichen. Wie groß die Liebe zur Geselligkeit ist, geht am besten daraus hervor, daß ganz alte Stiere, die von überlegenen Rivalen abgekämpft sind und aus der Herde verstoßen werden, nicht gern ein einsiedlerisches Leben führen, sondern sich ihrerseits zusammenfinden, um eine Gemeinschaft alter Junggesellen zu bilden. Gewöhnlich sind 10 bis 15 solcher alten, griesgrämigen Bullen vereint.
Der im polaren Nordamerika lebende Moschusochse, der entsprechend dem kalten Klima seiner Heimat mit einem dichten, zottigen Pelz ausgerüstet ist, lebt in Rudeln von 10–30 Stück. Der Hauptfeind dieser Tiere ist der Wolf, dessen Angriff sie sehr erfolgreich zu begegnen wissen. Sie drängen sich in einem dichten Kreis zusammen und richten ihre Köpfe nach außen, wobei die spitzen Hörner eine undurchdringliche Phalanx bilden, gegen die die blutdürstigen Raubtiere machtlos anrennen. Auf diese Weise gelingt es den Moschusochsen, selbst den Angriff einer starken Rotte von Wölfen abzuschlagen. Hier hat sich das soziale Leben bereits zu einer gemeinsamen, gegenseitigen Verteidigung ausgebildet.
Bei den Gemsen und Steinböcken halten stets einzelne Posten Wache, sobald das Rudel sich zur Ruhe niedertut. Diese Wachen legen sich nicht nieder, sondern bleiben aufrecht stehen mit hochgehobenem Kopf, um vermittels ihres feinen Gehörs und Geruchs jede Gefahr rechtzeitig zu erkennen und das Rudel zu warnen.[S. 309] Der Warnruf der Gemsen ist ein lauter, durchdringender Pfiff, der Steinböcke ein pfeifendes Schnauben. Auf das Signal hin erhebt sich sofort das ganze Rudel, um unter Führung des Leittieres sein Heil in der Flucht zu suchen.
Im Gegensatz zu den Wiederkäuern hat bei den Wildpferden, Zebras, Wildeseln und den asiatischen Urwildpferden stets ein männliches Tier die Führung des Trupps. Der stärkste Hengst, der alleiniger Besitzer der Stuten ist und zugleich der Beherrscher des ganzen Rudels, sorgt für die Sicherheit. Ebenso ist es bei den gesellig lebenden Affen, bei denen das soziale Leben nach strengen Regeln und Gesetzen geordnet ist.
Bei den Meerkatzen führt der älteste und stärkste Affenvater das Regiment in der Bande, die sich ganz und gar seiner erfahrenen Führung anvertraut und allen seinen Befehlen ohne Widerspruch Folge leistet. Er übt sein verantwortungsvolles Amt mit größter Umsicht und nie ermüdendem Eifer aus. Auf der Wanderung geht er eine Strecke voraus. Alle übrigen Affen folgen genau seinen Fußtritten, ersteigen denselben Baum und klettern über dieselben Äste hinweg, auf denen der Weg des Leitaffen entlangführt. Ab und zu hält dieser vom Gipfel eines Baumes Umschau. Sofort bleibt die ganze Horde halten, bis die gurgelnden Töne des sorgsamen Alten verkünden, daß keine Gefahr droht und die Reise fortgesetzt werden kann. Kommt man an ein Maisfeld, dann wartet man hübsch ab, bis der gestrenge Herr sich überzeugt hat, daß man hier gefahrlos den Mittagsschmaus halten kann. Die Bande löst sich allmählich auf, jeder sucht sich ein Plätzchen, wo er sorglos seinen Hunger stillen kann. Die noch unmündigen Kinder, welche auf dem Marsche an dem Leibe ihrer Mütter hingen, verlassen diese und spielen umher, werden aber stets von der Mutter sorgfältig beaufsichtigt. Der alte Affenvater vergißt[S. 310] beim Verzehren des wohlschmeckenden Maiskolben nicht, ständig für die Sicherheit zu sorgen. Von Zeit zu Zeit erhebt er sich, ersteigt einen Baum oder Hügel, um sich zu überzeugen, daß keine Gefahr droht. Sobald er irgend etwas Verdächtiges bemerkt, läßt er seinen Warnruf erschallen. Sofort springen alle Affen auf und sammeln sich um ihren Gebieter, um, wenn notwendig, den Rückzug unter seiner Führung anzutreten. Jeder sucht noch so schnell wie möglich recht viel Maiskörner zusammenzuraffen und in den Backentaschen zu bergen.
Bei den Pavianen, die bisweilen in großen Horden von mehreren Hunderten zusammenleben, haben häufig mehrere Männchen die Führung, und zwar sind es stets die ältesten und stärksten Stücke. Auch das Liebesleben ist geregelt, wie man bei dem Mantelpavian oder Hamadryas beobachtet hat. Jedes mannbare Männchen hat sein Weibchen, das seinem Gemahl auf Schritt und Tritt folgt und stets in seiner unmittelbaren Nähe bleibt. Nähert sich ein jüngeres Männchen in verführerischer Absicht einem verehelichten Weibchen, so wird es von dem rechtmäßigen Gemahl sofort ernstlich angegriffen und verjagt. Unter Umständen entspinnt sich auch ein ernstlicher Kampf, der dem Sieger den Besitz des Weibchens sichert.
Bei dem im abessinischen Hochlande lebenden Nacktbrustaffen oder Dschelada, der sich durch eine nackte rote Stelle am Unterhals und der Brust auszeichnet, besteht die Horde aus einzelnen, kleineren Trupps, die von je einem alten Männchen geführt werden. Einige alte Männchen scheinen die Oberaufsicht über die ganze Bande zu haben. Sie sind es wohl auch, welche als Wachposten für die Sicherheit sorgen, wenn die Horde sich zur Ruhe oder Mahlzeit niederläßt.
Wertvolle Angaben über das soziale Leben der Menschenaffen[S. 311] verdanken wir Eduard Reichenow[6]. Nach seinen Beobachtungen leben Schimpanse (Abbildung 29 u. 30) und Gorilla (Abbildung 28) in Familien, die sich zu größeren oder kleineren Horden zusammenschließen. Jede Horde bewohnt einen bestimmten Bezirk im Urwalde, dessen Durchmesser sich gewöhnlich auf etwa 15 km erstreckt. Innerhalb dieses Gebiets streifen die Affen am Tage Nahrung suchend umher. Während die einzelnen Gorillafamilien sich hierbei trennen und jede für sich ihren Weg geht, um sich erst am Abend wieder zusammenzufinden, hält die Schimpansenhorde mehr zusammen. Auch sind die Schimpansenherden in der Regel zahlreicher als die Gorillagesellschaften. Erstere bestehen bisweilen aus 20–30 Köpfen, während in einer Gorillahorde meist nur 7–16 Tiere vereint sind. Am Abend errichten sich Schimpanse und Gorilla Schlafnester, der Schimpanse stets auf Bäumen in einer Höhe von 8–13 m, der Gorilla meist auf dem Erdboden oder in einem niedrigen Strauch 1–1½ m über der Erde. Im Süden seines Verbreitungsgebiets, das sich im Innern Afrikas von Kamerun bis zum Tanganjikasee erstreckt, übernachtet nur das Männchen der Gorillafamilie auf der Erde, während das Weibchen und die halbwüchsigen Jungen sich ihre Schlafnester auf Bäumen in einer Höhe von 5–6 m bauen. „Eine Erklärung für das verschiedene Verhalten des Gorillas im Süden und Norden zu geben, ist recht schwierig“, sagt Reichenow und fährt fort: „Wenn es die Furcht vor dem Angriffe des Leoparden wäre, wie Koppenfels meint, die im Süden die jungen und die weiblichen Tiere auf die Bäume treibt, so wäre nicht zu verstehen, warum diese Furcht im Norden nicht besteht; denn der Leopard[S. 312] fehlt hier gleichfalls nicht. Gerade der Umstand, daß der Gorilla im nördlichen Urwaldgebiet sein Nachtlager am Boden errichtet, beweist, daß er, im Gegensatz zum Schimpansen, den Leopard nicht fürchtet.“
Daß die verschiedenartige Anlage der Nester nur auf Gewohnheit und Sitte beruhen soll, kann man meiner Ansicht nach kaum annehmen. Irgendeinen Grund muß die Sache schon haben. Wir sehen hier wieder, wie schwer es bisweilen ist, die biologischen Eigenschaften der Tiere zu verstehen und zu erklären.
Die Angabe älterer Autoren, daß beim Schimpansen nur die Weibchen mit den Jungen in Bäumen auf Nestern schlafen, und daß das Männchen stets unten am Stamm übernachtet, um den Überfall des Leoparden rechtzeitig bemerken und abwehren zu können, hält Reichenow für unrichtig. Nach seinen Beobachtungen baut sich auch das alte Männchen stets ein Schlafnest im Baumgipfel.
Die Nester des Schimpansen und Gorillas ähneln in ihrem Äußern den Storchnestern. Sie bestehen aus Ästen und Zweigen, die die Affen nach innen umbiegen und zusammenflechten.
Das Schlafnest des erwachsenen Gorillas hat einen Durchmesser von etwa 1½ m; die Nester halbwüchsiger Tiere sind entsprechend kleiner. Fast immer stehen zwei große Gorillanester dicht nebeneinander und einige kleine Nester in unmittelbarer Nähe, was auf die Lagerstätte eines Ehepaares mit seinen Kindern hindeutet. Reichenow schließt daraus, daß der Gorilla monogam lebt und meint, daß die Ehe auf Lebenszeit, jedenfalls für längere Dauer geschlossen wird. Diese Beobachtung ist von besonderem Wert, da es der erste Fall von Monogamie unter den Affen wäre, die sonst durchaus polygam leben. Ob auch der Schimpanse eine monogame Lebensweise führt, konnte Reichenow leider nicht feststellen.
[S. 313]
Schimpanse und Gorilla benutzen ihre Schlafnester stets nur einmal und errichten sich am Abend an der Stelle, wo ihr Tageswerk beendet wird, jedesmal eine neue Lagerstatt. Während die Nester der einzelnen Familienmitglieder stets nahe beisammen stehen, befinden sich zwischen den Lagerstätten der Familien größere Zwischenräume. Man kann daher nach der Anzahl der Nestgruppen die Zahl der Familien einer Herde, und nach der Anzahl der Familiennester die ungefähre Kopfstärke der Familie feststellen. Im letzteren Falle ergibt sich jedoch keine genaue Zahl, sondern nur eine annähernde Schätzung, da die ganz jungen Affen noch keine eigenen Nester bauen, sondern zusammen mit der Mutter schlafen, und die älteren Tiere bisweilen das zuerst gebaute Nest durch ein zweites ersetzen, wenn ihnen jenes nicht sicher genug erscheint. Bei starkem Regen sollen die Affen nicht im Nest, sondern unterhalb desselben übernachten, indem sie sich auf dem Erdboden oder in den Zweigen hinkauern und das Nest als Dach zum Schutz gegen die Nässe benutzen.
Auffallend ist es, daß Tiere von so gewaltiger Körperstärke, wie die Menschenaffen, ausschließlich vegetarisch leben. Ihre Nahrung besteht in Früchten, Knospen und Blättern, und nur hin und wieder werden Vogeleier ausgetrunken, eigentliche Fleischkost wird dagegen verschmäht. Reichenow gibt hierfür eine sehr interessante und beachtenswerte Erklärung. Er fand im Darm der Menschenaffen Protozoen, die den Infusorien der Wiederkäuer sehr ähnlich sind und offenbar für die Verdauung eine große Rolle spielen. „Diese Infusorien“, sagt unser Gewährsmann, „erleichtern ihren Wirten durch die von ihnen geleistete Zelluloseverdauung die Ausnutzung der pflanzlichen Nahrungsstoffe, und sie bieten dadurch, daß sie selbst ständig in großer Zahl im Darme zugrunde gehen und verdaut werden, einen gewissen Ersatz[S. 314] für Fleischnahrung.“ In der Gefangenschaft verschwinden diese Infusorien sehr bald aus dem Darm der Menschenaffen, wodurch die Ernährung des Körpers beeinträchtigt wird. Die Sucht nach Fleischnahrung, die die gefangenen Tiere im Gegensatz zu den freilebenden häufig zeigen, läßt sich vielleicht hiermit in Zusammenhang bringen. Die Tiere haben unwillkürlich das Verlangen, sich für die fehlende Infusoriennahrung einen Ersatz zu verschaffen. Auch die Hinfälligkeit der Menschenaffen in der Gefangenschaft und ihre Neigung zur Tuberkulose und anderen Krankheiten steht wahrscheinlich hiermit im Zusammenhang. Jedenfalls tut der Tiergärtner gut, den Menschenaffen Fleischkost nicht vorzuenthalten, um hierdurch einen Ausgleich für den in der Gefangenschaft veränderten Stoffwechsel zu schaffen.
In Gegenden, wo die Gorillas vom Menschen unbehelligt leben, sind sie überaus dreist und furchtlos. Wenn sie mit der Mahlzeit beschäftigt sind, lassen sie den Menschen bis auf wenige Schritte herankommen. Wittert das Männchen Gefahr, so trommelt es mit den Fingern auf die Wangen des geöffneten Maules, um seine Familie zu warnen und zum Rückzug aufzufordern, während er selbst meist standhält, um sich von der vermeintlichen Gefahr zu überzeugen. Erblickt er den Menschen, so stößt er ein mehrmaliges kurzes Brüllen aus, klatscht mit den Händen und schlägt mit ihnen gegen die Brust. Einen Angriff wagt der Gorilla jedoch meist nicht, sondern er zieht sich langsam zurück, wenn man ihm näher auf den Leib rückt. In einiger Entfernung bleibt er dann wieder stehen, und das Spiel beginnt von neuem. Nur ganz alte Männchen, die sich von der Herde abgesondert haben und Einzelgänger geworden sind, greifen bisweilen den Menschen, der in seiner Nähe auftaucht, an und sind dann furchtbare Gegner.
[S. 315]
Die Behauptung der Eingeborenen, daß Gorillamännchen Negermädchen überfallen und sie vergewaltigen, ist ein Märchen, das nach einstimmiger Aussage aller Forscher durchaus unglaubwürdig ist. Schon die Witterung des Menschen flößt dem Affen Schrecken ein. Er erkennt in ihm seinen Feind, betrachtet ihn aber niemals als seinesgleichen oder als einen willkommenen Ersatz, um Liebesgefühle zu befriedigen.
Der dritte Menschenaffe ist der auf Sumatra und Borneo heimische, mit rotem zottigen Haar bekleidete Orang-Utan (Abbildung 31 u. 32). Auch er baut sich Schlafnester, die er mit grünen Zweigen auspolstert. Sonst sind wir über die Lebensweise dieses Affen weniger unterrichtet, als es vom Schimpansen und Gorilla der Fall ist. Im Gegensatz zu diesen ist er ein ausgesprochenes Baumtier, das nur ungern zum Boden hinabsteigt. Der Gorilla dagegen bewegt sich vorzugsweise zu Fuß auf dem Erdboden fort, und in der Mitte zwischen Gorilla und Orang steht der Schimpanse, der sich sowohl auf dem Erdboden wie in den Baumkronen aufhält. Dem Orang kommen bei seinem Baumleben die sehr langen Arme zugute, mit denen er weitentfernte Äste ergreifen kann. Er hat unter den drei Menschenaffen die längsten Arme und kürzesten Beine und entfernt sich in dieser Beziehung sehr weit vom Menschen. Dagegen steht er in bezug auf die Schädelform dem Menschen wieder am nächsten, was sich besonders in der Jugend ausprägt. Der Schädel eines Orang-Kindes hat nach Hans Virchow „einen verblüffend menschlichen, ja man möchte beinahe sagen: einen unangenehm menschlichen Zug“, der besonders in der steil ansteigenden Stirnpartie zum Ausdruck kommt. Im Vergleich zum Gorilla, und besonders zu dem sehr lebhaften, temperamentvollen Schimpansen ist der Orang viel phlegmatischer und ruhiger. —
[S. 316]
Ein soziales Leben, das gemeinsamen Interessen dient, hat sich auch unter den Raubtieren herausgebildet. Die Wölfe rudeln sich im Winter zu großen Scharen zusammen, um zur Zeit der Hungersnot auch stärkeren Tieren zu Leibe zu gehen. Sie greifen dann gemeinsam Rentiere, Hirsche und Wildschweine an, ohne Rücksicht darauf, daß der Kampf zahlreiche Opfer unter ihnen fordert. Hier heißt es: „Einer für alle und alle für einen“, um den harten Kampf des Daseins zu bestehen. Bei ihren Raubzügen gehen die Wölfe bisweilen planmäßig vor und verteilen die Rollen. Ein Teil hetzt und verfolgt die Beute, während der andere Teil ihr den Weg abzuschneiden sucht.
Der afrikanische Hyänenhund hetzt wie eine Parforcejagdmeute das Wild zu Tode. Die Hunde leben in Rudeln von etwa 30 bis 60 Stück und ziehen gemeinsam auf Beute aus. Bei der Hetze, die mit ständigem Lautgeben, das ein Gemisch von Bellen und Heulen ist, begleitet wird, entwickeln die Hunde eine gewaltige Ausdauer und Schnelligkeit. Selbst die schnellste Antilope wird verfolgt, bis sie vor Erschöpfung zusammenbricht oder sich stellt. Mag es der wehrhaften Säbelantilope auch gelingen, die ersten Angreifer mit ihren langen, speerartigen Hörnern zu erdolchen, ihr Schicksal ist besiegelt. Sie unterliegt trotz mutiger Verteidigung der Überzahl ihrer Feinde, die sie sofort in Stücke zerreißen und verzehren. Bei der Hetze eines schnellen Wildes, das die Kraft der Hunde auf eine harte Probe stellt, schneiden die hinteren Tiere des Rudels den Weg ab, sobald das verfolgte Tier einen Bogen macht oder Haken schlägt. Hierdurch verkürzen sie die Laufbahn und schonen ihre Kräfte. Haben sie das gehetzte Wild wieder erreicht, so übernehmen sie die unmittelbare Verfolgung, und die anderen bleiben zurück, um bei späterer Gelegenheit ebenso zu verfahren. Durch diesen Wechsel wird einer frühzeitigen Ermüdung[S. 317] der ganzen Meute vorgebeugt, und es bleiben immer frische Kräfte dem Opfer auf den Fersen.
Der Hyänenhund ist ein hochläufiger Wildhund von etwa 75 cm Schulterhöhe. Er ist weiß, schwarz und gelb gescheckt, indem bald die eine, bald die andere Farbe mehr hervortritt. Abweichend von allen anderen Hunden trägt der Hyänenhund an allen Füßen nur vier Zehen. Die mittellange Rute ist buschig. Der breite, kurzschnauzige Kopf mit den großen, hochstehenden Ohren ähnelt dem Kopf der Hyäne. Die Heimat des Hyänenhundes ist die Steppe Afrikas südlich der großen Wüste.
Etwas Ähnliches wie bei den Raubtieren finden wir auch unter den Vögeln, bei denen der Geselligkeitstrieb außerordentlich stark ausgeprägt ist. Schuhschnabel und Schlangenhalsvogel unternehmen gemeinsame Raubzüge und unterstützen sich planmäßig beim Fischfang. Beide Vogelarten sind sehr interessante Erscheinungen in der artenreichen Vogelwelt.
Der Schuhschnabel (Balaeniceps rex) ist ein den Reihern nahestehender Vogel mit dunkelbraunem Gefieder und einem höchst absonderlichen, plumpen Schnabel, der einem großen Holzschuh gleicht. Er lebt in dem Sumpfgebiet des Weißen Nils. Beim Fischfang vereinigen sich die Vögel zu mehreren und treiben, langsam im Wasser vorwärtsschreitend, die Fische allmählich nach seichten Stellen, wo sie dann leicht erbeutet werden können. Auf großen Wasserflächen kreisen sie die Fische regelrecht ein, indem sie sich in einem weiten Kreisbogen gruppieren und sich langsam nach der Mitte zu bewegen. Beim Abfischen von schmalen Flußläufen teilen sich die Schuhschnäbel in zwei Gruppen, die eine bewegt sich stromabwärts und treibt die Fische vor sich her, während die andere Gruppe ihren Kameraden stromaufwärts entgegenkommt, um die Fische zu fangen.[S. 318] Der Schuhschnabel übt also beim Fischfang regelrechte Treibjagden aus.
Der in Afrika und Asien heimische Schlangenhalsvogel (Anhinga) gehört zu den Kormoranen und bewohnt in mehreren Arten Amerika, Australien und Asien. Der Vogel zeichnet sich durch einen sehr langen, dünnen, beweglichen Hals aus, auf dem ein sehr kleiner, spitzer Kopf mit spitzem Schnabel sitzt. Da der Hals mit dem kleinen Kopf einer Schlange ähnlich ist, führt der Vogel den Namen Schlangenhalsvogel. Die Schlangenhalsvögel sind vortreffliche Schwimmer und Taucher. Sie bilden beim Fischen große Gesellschaften von vielen Hunderten. Der vordere Teil der Vogelschar fischt unter Wasser, der hintere Teil folgt im Fluge über dem Wasserspiegel. Dann überholen die fliegenden Vögel ihre unter Wasser fischenden Kameraden, tauchen vor ihnen in die Flut, und die anderen erheben sich aus dem Wasser, um nun den Kameraden, die sie ablösten, im Fluge zu folgen. So wälzt sich der Strom der Schlangenhalsvögel abwechselnd tauchend und fliegend als eine lange Masse über und unter dem Wasser dahin, und es unterliegt keinem Zweifel, daß diese eigenartige Sitte den Zweck hat, den Fischfang zu begünstigen. In dem gemeinsamen Fischfang des Schuhschnabels und Schlangenhalsvogels prägt sich ein wirklich soziales Leben aus, in dem sich die Vögel gegenseitig helfen und unterstützen.
Ein derartig soziales Leben ist aber eine Ausnahme in der Vogelwelt. Zwar leben die meisten Vögel sehr gesellig, ohne daß jedoch hierbei das Prinzip der Arbeitsteilung und gegenseitigen Hilfe, was den Sozialismus kennzeichnet, zum Ausdruck kommt. Die Vergesellschaftungen der meisten Vögel sind lediglich eine Folge ihres stark entwickelten Geselligkeitstriebes.
Der Storch nistet gern in Gesellschaft seinesgleichen. Der Star und der Sperling bilden in der Brutzeit mit Vorliebe kleinere[S. 319] oder größere Kolonien, und die artenreiche Gruppe der Prachtfinken, der Astrilden und Amadinen, leben stets sehr gesellig. Wie groß ihre Liebe zur Geselligkeit ist, kann man am besten beobachten, wenn man die reizenden, buntfarbigen Vögel in Gefangenschaft hält. Dichtgedrängt, einer neben dem anderen, sitzen sie in langer Reihe da, wenn sie der Ruhe pflegen, und schmiegen sich eng zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen und durch Krauen mit dem Schnabel im Gefieder zu liebkosen. Die Webervögel bilden große Scharen, die nach Hunderten und Tausenden zählen. Ihre kunstvollen Nester hängen in Massen beisammen.
Die Flamingos bevölkern in gewaltiger Menge die Lagunen, wo ihre tellerförmigen Schlammnester weite Strecken bedecken.
Der Hang der Vögel zur Geselligkeit tritt am meisten auf den großen Wanderungen der Zugvögel hervor. Finkenartige Vögel vereinigen sich zu Hunderten in großen Schwärmen. Die Störche erhalten auf ihrem Reiseweg von allen Seiten neuen Zuwachs, so daß schließlich die Schar gewaltig zunimmt. Goldhähnchen und andere Kleinvögel gesellen sich zu Tausenden zusammen, auch unser Star, der die Gesellschaft über alles liebt, bildet auf dem Zuge große Massenflüge. Der Kranich, der bei uns in Deutschland und auch in anderen Gegenden ein recht seltener Vogel geworden ist, bevölkert in der Winterherberge, dem Gebiet des Weißen Nils, in zahlloser Menge die schimmernden Inseln des heiligen Stromes. Die Vögel stehen häufig Kopf an Kopf, so dicht gedrängt, daß kaum noch ein Zwischenraum bleibt. Unter sie mischen sich mit Vorliebe die kleineren Jungfernkraniche, die hier ebenfalls überwintern. Eine Vereinigung mehrerer Vogelarten auf dem Zuge ist jedoch im allgemeinen eine Ausnahme. In der Regel wandern die einzelnen Arten gesondert. Andere Vögel begnügen sich damit, auf dem Zuge nur kleinere Gesellschaften zu[S. 320] bilden, wie es z. B. die Wildtauben tun, die ich auf der Kurischen Nehrung immer nur in Flügen von etwa 7 bis höchstens 15 Stück wandern sah. Auch die Raubvögel, die mehr ein einsames Dasein führen oder paarweise leben, ziehen bisweilen gesellig. So wurden große Flüge von wandernden Bussarden, Abendfalken, Sperbern und Eulen beobachtet. Besonders die Waldohreule liebt es, im Winter kleinere oder größere Trupps zu bilden.
Ebenso wie die eigentlichen Zugvögel schweifen auch die Strichvögel im Winter gemeinsam umher. Jedem sind ja die Scharen von Meisen bekannt, die häufig unter Führung eines großen Buntspechts unsere Wälder in der kalten Jahreszeit durchstreifen. Die Meisentrupps bestehen meist aus mehreren Arten: Kohlmeisen, Blaumeisen und Sumpfmeisen, zu denen sich hin und wieder noch Goldhähnchen und Baumläufer gesellen. So zieht eine bunte und lustige Gesellschaft durch den schneebedeckten Winterwald.
Wie wir schon gesehen haben, vollführen nicht nur die Vögel, sondern auch andere Tiere, Säugetiere, Fische und Insekten, große Wanderungen. Auch hier findet stets eine Vergesellschaftung statt. Es scheint dem Tier ebenso zu gehen wie dem Menschen, auf der Wanderung liebt es die Geselligkeit. Es wandert sich zu mehreren leichter als einsam, und dies Gefühl mag auch das Tier haben. Ein wirklich praktischer Nutzen ist in der gemeinsamen Wanderung der Tiere kaum zu erkennen, im Gegenteil, ihre Anhäufung auf engem Raum muß ihre Ernährung beeinträchtigen. So können wir die Ursache zur Schwarmbildung nur in psychischen Momenten erblicken. Das einzelne Individuum fühlt sich offenbar unbehaglich, wenn es seine Heimat verläßt und neue, weit entfernte, unbekannte Gegenden aufsucht. Es wähnt sich sicherer in Begleitung zahlreicher Artgenossen, die die Gefahren der Reise mit ihm teilen.
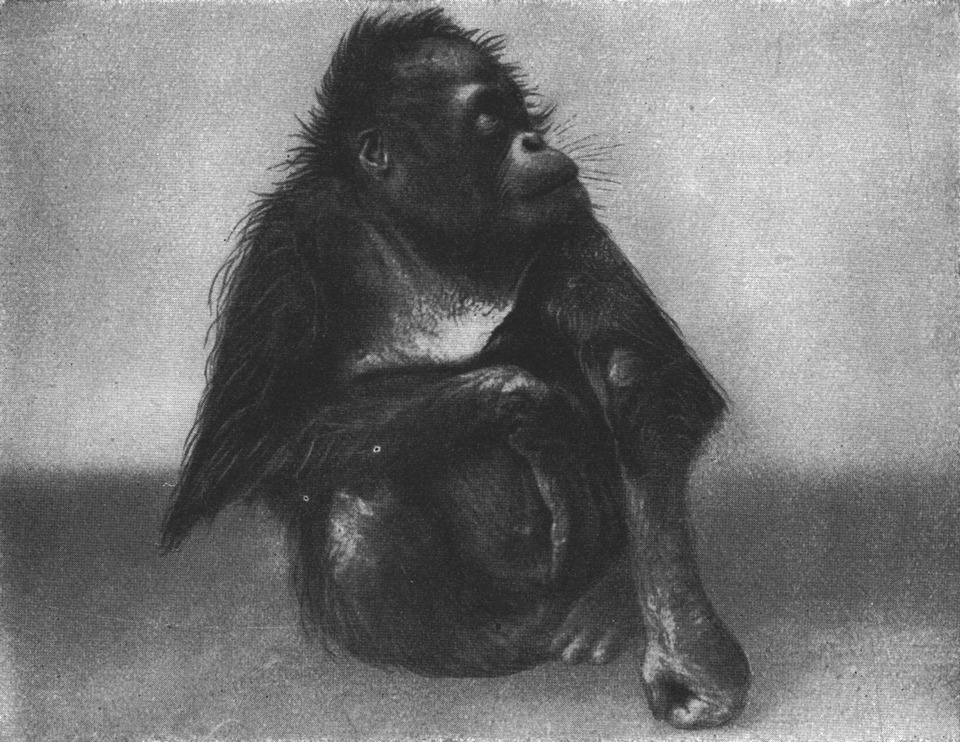

[S. 321]
Die gemeinsame Reise bietet ferner den Vorteil, daß die älteren Tiere, die den Weg schon wiederholt zurückgelegt haben und ihn daher kennen, die jungen Individuen leiten. Doch darf diesem Umstand nicht allzuviel Wert beigelegt werden, denn aus der Vogelzugforschung wissen wir, daß bei den einsam wandernden Arten, wie z. B. vielen Raubvögeln und dem Kuckuck, der junge Vogel ohne jede Führung die Winterherberge zu finden weiß, was offenbar auf einem angeborenen Richtungssinn beruht, worüber in dem Abschnitt, der die Tierwanderungen behandelt, schon ausführlich gesprochen wurde. So kommt man immer wieder darauf zurück, daß es hauptsächlich ein seelisches Verlangen ist, das die Tiere auf ihren Wanderungen zusammenschart; es ist der Geselligkeitstrieb, der zur Reisezeit in der Tierseele erwacht.
In Afrika lebt ein kleiner, etwa wachtelgroßer Regenpfeifer, der nach seiner absonderlichen Freundschaft mit dem Krokodil den Namen Krokodilwächter (Pluvialis aegyptius) trägt. Dieser harmlose Vogel hat sich mit dem ungeschlachten Krokodil vergesellschaftet. Er läuft unbesorgt auf dem Panzer des gefährlichen Reptils umher, um die daran haftenden Wasserinsekten und Würmer abzulesen und zu verspeisen. Ja er scheut sich sogar nicht, in den gewaltigen, aufgesperrten Rachen seines riesigen Freundes zu schlüpfen und die Blutegel, die sich an dessen Zahnfleisch angesaugt haben, als willkommenen Leckerbissen zu verzehren. Da kommt es bisweilen vor, daß das Krokodil seinen Rachen schließt. Der kleine Wicht duckt sich dann ganz ruhig in dem gefährlichen Gefängnis nieder und wartet, bis das Krokodil wieder den Rachen aufsperrt und seinen Wohltäter befreit. Der Vogel versteht es, mit großer Gewandtheit und Vorsicht sich vor den Bissen des Krokodils zu schützen. Vielleicht hat aber auch das Krokodil ein gewisses Gefühl für die Wohltaten des Vogels und vermeidet es,[S. 322] diesem ein Leid zuzufügen. Die innersten Regungen und Vorgänge in der Tierseele sind uns ja noch so wenig bekannt, daß es unendlich schwer ist, eine zutreffende Erklärung für derartige eigenartige Erscheinungen des Tierlebens zu geben. Die Wissenschaft hilft sich in solchen Fällen damit, von angeborenen, automatischen Triebhandlungen zu sprechen, die ohne Zweifel die Handlungen der Tiere in hohem Maße beeinflussen. Aber schließlich kann man nicht alles damit erklären. Wir können eben letzten Endes das Tier nicht fragen, und so werden viele Vorgänge vielleicht in ein ewiges Dunkel gehüllt bleiben. Das „Ignorabimus“ eines Du Bois hat vielleicht auch hier Gültigkeit.
Das Krokodil genießt aber noch einen zweiten Vorteil von dem Zusammenleben mit dem Vogel. Dieser ist sehr schreckhaft und läßt bei jeder verdächtigen Gelegenheit seinen Warnruf erschallen, der für das Krokodil ein Signal zur Flucht geworden ist. Es taucht sofort unter, wenn es die Stimme des Vogels vernimmt, um sich in Sicherheit zu bringen. Nach dieser Wirkung seiner Stimme, der sich der Vogel freilich nicht bewußt ist, hat er den Namen „Krokodilwächter“ erhalten.
Beide Tiere, sowohl der Vogel wie das Krokodil, haben von dem Zusammenleben einen unverkennbaren Vorteil. Der Vogel findet seine Nahrung an der Echse, und diese wird dadurch von den lästigen Schmarotzern befreit und zugleich durch die Stimme des Vogels vor Gefahren gewarnt. Wissenschaftlich nennt man eine derartige Gemeinschaft zweier verschiedener Tierarten, die auf einem gegenseitigen Nutzen beruht, Symbiose.
Eine Symbiose besteht ferner zwischen den Madenhackern, afrikanischen Starvögeln, und dem Elefanten, dem Nashorn sowie den Wiederkäuern. Die Vögel lesen diesen Tieren das Ungeziefer von der Haut ab.
[S. 323]
Ein besonders eigenartiger Fall von Symbiose ist die Freundschaft eines kleinen indischen Fisches (Amphiprion percula) mit einer großen Aktinie (Discosoma). Der Fisch hält sich zwischen den langen Fangarmen der Aktinie auf und flüchtet sogar, wenn er sich bedroht fühlt, in den Innenraum des Hohltiers. So fühlt sich der kleine buntgefärbte Fisch ganz sicher unter dem Schutz der Aktinie und dankt ihr die Gastfreundschaft dadurch, daß er sie mit Nahrung versieht. Er schiebt ihr diese in den Schlund.
Die Korallenfische leben in den Korallenriffen und suchen bei Gefahr Schutz in den Korallenästen. Die Korallen haben jedoch keinen Vorteil von der Gemeinschaft mit den Fischen, sondern lediglich die letzteren. Man nennt diese Lebensgemeinschaft mit einseitigem Nutzen „Parökie“.
Eine andere Art der Vergesellschaftung ist die Synökie. Hier wohnt ein Tier auf oder in einem anderen, ohne daß hieraus dem Wirtstier ein Nutzen oder Schaden erwächst. Dieses gibt nur dem Partner die Wohnung. Der Nadelfisch (Fierasfer acus), der im Mittelmeer lebt, bewohnt die zu den Aktinien gehörenden Seegurken. Der Fisch schlüpft in dem Augenblick, wo die Seegurke ihre Kloake zur Wasseratmung öffnet, mit dem Kopf in diese hinein und dreht sich dann schnell um, so daß er mit dem Kopf vor der Kloakenmündung liegt. Hier verbringt er den Tag, um nachts seine Behausung zu verlassen und Nahrung zu sich zu nehmen, die aus kleinen Meerestieren besteht, welche durch die Exkremente der Seegurke angelockt werden. Der Seegurke erwächst von ihrem „Aftermieter“ kein Schaden. Der Nadelfisch ist ein kleiner, etwa 14 mm langer Fisch mit glatter, schuppenloser Haut.
Eine andere Familie der Fische, die Schiffshalter (Echeneis), haben auf dem Oberkopf eine große längliche Saugscheibe, mit[S. 324] der sie sich an andere größere Fische festsaugen und von diesen umhertragen lassen. So unternimmt der Fisch weite Reisen, die ihn sogar in fremde Weltmeere führen.
Die Schiffshalter bewohnen in etwa 10 Arten die warmen Meere der ganzen Welt, eine Art der Schildfische (Echeneis remora) kommt auch im Mittelmeer vor. Die Fische saugen sich auch an Seeschildkröten, ja sogar an leblose Gegenstände, wie Schiffskörper, an. Die Eingeborenen Afrikas benutzen die Schiffshalter zum Fang von Seeschildkröten. Sie binden den Fisch an eine lange Leine und lassen ihn an Stellen, wo Seeschildkröten häufig sind, im Wasser schwimmen, wo der Fisch sich bald an eine Schildkröte festsaugt, die dann zusammen mit dem Fisch an der Leine herausgezogen wird.
Von der Synökie und Parökie zum ausgesprochenen Schmarotzertum, dem Parasitismus, ist nur ein Schritt. Der Parasitismus kennzeichnet sich im Gegensatz zu allen anderen Vergesellschaftungen dadurch, daß das Wirtstier stets einen Schaden erleidet, der unter Umständen sogar zum Tode führen kann. Man spricht von einem Ekto- und einem Entoparasitismus. Im ersteren Falle lebt der Parasit außen an dem Körper des Wirtes, wie es z. B. Läuse, Flöhe, Wanzen und anderes Ungeziefer tun. Beim Entoparasitismus haust der Quälgeist in den inneren Organen des Wirtstieres, wie es vom Bandwurm und anderen Eingeweidewürmern, sowie von der Trichine bekannt ist.
Parasitäre Fische sind die Neunaugen, die sich an andere Fische, Frösche und Würmer ansaugen und mit ihren Hornzähnen Löcher in den Leib fressen.
Eine neue Art der Lebensgemeinschaft finden wir bei den Blumentieren, jenen zarten, zum Teil herrlich buntgefärbten Meerestieren, die in ihrer Gestalt Pflanzen gleichen und die Besucher[S. 325] eines Aquariums immer wieder von neuem in Entzücken versetzen. Die rote Koralle, die in früherer Zeit als Schmuck bei der Damenwelt so beliebt war, ist das äußere Skelett einer großen Tierkolonie, in dem die einzelnen Tiere, „Polypen“ genannt, eingebettet sind. Das Skelett, das aus hornartiger oder kalkartiger Masse besteht, wächst durch Knospung dauernd weiter und zeichnet sich durch eine große Mannigfaltigkeit in seiner Form aus. Der Korallenstock der roten Edelkoralle gleicht mit seinen Verästlungen einem Baum. Der ganze Bau ist mit zahllosen Polypen besetzt, die einzeln in Röhren eingebettet sind. Sie können sich ganz in das Gehäuse zurückziehen. Zur Aufnahme von Nahrung strecken sie sich heraus und entfalten ihre zierlichen Fangarme. Der Polyp der Edelkoralle sieht wie ein kleiner weißer Stern aus, und der rote Korallenbaum, besät mit zahllosen Sternchen, ist ein herrlicher Anblick. Wie ein geheimnisvoller Zauber erscheint das Leben dieser Blumentiere.
Prächtige Gebilde zeigen auch die Hornkorallen, deren Skelett nicht wie bei der roten Edelkoralle aus Kalk, sondern aus Hornsubstanz besteht. Der gelb oder violett gefärbte Venusfächer aus dem tropischen Teil des westlichen Atlantik gleicht einem großen Fächer, der aufrecht im Wasser steht und von den Wellen leise hin und her geschaukelt wird.
Bei den Orgelkorallen hat jedes Tier sein eigenes, röhrenförmiges Gehäuse. Die Röhren stehen wie Orgelpfeifen dicht nebeneinander senkrecht auf einer Platte und sind noch durch Zwischenplatten fest verbunden.
In der Tierkolonie eines Korallenstockes herrscht die größte Gemeinschaft, da sämtliche Polypen durch Nahrungskanäle, die den ganzen Aufbau durchziehen, miteinander verbunden sind.[S. 326] Die Nahrung des Einzeltieres kommt also allen Bewohnern der Kolonie zugute.
Das Skelett ist kein totes Gehäuse, sondern ist ebenso wie das Skelett der Wirbeltiere am Stoffwechsel beteiligt. Stirbt der untere Teil eines Korallenstockes ab, so bildet sich eine Scheidewand zwischen dem noch lebenden und dem toten Teil der Kolonie. Der abgestorbene Teil dient dann nur noch als Wurzel oder Sockel für die lebende Kolonie.
Die Fortpflanzung erfolgt dauernd durch Knospung. Daneben werden zeitweise Eier ausgestoßen, die frei im Meere umhergetrieben werden, bis sie sich festsetzen und so die Grundlage zur Bildung einer neuen Kolonie geben. Die Korallen sind getrennten Geschlechts. Die männlichen und weiblichen Tiere leben entweder in besonderen Stöcken, oder sie sind an einem Stock vereint.
Von unvergleichlicher Pracht und Schönheit ist die Korallenbildung in den Tropen. Zwischen dem 25. Grad nördl. und dem 25. Grad südl. Br. in einer Wassertemperatur von mindestens 24 °C leben die Riffkorallen im flachen Küstenwasser bis zu einer Tiefe von etwa 30 m. Hier bedecken die Korallen in allen möglichen Farben, blau, grün, violett, gelb, purpurrot und zartrosa, auf weite Strecken den Meeresgrund und bilden die bekannten Korallenbänke, die sich gleich mächtigen Gebirgen unter dem Wasser auftürmen. Der Anblick eines solchen Blumengartens, in dem uns ein wundersames Tierleben die prächtigste Flora vortäuscht, ist das Unvergleichlichste und Schönste, was die Natur geschaffen hat. Selbst der nüchterne Gelehrte, der sonst gewohnt ist, die Erscheinungen der Natur im staubigen Zimmer unter dem Mikroskop zu erforschen, wird beim Anblick dieses Naturwunders zur Begeisterung entflammt. Die Hand des Künstlers vermag[S. 327] nicht jene Farbenpracht auch annähernd so stimmungsvoll wiederzugeben, wie sie in Wirklichkeit ist. Werden doch all die leuchtenden Farben der Korallenbank durch das Grün des Wassers wie von einem geheimnisvollen, duftigen Schleier überdeckt, der die Farbenkontraste zu herrlicher Harmonie abstimmt.
Ernst Häckel schildert den ersten Eindruck, den er von den Korallenbänken empfing, mit folgenden, begeisterten Worten: „Die vielgerühmte Pracht der indischen Korallenbänke in ihrem vollen Farbenglanz zu schildern, vermag keine Feder und kein Pinsel. Die begeisterten Schilderungen von Darwin und anderen Naturforschern, die ich früher gelesen, hatten meine Erwartungen hoch gespannt, sie wurden aber durch die Wirklichkeit übertroffen. Ein Vergleich dieser formenreichen und farbenglänzenden Meerschaften mit den blumenreichsten Landschaften gibt keine richtige Vorstellung. Denn hier unten in der blauen Tiefe ist eigentlich alles mit Blumen überhäuft, und alle diese zierlichen Blumen sind lebendige Korallentiere. An den verzweigten Bäumen und Sträuchen sitzt Blüte an Blüte. Die großen bunten Blumenkelche zu deren Füßen sind ebenfalls Korallen. Ja sogar das bunte Moos, das die Zwischenräume zwischen den größeren Stöcken ausfüllt, zeigt sich bei genauer Betrachtung aus Millionen winziger Korallentierchen gebildet. Und alle diese Blütenpracht übergießt die leuchtende arabische Sonne in dem kristallhellen Wasser mit einem unsagbaren Glanze.
In diesen wunderbaren Korallengärten, welche die sagenhafte Pracht der zauberischen Hesperidengärten übertreffen, wimmelt ein vielgestaltiges Tierleben. Metallglänzende Fische von den sonderbarsten Formen und Farben spielen in Scharen um die Korallenkelche, gleich den Kolibris, die um die Blumenkelche der Tropenpflanzen schweben. Noch viel mannigfaltiger und interessanter[S. 328] als die Fische sind die wirbellosen Tiere der verschiedensten Klassen, welche auf den Korallenbänken ihr Wesen treiben. Zierliche durchsichtige Krebse aus der Garnelengruppe klettern zwischen den Korallenzweigen. Auch rote Seesterne, violette Schlangensterne und schwarze Seeigel klettern in Menge auf den Ästen der Korallensträucher, der Schar bunter Muscheln und Schnecken nicht zu gedenken. Reizende Würmer mit bunten Kiemenfederbüschen schauen aus ihren Röhren hervor. Da kommt auch ein dichter Schwarm von Medusen geschwommen, und zu unserer Überraschung erkennen wir in der zierlichen Glocke eine alte Bekannte aus der Ostsee und Nordsee.“
„Man könnte glauben,“ fährt der große Forscher fort, „daß in diesen bezaubernden Korallenhainen, wo jedes Tier zur Blume wird, der glückselige Friede der elysischen Gefilde herrscht. Aber ein näherer Blick in ihr buntes Getriebe lehrt uns bald, daß auch hier, wie im Menschenleben, beständig der wilde Kampf ums Dasein tobt, oft zwar still und lautlos, aber darum nicht minder furchtbar und unerbittlich. Überall lauert Schrecken und Gefahr.“ —
Außer den Küstenriffen, wo die Korallenbildung sich unmittelbar an die Küste anschließt und diese gewissermaßen fortsetzt, gibt es noch Damm- oder Barriereriffe, die in größerer Entfernung der Küste vorgelagert sind. Sie haben bisweilen eine gewaltige Längenausdehnung. Das größte Barriereriff liegt vor der nördlichen Festlandküste Australiens in einer Entfernung von 80 bis 150 km vom Lande und hat eine Länge von 2000 km. Sogar mitten im offenen Ozean finden sich Korallenriffe, die Inseln bilden.
Wie kommt die Korallenbildung in so weiter Entfernung von der Küste zustande, wenn der Polyp, der die Koralle bewohnt,[S. 329] nur in flachem Wasser gedeihen kann? Die Antwort auf diesen scheinbaren Widerspruch verdanken wir Darwin, der es verstand, auch dies Rätsel der Natur in genialer Weise zu lösen. Hiernach sind die Barriereriffe früher Küstenriffe gewesen. Die Küste ist allmählich tiefer gesunken, und zugleich haben die Korallen sich nach oben ausgedehnt, um unweit der Wasseroberfläche zu bleiben, wie es ihre Lebensbedingung verlangt. Ebenso erfolgte die Bildung der Koralleninseln, auch Atolls genannt. Ursprünglich war hier eine richtige Insel, an deren Küste Korallenbänke standen. Die Insel versank allmählich in den Fluten des Meeres, und die Korallen türmten ihre Bauten immer höher, um lebensfähig zu bleiben, so daß schließlich anstatt der einstigen Insel nur das Korallenriff übrigblieb, das die Stelle, wo die Insel versank, als breiter Ringstreifen umschließt und in seiner Mitte einen See bildet. Auf den über den Meeresspiegel hervorragenden Teilen des Atolls bildet sich häufig ein üppiger Pflanzenwuchs. Sogar Kokospalmen wachsen hier, da nicht allzu selten Kokosnüsse angeschwemmt werden. Diese Palmenhaine im Meere zeigen schon aus weiter Entfernung dem Schiffer die gefahrbringenden Korallenriffe an, an denen schon so manches stolze Ozeanschiff gescheitert ist.
Die Richtigkeit der Darwinschen Erklärung für die Bildung von Atolls und Dammriffen zeigt sich am besten darin, daß stets nur die obere Schicht der Korallenstöcke mit Polypen besetzt ist, während die darunter befindliche tiefere Schicht, die bisweilen hunderte und tausende Meter hoch ist, nur aus abgestorbenen Skeletteilen besteht.
Nicht immer sind Koralleninseln die Wahrzeichen versunkenen Landes, sondern sie können auch auf andere Weise entstehen, nämlich durch Hebung des Meeresbodens, die so groß ist, daß der[S. 330] flache Wasserstand eine Korallenbildung begünstigt. Die Darwinsche Erklärung läßt sich also nicht in allen Fällen anwenden, wie die neueren Forschungen ergaben.
Ebenso wie die Korallen bilden auch die gleichfalls zu den Blumentieren gehörenden Seefedern eine große Tierkolonie. Nicht ein äußeres Skelett vereint die Tiere, sondern die einzelnen Polypen gruppieren sich um einen großen Hauptpolypen, der mit einem Stiel lose im Schlamm des Meeresbodens steckt. Der Hauptpolyp besitzt in seinem Innern eine hornige oder kalkartige Achse. Im Gegensatz zu den Korallen haben wir hier eine innere Skelettbildung. Ernährungskanäle verbinden die Tiere untereinander. Eine „koloniale“ Muskulatur befähigt die Kolonie, sich als ein Ganzes zusammenzuziehen und auszudehnen. Die Seefedern sind hierdurch imstande, ihre Gestalt auffällig zu verändern. Sie vermögen durch Ausdehnung ihren Körperumfang um das Sechzigfache zu vergrößern. Die Schönheit der Seefedern wird noch durch ihr Leuchtvermögen erhöht. Das Leuchten wird durch eine chemische Umsetzung von Fetteilchen in den Körperzellen hervorgerufen.
Eine Tierkolonie bilden auch die farbenprächtigen Staatsquallen, die wir schon in dem Abschnitt über „Biotechnik“ kennengelernt haben. Hier begegnen wir zum ersten Male einer Staatenbildung im Tierreich, d. h. es findet eine Arbeitsteilung unter den einzelnen Wesen der Kolonie statt. Die Schwimmglocken, medusenartige Wesen, sorgen für die Fortbewegung, schlauchartige Freßpolypen führen die Ernährung aus. Letztere stehen mit einem weitverzweigten Röhrennetz in Verbindung, das die Nahrung an alle Bewohner der Kolonie weitergibt. Ferner gibt es besondere Tastpolypen, die Taster und Fangarme tragen, und Gonophoren, die als männliche und weibliche Geschlechtstiere die Fortpflanzung[S. 331] besorgen. Das Ganze gruppiert sich abteilungsweise um einen vertikalen Stamm, der oben eine Luftblase enthält, die den Auftrieb beim Schwimmen gibt. Die Kolonie hat in ihrer Gesamtheit das Aussehen einer Qualle, ist aber in Wirklichkeit die Vereinigung zahlreicher Einzeltiere zu einem Staatswesen mit sehr sinnreicher Arbeitsteilung. —
Eine Staatenbildung in höchster Vollkommenheit sehen wir bei den Ameisen, Bienen und Termiten.
Im Bienenstaat lebt nur ein fortpflanzungsfähiges weibliches Wesen, die Königin, welche keine Rivalinnen duldet. Ihr Geschlechtsleben haben wir schon in dem Kapitel „Liebesleben und Fortpflanzung“ kennengelernt.
Die Hauptaufgabe im Bienenstaat fällt den Arbeiterinnen, Weibchen mit verkümmerten Geschlechtsorganen, zu. Sie sind kleiner als die Königin, aber mit besonderen Organen für ihre Arbeit ausgerüstet. Sie haben einen langen Rüssel, mit dem sie den Honig aus den Blüten saugen. Der Nektar wird verschluckt und zu Hause wieder ausgespien. Kleine Vertiefungen an der Außenseite der Schienen der Hinterfüße dienen als „Körbchen“ beim Einsammeln des Blütenstaubes. Mit Hilfe der an der Ferse befindlichen „Bürste“, die aus reihenweise angeordneten Haaren besteht, wird der Blütenstaub in die Körbchen gekehrt. Außerdem sind die Arbeiterinnen ebenso wie die Königin am Hinterleib mit einem Giftstachel bewaffnet, der den männlichen Drohnen fehlt.
Im Bienenstaat gilt allein das Recht der Frau. Die Königin, die nur einmal in ihrem Leben befruchtet wird, sorgt unaufhörlich durch Eierlegen für eine zahlreiche Nachkommenschaft und die Erhaltung des Volkes. Dafür wird sie von den Arbeiterinnen sorgsam gehätschelt, gefüttert und gepflegt. Sie, die Herrscherin des[S. 332] Staates, lebt wie eine Gefangene unter ihren Untertanen, denn nur wenige Male darf sie das Heim verlassen. Als Jungfrau schwingt sie sich zum Hochzeitsflug in den blauen Äther, um nach ihrer Rückkehr nur dann wieder einen Ausflug zu unternehmen, wenn es gilt, einer jungen, neugeborenen Königin das Feld zu räumen.
Alles ist im Bienenstaat auf die Frau eingestellt. Die ganze Arbeit, den Bau der Waben, das Einsammeln von Honig und Blütenstaub, die Zubereitung des Bienenbrots, die Pflege der Larven, kurz alle für die Erhaltung des Stocks notwendigen Verrichtungen üben einzig und allein die Arbeiterinnen aus. Die Drohnen lassen sich nur füttern, faulenzen aber im übrigen und unternehmen bei gutem Wetter Spazierflüge, wobei sie auch fremde Stöcke besuchen, in denen sie ohne weiteres geduldet werden.
Wilhelm Busch geißelt mit köstlichem Humor in seinem „Schnurrdiburr, oder die Bienen“ das bequeme Nichtstun der Drohnen mit den Versen:
Unter den Arbeitsbienen ist die Art der Arbeit genau geregelt und verteilt. Jede Biene verrichtet nur eine ganz bestimmte Arbeit. In den ersten drei Wochen ihres Lebens versehen die Arbeiterinnen nur Arbeit im Innern des Stockes. Sie nehmen den vom Ausfluge zurückkehrenden Bienen den Blütenstaub und den aus dem Kropf gespienen Honig ab und füllen ihn in die Zellen. Andere Bienen bereiten Wachs aus dem Sekret ihrer Hinterleibsringe, wieder andere bauen Waben und verdeckeln die mit Honig[S. 333] gefüllten Zellen, nachdem die „Apotheker“ vorher ein Tröpfchen Ameisensäure hinzugesetzt haben, damit der Honig nicht verdirbt. Besondere „Straßenkehrer“ halten die Wohnung sauber und befördern den Unrat und die Leichen gestorbener Bienen hinaus. Die „Gesundheitspolizisten“ sorgen für eine gründliche Lufterneuerung, indem sie fortgesetzt mit den Flügeln fächeln, wobei etwa 400 Flügelschläge in der Sekunde erfolgen. Am Flugloch üben „Posten“ die Kontrolle aus und lassen nur Arbeitsbienen passieren, die zum Stock gehören, weisen aber fremde Eindringlinge ab.
Die Arbeitsbiene kennt während ihrer kurzen Lebensdauer, die nur wenige Wochen währt, nichts als Arbeit, die sie rastlos vom Morgen bis zum Abend verrichtet, nichts als selbstlose Arbeit für das Allgemeinwohl, für die Erhaltung des Staats. Gewaltige Moral und Ethik liegen in dem Geist, der das surrende Völkchen der Bienen beseelt.
Ebenso wie bei den Bienen herrscht im Ameisenstaat eine strenge Ordnung und Disziplin. Die Arbeiter sind nicht immer verkümmerte Weibchen, sondern bei manchen Arten auch begattungsunfähige Männchen. Ferner gibt es bei den Ameisen außer den Arbeitern noch eine besondere Kaste, die Soldaten. Sie haben einen sehr großen Kopf und sehr starke Kiefer. Sie bilden gewissermaßen das „stehende Heer“ des Ameisenstaates, dem die Verteidigung im Falle eines Angriffes obliegt. In Friedenszeiten verrichten sie auch gewisse Arbeiten, die für die schwächeren Arbeiter zu schwer sind. Sie zerkleinern harte Sämereien und große Insekten, die den Ameisen zur Nahrung dienen. Während den Arbeiterinnen der Bienen nur ein kurzes Dasein beschieden ist, können die Arbeiter und Soldaten der Ameisen mehrere Jahre leben.
[S. 334]
Die Arbeiter bauen das Heim mit seiner Einrichtung, füttern die Königin und sorgen für die junge Brut. Puppen und Larven werden nach dem Alter gesondert und in verschiedenen Räumen untergebracht, auch je nach der Witterung bald in höhere, bald in tiefere Stockwerke des Baues gelegt, damit stets der richtige Grad von Wärme und Feuchtigkeit vorhanden ist. Den jungen Ameisen sind die Geschwister beim Ausschlüpfen behilflich, indem sie das Gewebe des Kokons durchbeißen.
Außerordentlich groß ist der Reinlichkeitssinn der Ameisen. Die Larven werden beleckt, geputzt und gesäubert. Auch an ihrem eigenen Körper duldet die Ameise nicht den geringsten Schmutz. Mit den Haaren ihrer Vorderfüße bürstet sie ihren Körper, und außerdem dient noch ein dornartiger Fortsatz an der Fußschiene zum Abschaben von Schmutz. Auch das Innere der Behausung wird stets sauber gehalten. Jeglicher Unrat wird sofort hinausgeschafft, tote Kameraden werden fortgetragen, bisweilen sogar regelrecht bestattet, indem man die kleine Leiche mit Erde überschüttet.
An den zahlreichen Ausgängen der Burg stehen Wachen. Sie alarmieren, sobald sie etwas Verdächtiges bemerken, und sofort eilen die Soldaten in großen Mengen herbei, um die Feste zu verteidigen. Die gegenseitige Verständigung erfolgt hierbei mit den Fühlern, mit denen sich die Ameisen berühren, wobei die Art der Berührung, die entweder durch schnelle Schläge oder sanftes Streicheln ausgeführt wird, über die Sachlage Aufklärung gibt. Manche Ameisen können auch durch Reiben von Körperteilen Geräusche erzeugen, die ebenfalls zur Verständigung gebraucht werden.
Die eigenartigste Erscheinung im sozialen Leben der Ameisen ist die Sklaverei. Manche Arten halten sich Hilfskräfte, die ihre[S. 335] eigenen Arbeiter unterstützen müssen — eine Einrichtung, die sonst nirgends im Leben der Tiere verbreitet ist, und die außer den Ameisen nur der Mensch kennt.
Um sich Hilfskräfte zu verschaffen, rauben die Ameisen Puppen aus einer anderen Kolonie, und zwar stets von einer friedlichen, kleineren Art. Zu ihrem Raube ziehen die Ameisen in großen Kolonnen nach einem vorher ausgekundschafteten Nest aus. Ist die Hauptmasse der Krieger angelangt, so erfolgt der Überfall auf das feindliche Lager. Falls die Bewohner nicht schon vorher durch ihre Kundschafter den geplanten Überfall erfahren haben und noch rechtzeitig ihre Behausung verlassen konnten, entspinnt sich ein erbitterter Kampf zwischen den Parteien, der stets mit dem Siege der stärkeren Angreifer endet. Die angegriffenen, schwächeren Ameisen werden rücksichtslos niedergemetzelt, die Puppen werden geraubt, und dann erfolgt der Rückmarsch in die eigene Burg. Hier werden die fremden Puppen sorgsam gehütet und gepflegt und die ausschlüpfenden Ameisen später als Arbeiter eingestellt. Diese scheinen sich ihrer Verschleppung nicht bewußt zu sein, sondern fühlen sich unter den fremden Ameisen völlig heimisch und betrachten sich als Angehörige des Staates, in dem sie nicht als minderwertige Sklaven gelten, sondern gleiche Rechte genießen.
Bei den Amazonenameisen ist die Sklaverei geradezu eine Lebensnotwendigkeit geworden. Sie zeichnen sich durch ganz gewaltige säbelförmige Vorderkiefer aus, die eine hervorragende Waffe im Kampf mit anderen Ameisen sind. Aber mit diesen unförmigen Kiefern sind sie nicht imstande, selbständig Nahrung aufzunehmen, sondern sie müssen sich von anderen Ameisen füttern lassen, und diesen Dienst verrichten die geraubten Sklaven, ohne die die Amazonenameisen einfach verhungern müssen.
[S. 336]
Bei der europäischen arbeiterlosen Ameise (Anergates atratulatus) hat sich das Sklaventum zum Parasitentum verwandelt. Wie schon der Name sagt, gibt es bei diesen Ameisen keine Arbeiter, sondern nur Königinnen und Männchen. Infolgedessen errichten diese Ameisen auch keine Kolonien. Eine befruchtete Königin sucht das Nest einer anderen Ameisenart auf. Die Liebe der Ameisen zu dieser fremden Königin ist so groß, daß sie ihre rechtmäßige Königin ermorden und ganz im Banne der fremden stehen. Diese nimmt sehr bald durch Anschwellung ihres Leibes eine unförmige Gestalt an, die sie unfähig macht, sich selbst zu ernähren. Sie wird dann von den fremden Ameisen gefüttert und sorgsam gehegt. Ihre Anwesenheit bedeutet stets den Untergang der Kolonie, denn da sie nach der Ermordung der rechtmäßigen Königin das einzige weibliche Wesen ist, so werden nur arbeiterlose Ameisen erzeugt, die wieder auswandern, um sich in einer anderen Kolonie anzusiedeln, und die rechtmäßigen Inhaber der Kolonie sterben aus.
Die kriegerischen Unternehmungen der Ameisen gelten nicht nur dem Sklavenraub, sondern haben häufig auch andere Ursachen. Begegnen sich die Arbeiter zwei nah benachbarter Kolonien auf ihren Beutezügen, so entspinnt sich in der Regel ein heftiger Kampf. Beide Parteien erhalten Zuzug aus ihren Behausungen, und es entwickelt sich eine regelrechte Schlacht, die mit größter Erbitterung ausgefochten wird, bis schließlich ein Teil unterliegt und mit großen Verlusten das Feld räumen muß.
Die über Europa, Asien und Nordamerika verbreiteten Diebesameisen der Gattung Solenopsis hausen in den Nestern anderer Ameisen, in deren Erdwänden sie ihre Baue anlegen. Die Wirtsameisen dulden sie ruhig in ihrer Behausung, zumal sie den winzig kleinen Untermietern, die vom Abfall ihres Tisches leben, nichts anhaben können.
[S. 337]
Außer den Sklaven halten sich die Ameisen auch regelrechtes „Nutzvieh“, das sie sogar in eigens hergerichteten Ställen pflegen. Am meisten begehrt sind die Blattläuse, die einen süßen Stoff absondern, der als klebrige Masse die Blätter der Rosen und anderer Sträucher bedeckt. Dieser Honigtau der Blattläuse ist ein Leckerbissen für die Ameisen. Durch Streichen mit den Fühlern veranlassen sie die Blattläuse zur Hergabe des begehrten Stoffes. Die Blattläuse werden gewissermaßen wie Kühe gemolken. Um die Kolonien ihrer Nutztiere errichten manche Ameisenarten schützende Erdbauten und züchten auf diese Weise ihr Nutzvieh in regelrechten Stallungen.
Ebenso wie die Blattläuse werden auch Schildläuse, Zikaden und die Raupen des blauen Himmelsfalters wegen ihrer wohlschmeckenden Ausscheidungen von den Ameisen sehr geliebt.
In den Bauten der Ameisen nisten sich mit Vorliebe Kurzflügelkäfer aus der Familie der Staphylinidae ein, die von den Ameisen nicht nur geduldet sondern sogar mit größter Hingabe gehätschelt und gepflegt werden. Die Käfer scheiden aus besonderen Hinterleibsdrüsen einen aromatischen Saft aus, dessen Genuß die Ameisen geradezu in Verzückung versetzt, und der auf sie wohl eine ähnliche Wirkung ausübt wie Tabak, Opium oder Alkohol auf den Menschen. Der Vergleich ist um so mehr gerechtfertigt, als der Saft der Kurzflügelkäfer keineswegs eine notwendige Nahrung für die Ameisen ist, sondern lediglich ein berauschendes Genußmittel, dem sich die Ameisen mit solcher Lüsternheit hingeben, daß dadurch das ganze Volk mit der Zeit zugrunde geht. Die Ameisen sind nämlich auf die Käfer so erpicht, daß sie sich schließlich nur noch deren Pflege widmen, sie füttern, hätscheln und ihre Brut großziehen, aber ihre eigene Brut vernachlässigen. Infolgedessen entstehen keine Königinnen mehr, und auch die neugeborenen[S. 338] Arbeiterlarven verkümmern. Der ganze Staat degeneriert und stirbt aus.
Besonders gefährlich für den Ameisenstaat ist der Große Büschelkäfer (Lomechusa strumosa). Er haust als Parasit in der Ameisenkolonie und pflanzt sich hier fort. Unfähig, selbst zu fressen, ist er ganz darauf angewiesen, von seinen Wirten ernährt zu werden, die berauscht von den aromatischen Ausdünstungen dies Amt mit größter Hingabe ausüben. Aber nicht nur durch die Vernachlässigung der eigenen Brut wird dem Ameisenstaat geschadet, sondern in noch schlimmerem Maße durch diesen Parasiten selbst. Die Larven des Käfers vertilgen nämlich die Larven und Puppen der Ameisen, wodurch sich der Untergang der Kolonie sehr schnell vollzieht. Wir haben also hier die eigenartige Erscheinung, daß ein höchst schädlicher Parasit von dem Wirtstier besonders gepflegt wird. So gibt uns die kleine, fleißige Ameise mit ihrem hochentwickelten sozialen Leben zugleich ein abschreckendes Beispiel für die verheerende Wirkung der unüberwindlichen Gier nach narkotischen Genüssen.
Der Ameisenstaat mit seiner Berufseinteilung, der Einstellung fremder Arbeitskräfte und der Haltung von Nutztieren verkörpert gewissermaßen eine hohe Kulturstufe in der Tierwelt. Ebenso wie beim Menschen führt diese Kultur zur Genußsucht, und die Genußsucht zur Gefährdung des Volkswohls — ein warnendes Beispiel für die Menschheit!
Aus den vielseitigen Lebensgewohnheiten der Ameisen, die, wohin man auch sieht, immer wieder neue und staunenswerte Überraschungen bieten, mögen zum Schluß noch die Treibjagden der in den Tropen lebenden Treiberameisen erwähnt werden. Es sind „Raubtiere“ im wahrsten Sinne des Wortes. Sie überfallen nicht nur andere Insekten, wie Grillen, Spinnen und Raupen,[S. 339] sondern sogar Säugetiere und Vögel, um ihren Hunger zu stillen. Bei ihren Raubzügen gehen sie planmäßig zu Werke und veranstalten regelrechte Treibjagden. Ein gewaltiger Troß dieser großen und wehrhaften Ameisen zieht auf die Jagd aus. Sein Erscheinen veranlaßt alles in der Nähe befindliche Getier so schnell wie möglich zur Flucht. Die Ameisen verfolgen ihr Wild, hetzen es zu Tode oder umzingeln es. Die erlegte Beute wird zerstückelt und dann heimgebracht. Sogar große Tiere, wie Esel, Pferde und Rinder, sind schon den raubgierigen Insekten zum Opfer gefallen. Selbst auf ihren Beutezügen können die Ameisen des beliebten narkotischen Getränks, das ihnen die Kurzflügelkäfer liefern, nicht entbehren. Nach echter Weidmannsart muß ab und zu ein „Schluck“ genommen werden, um die von der Jagd ermüdeten Glieder aufzufrischen. Infolgedessen werden die beliebten Käfer auf den Beutezügen mitgeschleppt und als Rucksack auf dem Rücken getragen. Eine afrikanische Käferart hat sogar an den Füßen besondere Haftorgane, mit denen sie sich auf dem Ameisenrücken festhält. Der Käfer heißt infolgedessen „Ameisenreiter“. Wir haben hier ein vortreffliches Beispiel, wie meisterhaft die Natur es versteht, das Leben der Tiere aufeinander einzustellen und in wechselseitiger Beziehung einzustimmen.
Die Treiberameisen überfallen bisweilen ein Termitennest. In dem sich entspinnenden Kampfe unterliegt auch manche Ameise und läßt ihre „Schnapsflasche“, den kleinen Käfer mit dem süßen Lebenselixier, zurück, den sich dann die Termiten aneignen, um ebenso wie die Ameisen den aromatischen Saft zu genießen.
Auch die Termiten haben ein hochentwickeltes Staatenleben. An der Spitze der Kolonie stehen ein König und eine Königin, die ein inniges Eheleben führen und für die Nachkommenschaft sorgen. Sie kommen als geflügelte Insekten zur Welt, finden sich auf[S. 340] dem Brautflug zusammen und führen nach Verlust ihrer Flügel zunächst ein unterirdisches Leben in einer Erdhöhle oder im Holz eines morschen Baumes. Im Laufe von vier bis fünf Monaten werden sie geschlechtsreif. Das Weibchen beginnt nun mit dem Eierlegen, das von jetzt an ihren ganzen Lebenszweck ausfüllt. Sie entwickelt eine ungeheure Fruchtbarkeit. Die Königin der kriegerischen Termite legt alle 2 Sekunden ein Ei, d. h. täglich etwa 30000 Eier, ohne diese fruchtbare Tätigkeit während ihres etwa 10jährigen Lebens auch nur einen Augenblick zu unterbrechen!
Aus der ersten Nachkommenschaft entstehen „Arbeiter“ und Soldaten, d. h. unfortpflanzungsfähige Weibchen und Männchen mit verkümmerten Geschlechtsorganen. Damit ist der Anfang zur Bildung eines Termitenstaates gelegt. Später werden neben den stets zahlreicheren Arbeitern auch Männchen und Weibchen erzeugt, die ausschwärmen, um wieder einen neuen Staat zu gründen.
Die Arbeitsteilung ist im Termitenstaat bis ins kleinste durchgeführt und geregelt. Die „Hebammen“ entbinden die Königin, indem sie ihr die Eier aus dem Leibe herausholen. Andere Dienstboten putzen und reinigen den König und die Königin, die beide während ihres ganzen Lebens unzertrennlich beieinander weilen. Wieder andere Termiten schaffen Nahrung herbei und füttern das Herrscherpaar. Das königliche Gemach wird dauernd von einer Anzahl Soldaten bewacht. Außer dieser Leibwache gibt es noch Schutzleute, die die Arbeiter, welche das Königspaar betreuen, beaufsichtigen und Nachlässige zur Arbeit anfeuern. Den Aufbau des Wohnhauses besorgen die eigentlichen Arbeiter, und zwar auch wieder unter der Aufsicht von Wachen und unter dem Schutz von Soldaten, die Posten stehen. Erfolgt ein feindlicher Angriff, so schlagen die Posten Alarm, indem sie durch Aneinanderschlagen[S. 341] der Kiefer oder durch Reiben des Kopfes an der Brust Töne erzeugen, die als Signal dienen und sogleich das unter Führung von Offizieren bereitstehende Heer herbeilocken.
Eine merkwürdige Einrichtung finden wir bei einer auf Ceylon lebenden Termitenart, die in hohlen Bäumen haust. Die Tiere legen sich außen am Baumstamm Aborte an, die aus einzelnen Zellen bestehen, in denen die Bewohner der Kolonie ihre Bedürfnisse verrichten. Soldaten versehen den Dienst von „Abortfrauen“. Sie reinigen die Kloaken und geleiten die einzelnen Termiten, die erscheinen, zu den „unbesetzten“ Stellen.
Stirbt die Königin, so wird sofort eine neue Königin herangezogen, denn die Arbeiter haben es ganz in der Hand, aus einer jungen Termite, die nicht als Larve, sondern gleich im fertigen Zustande aus dem Ei schlüpft, je nach der Fütterungsweise einen Arbeiter, einen Soldaten, eine Königin oder auch einen König heranzuziehen. Nach dem Tode der Königin lebt der König häufig in Vielweiberei. Es werden mehrere junge Termiten zu Weibchen ausgebildet und als Kebsweiber dem verwitweten König zugeführt, der nun als Sultan ein Haremsleben führt.
Erweist sich die Anzahl der Individuen in einer Kaste zu groß, so werden die überflüssigen Tiere einfach getötet, denn Faulenzer und unnütze Esser dulden die strengen Gesetze des Termitenstaates nicht, in dem eine mustergültige Ordnung und hervorragende Disziplin herrschen. —
Die Durchführung eines so hoch organisierten sozialen Lebens, das bis ins kleinste in straffer Disziplin geregelt ist, scheint ohne gegenseitige Verständigung der einzelnen Individuen kaum möglich, und so dürfen wir mit Recht annehmen, daß auch die Bienen, Ameisen und Termiten eine Sprache haben, mit der sie sich untereinander ihre Gefühle und Empfindungen mitteilen.
[S. 342]
Da unter den Sinnen der Geruchssinn bei diesen Tieren am höchsten ausgebildet ist, so darf man vermuten, daß er bei der gegenseitigen Verständigung eine große Rolle spielt. Der Sitz des Geruchssinnes befindet sich bei den Bienen auf den Fühlern. Eine Arbeiterin hat auf jedem Fühler nicht weniger als 5000 Geruchsorgane, woraus die große Bedeutung des Geruchs für das Seelenleben der Biene am besten hervorgeht.
Unter den Termiten gibt es einige völlig blinde Arten, und trotzdem verrichten diese ihre Arbeiten genau so gut wie ihre sehenden Verwandten. Der bis zur höchsten Vollkommenheit entwickelte Geruch ersetzt den Mangel des Augenlichts. Die Tiere vermögen sich mit Hilfe des Geruchs so gut zu orientieren, daß sie durch das fehlende Sehvermögen nicht im geringsten beeinträchtigt werden. Auf ihren Raub- und Wanderzügen scheiden die blinden Termiten tropfenweise eine Flüssigkeit aus, die auf dem Erdboden antrocknet, und deren Geruch den nachfolgenden Termiten als Wegweiser dient und später auf dem Heimweg die Richtung zur Kolonie angibt.
Die Ameisen gebrauchen mit Vorliebe ihre Fühler zur Verständigung, indem sie sich gegenseitig betasten. Je nach dem Inhalt der Nachricht ist die Art der Berührung verschieden, so daß wir es hier mit einer wohlorganisierten „Fühlersprache“ zu tun haben. Außerdem verständigen sich die Tiere durch Geräusche, die sie durch Reiben von Körperteilen hervorbringen. Die Termiten klopfen zu diesem Zweck mit dem Kopf auf den Erdboden.
Mit der Erforschung der Bienensprache hat sich neuerdings v. Frisch[7] eingehend beschäftigt und ist dabei zu äußerst überraschenden und interessanten Ergebnissen gelangt.
[S. 343]
Frisch hat zunächst durch Experimente nachgewiesen, daß die frühere, besonders von Heß vertretene Ansicht, daß die Bienen farbenblind seien, durchaus nicht zutrifft. Mit Ausnahme von Rot können die Bienen alle Farben erkennen, und die Farbenempfindlichkeit ihres Auges reicht sogar noch weit in das Ultraviolette hinein, wodurch der Mangel des Farbensinnes für Rot in gewisser Weise ausgeglichen wird. Dies gilt nicht nur für die Bienen, sondern für alle Insekten.
Die Rotblindheit der Insekten und andererseits die Wahrnehmung des ultravioletten Lichtes steht wohl mit den Farben der Blüten im engen Zusammenhang, denn in der Blütenflora ist gerade die rote Farbe im Gegensatz zu Weiß, Blau und Gelb sehr schwach vertreten, während eine stark ultraviolette Reflexion an Blumenblättern sehr verbreitet ist.
Außer der Rotblindheit ist der Farbensinn der Bienen noch in anderer Beziehung beeinträchtigt. Das Bienenauge vermag keine Farbennuancen wahrzunehmen. Gelb und Orange, sowie Blau und Violett sind für das Bienenauge dieselben Farben.
„Um die biologische Bedeutung dieser Erscheinung ins rechte Licht zu setzen,“ sagt Frisch, „müssen wir uns das Verhalten der Bienen bei ihren Sammelflügen vergegenwärtigen. Sie sind blumenstete Insekten, d. h. ein bestimmtes Individuum befliegt Stunden und Tage hindurch nur Blüten ein und derselben Pflanzenart. Für die Biene ist dies vorteilhaft, weil sie überall auf dieselbe Blüteneinrichtung trifft, mit der sie vertraut ist; für die Blüten ist die Stetigkeit der Besucherin zur Herbeiführung einer regelrechten Kreuzbefruchtung von größter Wichtigkeit. Eine Blumenstetigkeit ist aber nur möglich, wenn die Biene die gesuchten Blumen von den anderen Blüten mit Sicherheit zu unterscheiden vermag. Nun ist jener Reichtum an Farbenabstufungen,[S. 344] der unser Auge in einer blumenreichen Wiese erfreut, für das Bienenauge nicht vorhanden. So können den Bienen die Farben der Blüten nur in beschränktem Maße zu ihrer Unterscheidung dienen. Es müssen ihnen daneben andere Merkzeichen zu Gebote stehen. Die Form der Blumenblätter, die Farbenkombinationen in mehrfarbigen Blüten, die ›Saftmale‹ spielen hier nachweislich eine Rolle — aber auch sie reichen nicht aus, die Zielsicherheit der sammelnden Bienen zu erklären.“
Das wichtigste Merkmal zur sicheren Unterscheidung der Blüten ist nach Frisch der Duft. Dennoch ist das Riechvermögen der Bienen bei weitem nicht so groß, als man bisher angenommen hat. Wohl vermag die Biene feine Geruchsunterschiede wahrzunehmen, aber sie kann es nur auf eine geringe Entfernung von einigen Zentimetern. Erst wenn sie die Blüte umschwärmt, erkennt sie an dem Duft, ob es die von ihr gesuchte Blumenart ist.
Der Blütenduft hat aber für die Tätigkeit des Bienenvolkes noch eine andere, höchst wichtige Bedeutung. Die heimkehrenden Bienen übermitteln durch den ihnen anhaftenden Duft ihren Genossen, von welchen Blüten sie die Tracht geholt haben. So bildet der Blütenduft ein Verständigungsmittel in der Sprache der Bienen.
Der Vorgang, der sich hierbei abspielt, ist folgender:
Hat eine Biene auf ihrem Sammelflug eine neue, reiche Trachtquelle entdeckt, so gibt sie nach ihrer Heimkehr die Tracht zunächst an eine Schwester, die Innendienst versieht ab, und beginnt dann auf den Waben einen Rundtanz aufzuführen. Sie rennt hastig in kreisenden Bewegungen umher. Ihr Rundtanz erregt im höchsten Maße die Aufmerksamkeit aller anderen Bienen im Stock. In dichten Scharen drängen sie sich um die Tänzerin und schließen sich ihr zum Teil an, so daß schließlich eine ganze Gesellschaft den Reigen aufführt.
[S. 345]
Durch den Tanz zeigt die heimgekehrte Biene ihren Schwestern an, daß sie eine neue Quelle reicher Tracht gefunden hat.
Plötzlich bricht die Biene das Tanzen ab und verläßt den Stock, um neue Tracht zu holen. Man sollte vermuten, daß die anderen Bienen ihr in großen Scharen folgen, um sich die begehrte Honigstelle zeigen zu lassen. Dies ist aber nicht der Fall. Sie beachten die Flugrichtung der Tänzerin gar nicht, sondern schwärmen allein aus; viele haben sogar schon während des Tanzes den Stock verlassen, um die neue Tracht aufzusuchen. Sie fliegen in allen Richtungen umher und suchen selbständig die Tracht vermittels ihres Geruchssinnes, nachdem sie von der Tänzerin Witterung empfangen haben.
Jede heimkehrende Biene führt nun so lange einen Tanz auf, als noch reichliche Tracht vorhanden ist, um hierdurch ihre Genossinnen immer wieder zu neuem Eifer anzuspornen. Läßt die Tracht nach, dann hört auch das Tanzen auf. Der Tanz bringt also nicht nur Kunde von der Entdeckung einer Trachtquelle, sondern auch von ihrer Reichhaltigkeit. Ja, die Verständigung geht sogar noch weiter. Auch die Anzahl der Arbeitskräfte, welche zum Einholen der aufgefundenen Tracht notwendig ist, wird von den Bienen bekanntgegeben, denn nach den Erfahrungen von Frisch sammeln sich an der Tracht stets nur so viel Bienen an, als zur Verrichtung der Arbeit notwendig sind, niemals aber eine unnötig große Anzahl. Auch hierbei erfolgt die Verständigung wieder vermittels des Geruchs. Die Arbeitsbienen besitzen ein besonderes Duftorgan im Hinterleib. Saugt nun eine Biene an reicher Tracht, so stülpt sie ihr Duftorgan aus und lockt durch den sehr starken Duft, den die Bienen auch auf weite Entfernungen wahrnehmen können, immer neue Hilfskräfte herbei. So wird die Tracht sehr stark beflogen. Sind genug Arbeitskräfte vorhanden,[S. 346] dann unterbleibt der Gebrauch des Duftorgans, dagegen wird das Tanzen bei der Rückkehr noch fortgesetzt, damit der Flug zur Tracht nicht völlig aufhört. Die Bedeutung des Duftorgans als Verständigungsmittel geht aus folgendem, von Frisch ausgeführten Versuch hervor. Er stellte zwei reich beschickte Futterplätze in der Umgebung eines Bienenstockes auf, die sehr bald von zwei Gruppen Bienen beflogen wurden. Nun verklebte er den Bienen einer Gruppe die Duftorgane, was zur Folge hatte, daß hier der Anflug bald erheblich nachließ. Der Zuzug neuer Bienen war nur ⅒ so groß als bei der Gruppe mit unversehrten Duftorganen, obwohl die heimgekehrten Bienen beider Gruppen im Stock tanzten.
Außer Nektar sammeln die Bienen auch Blütenstaub ein, und zwar sind es verschiedene Bienen, die Honig und Pollen eintragen. Auch die pollentragenden Bienen verkünden einen reichen Fund durch Tanzen, aber in anderer Weise. Sie führen keine kreiselnden, sondern schlängelnde Bewegungen aus. Die Art des Tanzes zeigt also an, ob es sich um Honig oder Pollentracht handelt, und jede Biene ersieht hieraus, ob die zu verrichtende Arbeit für sie in Betracht kommt.
Das Mittel, welches Frisch anwandte, um in diese intimsten Vorgänge des Bienenlebens Einsicht zu gewinnen, ist ebenso sinnreich wie einfach. Er zeichnete die einzelnen Bienen mit Farbflecken auf den Flügeln, die sich, während die Biene saugt, mit einem kleinen Pinsel unschwer auftragen lassen. Auf diese Weise vermochte er, die einzelnen Bienen zu unterscheiden und ihr Verhalten genau zu beobachten.
So verdanken wir den mühsamen und gründlichen Forschungen von Frisch eine überaus wertvolle Aufklärung über das Seelenleben der Bienen, das, so kompliziert es auch auf den ersten[S. 347] Blick erscheint, schließlich nur auf einfachen Sinneswahrnehmungen beruht.
„Eine Zeichensprache hat sich uns erschlossen,“ sagt unser Gewährsmann am Schluß seiner lehrreichen Ausführungen, „die in ihrer Einfachheit auf jeden Beschauer Eindruck macht. Ein paar Bewegungen, ein bißchen Duft, den die Biene von den Blüten in den Stock hineinträgt, ein bißchen Duft, den sie draußen am Schauplatz ihrer Entdeckung selbst in die Luft entströmen läßt, vermitteln eine Verständigung, die kaum besser funktionieren und nicht einfacher gedacht werden könnte.“
[6] Eduard Reichenow, Biologische Beobachtungen an Gorilla und Schimpanse. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin. Jahrgang 1920.
[7] K. v. Frisch, Sinnesphysiologie und „Sprache“ der Bienen. Die Naturwissenschaften, Jahrgang 12.